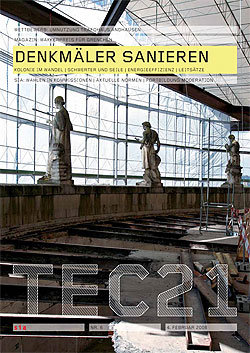Editorial
Umbauten und Sanierungen gehören zu den wichtigsten Bauaufgaben der heutigen Zeit. In den nächsten Jahren dürfte ihre Bedeutung noch weiter zunehmen: Während 1985 noch fünfmal mehr in Neubauten als in Eingriffe in die bestehende Bausubstanz investiert worden war, beträgt das Verhältnis heute rund zwei zu eins.[1]
Gleichzeitig mit dem wachsenden Anteil Umbauten sind auch die Anforderungen an diese Bauaufgabe gestiegen. Das liegt zum einen daran, dass zurzeit die Sanierung vieler Hochkonjunkturbauten ansteht, deren Energiehaushalt heutigen Ansprüchen nicht mehr zu genügen vermag. Zum anderen hängt diese Tendenz mit der demografischen Entwicklung und dem gestiegenen Wohlstand zusammen. Innerhalb einer Generation hat sich in der Schweiz die durchschnittlich pro Person beanspruchte Wohnfl äche verdoppelt, während die mittlere Personenzahl pro Wohnung gesunken und das Durchschnittsalter der Bewohnerinnen und Bewohner gestiegen ist. Vielfach reicht es also nicht mehr, die bestehenden, meist auf eine hypothetische Kernfamilie zugeschnittenen Wohnungen aufzufrischen; um die gewandelten Wohnbedürfnisse zu befriedigen, bedarf es zunehmend tiefer gehender Interventionen, die auch die Raumund Tragstruktur der Bauten tangieren. Hinzu kommen gestiegene technische Standards, deren Erfüllung wiederum Auswirkungen auf die Tragstruktur haben kann – beispielsweise, wenn erhöhte Schallschutzanforderungen den Bau dickerer und damit auch schwererer Unterlagsböden erfordern. Dieses System voneinander abhängiger, häufi g auch untereinander in Widerspruch stehender Randbedingungen gilt es mit den Eigenheiten des Bestands in Einklang zu bringen. Bei Altbauten, die sich durch eine spezielle geschichtliche oder gestalterische Bedeutung auszeichnen und daher eine entsprechende Rücksichtnahme auf den Bestand erfordern, erhöht sich die Komplexität der Aufgabe zusätzlich.
Dies gilt insbesondere, wenn das betroffene Gebäude teilweise oder ganz unter Denkmalschutz steht. Die Balance zwischen ökonomischer, ökologischer, funktionaler, sozialer und kultureller Nachhaltigkeit wird von Fall zu Fall neu ausgehandelt. Dass dies jedoch keinen Nachteil für das Projekt bedeuten muss, ist Thema dieses Heftes: Gerade die Auseinandersetzung mit der denkmalgeschützten, oft in mehrfacher Hinsicht wertvollen Bausubstanz generiert mitunter herausragende Lösungen. Judit Solt
Anmerkung
[1] Bundesamt für Statistik: Jährliche Bau- und Wohnbaustatistik, BFS – Statistisches Lexikon der Schweiz
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Umnutzung Trafohaus Andhausen
10 MAGAZIN
Wakkerpreis für Grenchen
14 KOLONIE IM WANDEL
Beat Aeberhard
Architektur: Gelungener Umbau der denkmalgeschütztenGenossenschaftssiedlung «Industrie1» in Zürich durch Pfister Schiess Tropeano.
19 SCHWERTER UND SEILE
Andreas Lutz, Peter Osterwalder
Ingenieurwesen: Die Kolonie «Industrie1» stellte für APT Ingenieure eine mehrfache Herausforderung dar.
23 ENERGIEEFFIZIENZ VERSUS DENKMALPFLEGE?
Stefan Hartmann
Umwelt: Die energetische Sanierung denkmalgeschützter Altbauten kann zu Konflikten führen – einige Beispiele.
26 LEITLINIEN DER PRAKTISCHEN DENKMALPFLEGE
Marco Rossi
Denkmalpflege: Ein kürzlich publiziertes Grundsatzpapier formuliert übergeordnete denkmalpflegerische Leitlinien.
30 SIA
Diskussionsabende Byak | Wahlen in Kommissionen | Bauherrenberatung | Aktuelle Normen | Fortbildung Moderation
33 PRODUKTE
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Kolonie im Wandel
Weil Komfort- und Raumansprüche sich ändern, haben Wohnbauten einen hohen Bedarf an kontinuierlicher baulicher Anpassung. Am Beispiel der Wohnkolonie «Industrie 1» der Baugenossenschaft des eidgenössischen Personals (BEP), deren Wohnungsangebot nach bald 100-jährigem Bestehen von Pfister Schiess Tropeano & Partner Architekten erneuert wurde, lassen sich einige grundsätzliche Gedanken zum Spannungsfeld Denkmalpfl ege versus zeitgemässe Nutzungsanforderungen formulieren.
Der Befund war nicht ungewöhnlich: Nach knapp einem Jahrhundert Betrieb genügte die Wohnkolonie «Industrie 1» den veränderten Raum- und Komfortansprüchen nicht mehr und erwies sich als sanierungsbedürftig. Die Bauherrschaft sah sich indessen mit einer nicht alltäglichen Situation konfrontiert: Die Liegenschaft ist im kommunalen Inventar für schützenswerte Bauten eingetragen. Zur Auswahl stand somit die kurzfristige Behebung spezifi scher Mängel an Fenstern und im Küchen- und Sanitärbereich oder eine Erwägung längerfristiger Strategien. Die Planung eines Ersatzneubaus – wie der Abriss alter, vorwiegend günstiger, aber eben unzeitgemässer Wohnungen zu Gunsten eines Neubaus mit deutlich grösseren, moderneren und teureren Wohnungen euphemistisch umschrieben wird – stellte aus denkmalpfl egerischen Gründen keine Option dar. Doch nicht nur der unumstrittene Denkmalwert rettete die Siedlung vor dem Abbruch. Die zunehmend schwierig werdende Vermietung der durchwegs kleinen Wohnungen führte zur Überlegung, wie der Wohnwert gesteigert werden könnte, um insbesondere vermehrt Familien anzuziehen. Die Bausubs - tanz war grösstenteils in gutem Zustand und strukturell besonders geeignet, durch Zusammenlegung kleinerer Einheiten ein diversifi ziertes Angebot an grosszügigen Wohnungstypen zu gewinnen. Als weitere vordringliche Pfl ichtgebote gelten der Einbau von Aufzügen, der interne Schallschutz sowie das Bereitstellen privater Aussenräume. Die Verantwortlichen der Siedlung beschlossen daher, eine umfangreiche Sanierung in Angriff zu nehmen.Die Kolonie «Industrie 1» der BEP befi ndet sich im Zürcher Kreis 5 an der Röntgenstrasse.
Erbaut wurde die quartiertypische Blockrandbebauung zwischen 1913 und 1915. Die Architekten Eduard Hess und Peter Giumini errichteten das markante Volumen im moderaten Reformstil der Zeit auf dem Trassee der einstigen Nordostbahn. Die fünfstöckige Zeile, deren leichte Krümmung sich in acht Häuser gliedert und zum Röntgenplatz hin eine Frontseite ausbildet, stellte seinerzeit einen Massstabssprung innerhalb der Struktur des Arbeiterquartiers dar. Die Genossenschaft war sich bewusst, dass die Sanierung grösstmögliche Sorgfalt erfordert. Sie schrieb deshalb 2003 einen Studienauftrag aus. Die Jury mit Beteiligung der städtischen Denkmalpfl ege erkor den Vorschlag von Pfister Schiess Tropeano & Partner Architekten zur Ausführung.
Räumliche Neuinterpretation
Die Architekten organisierten die Grundrisse neu. Die Wohnfl ächen erfuhren eine substanzielle Vergrösserung, indem die nicht tragenden Brandmauern teilweise entfernt und zwei Kleinwohnungen aus jeweils benachbarten Häusern zu einer grossen vereint wurden. Viele der neuen Wohnungen erschliessen sich nun von zwei Treppenhäusern. In einer geschickten Neuinterpretation zonierten die Architekten die Wohnungen in einen öffentlichen Wohnund einen intimeren Zimmerbereich. Ersterer fi ndet sich hofseitig: Durch die Entfernung der Korridorwand und der Brandmauer präsentiert er sich als grosszügig kombinierter Wohnund Essraum mit integrierter Küche. In der ursprünglichen Zellenstruktur zur verkehrsberuhigten Röntgenstrasse befi nden sich nun sämtliche Schlafräume.
Atmosphärisch, handwerklich und auch räumlich zeichnen sich die Wohnungen durch eine hohe emotionale Komponente aus, wie sie gerade in Neubauten oft fehlt. In der stimmungsvollen Innenraumgestaltung behaupten sich sorgsam restaurierte Teile wie das Holzwerk in einer neuen Grundrisskonfi guration. Zur spannungsreichen Dialektik von Alt und Neu ge hören die Verwendung von zeitgenössischen Materialien – wie Eichenparkett in den Wohnbereichen, farbige Linoleumböden in den Zimmern und Steinzeugbeläge in den Nasszellen – so wie die massgeschneiderten Schreinerarbeiten für die Küchen, Bäder und Einbauschränke. Die hinsichtlich Farben und Oberfl ächen im Sinne der Entstehungszeit wiederhergestellten Treppenhäuser lassen den Kraftakt nicht erahnen, der nötig war, um die unterschiedlichenAnforderungen der Feuerpolizei und der Denkmalpfl ege sowie die Vorschriften für behindertengerechtes Bauen in Einklang zu bringen. Eine grosse Herausforderung stellte der interne Schallschutz dar. Das Einbringen von zusätzlicher Masse auf die alten Ton-Hourdisdecken war wegen deren beschränkter Tragfähigkeit nur nach Einbau einer innovativen Verstärkung möglich (vgl. nächsten Artikel). Dass die Architekten die Fenstersprossen, die seit den 1960er-Jahren fehlten, auf Verlangen der Denkmalpfl ege rekonstruieren mussten, ist schwer nachvollziehbar. Offensichtlich wird damit der trügerisch schöne Schein einer Bildwirkung beschworen, der kaum als eigentlicher Träger des Denkmalwerts des Gebäudes fungiert. Exemplarisch drängt solches Handeln die Frage auf, inwieweit sich das denkmalpfl egerische Alltagsgeschäft eigentlich der Restauration widmet oder sich allmählich zur Rekonstruktion hin verschiebt. Umso ärgerlicher ist die Verordnung, als – um das Putzen zu erleichtern – auf eine Minimalversion mit lediglich aussen aufgeklebten Sprossen zurückgegriffen werden musste. Ganz zum Nachteil der Bewohnerschaft, deren Aussicht nun von der Rückseite plumper Klebesprossen beeinträchtigt wird.
Aufwertung des kollektiven Raums
Während die Denkmalpfl ege strassenseitig auf der vollständigen Rekonstruktion des ursprünglichen Zustandes beharrte, konnten hofseitig einige spannende Eingriffe umgesetzt werden. Der bislang vernachlässigte Hinterhof mutierte gemäss dem architektonischen Konzept zum verstärkt die Öffentlichkeit einbeziehenden Zentrum der Anlage. Über einen neuen Durchstich zum Röntgenplatz wird dieser besser ins städtische Gewebe eingebunden. Der neuen Ausrichtung der Wohnungen entsprechend, orientieren sich sämtliche privaten Aussenräume zum nachmittags besonnten Hof. Eine Mehrzahl der Wohnungen verfügt über generöse Terrassen. Vier «Terrassenbäume» aus Beton, deren Äste als Kragplatten alternierend in die eine oder andere Richtung wachsen, akzentuieren als freistehende plastische Struktur die historische Hoffassade, ohne diese jedoch zu berühren (vgl. nächsten Artikel). Um die Dachlandschaft zu schonen, erhielten die Wohnungen im Mansardengeschoss ihr eigenes Stück Dachterrasse. Die historischen, früher zum Wäschetrocknen benutzten Terrassen wurden in einzelne, strandkorbartige Kompartimente gegliedert und den einzelnen Wohneinheiten zugeteilt. In den beengten Platzverhältnissen richtete man grosszügige Loggien ein, während man an den Zeilenenden die Wohnräume mit französischen Balkonen versah. Die vier verschiedenen privaten Aussenraumtypen verleihen dem vorher wenig attraktiven Hinterhof neues Leben.
Die im siegreichen Studienbeitrag vorgesehene vollständige Absenkung des Hofes scheiterte an der Bewilligung der Baubehörden. Dies tut der Qualität aber keinen Abbruch, denn der Kompromiss einer partiellen Absenkung lediglich im Bereich des Gemeinschaftsraums schafft eine Zonierung des Hofs in unterschiedliche Bereiche, deren Charakter durch Geometrie, Materialisierung und Bepfl anzung inszeniert wird. Integrale Bestandteile der Gestal - tung bilden eine Seccomalerei der Zürcher Künstlerin Cristina Fessler auf der blinden Mauer eines eingeschossigen Hofgebäudes und eine grossräumige Skulptur mit dem sinnfälligen Namen «Seiltänzer». Gestaltet wurde diese hoffassende Installation vom Bildhauer und Landschaftsgestalter Jürg Altherr, der bereits beim Wettbewerbsverfahren Partner des Planungsteams war (Statik der Installation: vgl. nächsten Artikel).
Intelligenter Diskurs
Die Transformation bestehender Substanz ist inzwischen eine alltägliche Bauaufgabe. Leicht erwachsen Konfl ikte bei Bauten von historischem Gewicht, bei denen sich die Denkmalpfl ege einschaltet. Nicht selten divergiert ihre Rolle als Anwältin des geschichtlichen Bewusstseins von den Interessen und Vorstellungen der Nutzer, die ihren Blick auf das Potenzial des Gegenwärtigen ausrichten. Die Architekten müssen mit jedem Detail den Spagat zwischen den Wünschen der Nutzer und der Sicherung der Originalsubstanz bewältigen. Ob der «Schönheit des Wahren» oder der «Wahrheit des Gebrauchs» der Vorzug zu geben ist,steht stellvertretend für die Kontroverse Denkmalpfl ege versus zeitgemässe Nutzungsanforderungen. Doch die beiden Parameter sind durchaus in Einklang zu bringen. Gerade aus der Reibung am Bestand lässt sich eine architektonische Komplexität gewinnen, wie sie auf der grünen Wiese nicht zu erzeugen wäre.
Der so einschneidende wie behutsame Eingriff von Pfister Schiess Tropeano vermittelt ein - drücklich, wie im Umgang mit historischer Substanz Selbstbewusstsein, aber auch Gelassenheit sowie differenzierte und zugleich versöhnliche Betrachtungsweisen weiterführen. Selbstredend wirkte sich die Erfüllung sämtlicher Aufl agen auf die Kosten der Restaurierung aus. 3500 Franken hat die Genossenschaft pro Quadratmeter in die Wohnkolonie «Industrie 1» investiert, rund 2800 Franken wären bei einem günstigen Neubau aufzuwenden gewesen. Eine 4.5-Zimmer-Wohnung mit 104 m² schlägt mit 1780 Franken zu Buche, ein angesichts des hohen Ausbaustandards und der attraktiven Lage nach wie vor äusserst moderater Mietzins. Sämtliche Wohnungen fanden denn auch problemlos Absatz. Heute wohnen in der Siedlung – aus den ursprünglich 80 Einheiten wurden 50 – mehr Leute als vor der Sanierung. Davon sind mehr als ein Drittel Kinder und Jugendliche.
Schlummernde Chancen
Glücklicherweise hält nichts ewig. Selbst an den steinernen Pyramiden nagt der Zahn der Zeit. Auf die Nutzung bezogen, lässt sich eine besonders ausgeprägte Flüchtigkeit konstatieren. Leider hilft diese Erkenntnis nicht immer, eine entkrampfte Vorgehensweise für die Pfl ege von gebauter Substanz zu formulieren, egal ob denkmalwürdig oder nicht. Gerade in einer Zeit, in der das Schielen nach medialer Aufmerksamkeit Werte wie Dauerhaftigkeit, Kontinuität und Langsamkeit in den Hintergrund zu drängen droht, stellt sich die Frage nach der bestandesgerechten Handlungsweise. Gefordert sind alle Beteiligten, denn nur in zwar mühseliger, aber konstruktiver Zusammenarbeit lassen sich zeitgemässe Nutzungsanforderungen mit einem Altbau versöhnen, wie das vorliegende Beispiel anschaulich illustriert. Die Chance, durch vereinte, katalytisch aufeinander wirkende Kräfte weiterzukommen als im Alleingang, lohnt sich durchaus zu packen. Am Weiterbauen können alle wachsen.
[ Beat Aeberhard, dipl. Architekt ETH ]TEC21, Mo., 2008.02.04
04. Februar 2008 Beat Aeberhard
Schwerter und Seile
Der Umbau der Wohnkolonie «Industrie 1» der BEP in Zürich hat die für die Tragkonstruktion zuständigen APT Ingenieure in mehrfacher Hinsicht gefordert: Neue Elemente mussten hinzugefügt und die alte Tragstruktur musste verstärkt werden. Dabei galt es, die bestehende Bausubstanz trotz der nötigen Anpassungen an heutige Sicherheits- und Komfortstandards wenn möglich zu erhalten.
Im Wettbewerb bot der Entwurf neben den üblichen Aufgaben – das Ausbrechen, das Verschieben von Wänden oder das Unterfangen des Untergeschosses – vor allem eine grosse Herausforderung: Die Balkone sollten wie Bauchladen ans Gebäude gehängt werden, hätten 4 m ausgekragt und wären mit schrägen Zugstangen nach oben an der nächsten Decke befestigt gewesen. Diese spektakuläre Idee war ein Grund dafür, dass der Entwurf als Sieger aus dem Wettbewerb hervorging. In der Planungsphase stellte sich jedoch heraus, dass der Vorschlag zu kühn war. Zum einen würden sich die Bewohnerinnen und Bewohner auf diesen weit auskragenden Balkonen zu exponiert und auch zu unsicher fühlen, zum anderen wären für die Befestigung aufwändige Verankerungen und Abspannungen im Gebäude erforderlich gewesen. Daher wurden die Balkone parallel zum Gebäude ausgerichtet und stärker der jeweiligen Wohnung zugeordnet (vgl. vorangehenden Artikel).
Trotz dieser Anpassung erfüllt diese Lösung nach wie vor eine Vielfalt von Anliegen: Die Balkone erzielen eine kontrastierende, spielerische Modulation der bisher eher spröden und rigiden Fassade, ihr Nutzwert ist hoch, und die Eingriffe in die historische Substanz beschränken sich auf ein Minimum. Eine zentrale Stütze und je asymmetrisch auskragende Bereiche sorgen für einen prägnanten Ausdruck. Die Balkontürme, die entfernt an Katzenbäume erinnern mögen, stehen als eigenständige Bauwerke vor den Häusern und berühren diese nur im Bereich der Tür. Man tritt über einen feinen Spalt ins Freie und auf den Balkon hinaus (vgl. auch inneres Titelbild).
Verstärkung der Wohnungsdecken
In der Wettbewerbsphase ging man davon aus, dass es in den Wohnungen Holzbalkendecken gebe. Sondierungen während der frühen Planungsphase zeigten aber, dass die Decken bis ins dritte Obergeschoss aus Hourdiselementen bestanden. Detaillierte Untersuchungen am Bauwerk ergaben ausserdem, dass die Bewehrung über der Mittelwand – die Hourdisdecken waren als Zweifeldträger ausgebildet – so schlecht eingelegt war, dass sie nicht oben in der Zugzone, sondern ca. in Trägermitte im Nulllinienbereich zu fi nden war. Als Durchlaufträger konnten die Hourdisträger somit nicht gerechnet werden. Dies führte zu einem Problem, denn um einen besseren Schallschutz der Wohnungen zu erreichen, sollten die Decken mit einem stärkeren und dementsprechend schwereren Unterlagsboden versehen werden. Nachrechnungen zeigten rasch, dass die Tragfähigkeit der Decke mit den vorhandenen Mängeln und den zusätzlichen Lasten nicht mehr gegeben war. Daraufhin wurden verschiedene Vorschläge zur Verbesserung der Tragfähigkeit ausgearbeitet. Ein Ansatz sah den Einbau eines Trägerrostes vor. Betonstreifen parallel zu den Hourdisträgern und eine Querrippe in Ortbeton in Feldmitte hätten die Beanspruchung der Hourdisrippen auf ein Niveau reduziert, das ihrer Tragfähigkeit entsprochen hätte. Die Verstärkung sollte in Deckenebene erfolgen, um keine Raumhöhe zu verlieren. Die Lösung wäre einfach und auch relativ kostengünstig auszuführen gewesen. Die Denkmalpfl ege war mit diesem Vorschlag jedoch nicht einverstanden: Es würde dabei zu viel der alten Deckensubstanz ersetzt bzw. zerstört. Auch die Architekten lehnten die Trägerrostlösung ab, da sie die historische Raumstruktur verunklärt und als Tragwerksteil im historischen Massivbau einen Fremdkörper dargestellt hätte.
Aus diesen Gründen wurde eine Verstärkung gesucht, die die Decke weitgehend bestehen liess. Die gefundene Lösung mit einer geklebten Bewehrung, welche die Durchlaufwirkung des Zweifeldträgers wiederherstellen sollte, erfüllte die Wünsche der Denkmalpfl ege. Sie barg aber einige statische Knacknüsse: Würden die Lamellen auf dem bestehenden, kaum vibrierten Überbeton der Hourdisdecke genügend haften? Wie sollten die vielen Aussparungen am Fuss der Mittelwand, die für die Durchführung der Lamellen erforderlich waren, ausgebildet und wieder kraftschlüssig geschlossen werden?
Durch umfangreiche Vorversuche überprüfte man einerseits die Haftzugfestigkeiten des Überbetons und fand andererseits eine geeignete Methode, um die Aussparungen in der Mittelwand auszuführen (vgl. Bilder 2 und 3). Während des Baus wurden die heiklen Phasen ständig überwacht und die gemessenen Werte der Haftzugfestigkeit protokolliert. Die geforderten Messresultate wurden in der Ausführung erreicht, die Tragsicherheit der Decke für die neuen Lasten war gewährleistet.
Architekt und Ingenieur - Ein Ziel, Zwei Sichtweisen
Aus der Sicht der Tragkonstruktion ist kritisch anzumerken, dass hier mit dem Einsatz von «hochgezüchteten» Lamellen auf einen Beton mässiger Qualität zwei gar unterschiedliche Materialien kombiniert wurden. Materialfestigkeiten können in dieser Weise nur beschränkt genutzt werden. Die Architekten dagegen interessierte gerade die Möglichkeit, die hoch entwickelte Lamellentechnologie mit einer für die damalige Zeit ebenfalls neuen Technik (Hourdis) zur Erhaltung derselben kombinieren zu können – auch wenn der Beton aus heutiger Sicht keine gute Qualität aufweist. Die Lamellenverbundkonstruktion ähnelt der Hourdiskonstruktion insofern, als dass auch diese eine Verbundkonstruktion von neuem und altem Material darstellt: Ziegel und Beton mit dem verhältnismässig jungen industriellen Stahlprofi l. Die statische Ertüchtigung ist somit aus architektonischer Sicht eine passende und überzeugende Erweiterung.
Beim Umbau wurden Wohnungen zusammengelegt, indem durchgehende Wände in Querrichtung abgebrochen wurden. Gleichzeitig zogen die Planer bei den Treppenhäusern neue Wände ein, die der horizontalen Lastabtragung dienen. Damit die Aussteifung und die Erdbebensicherheit beibehalten bzw. verbessert werden konnten, sind die neuen Querwände konsequent in bewehrtem Stahlbeton erstellt und mit eigenen Fundamenten im Baugrund verankert.
Kunst am Bau: Installation im Hof
Der Plastiker Jürg Altherr war vom Anfang bis zum Schluss des Projekts Teampartner. Von ihm stammt die Idee mit den Bauchladenbalkonen sowie die raumgreifende Seilinstallation im Hof. Diese unterstreicht den Wandel vom Hinterhof zum Wohnhof und war schon Teil des Wettbewerbsbeitrages. Sie besteht aus einer vertikalen, auf dem Boden stehenden Skulptur (Pendelstütze), die an der Spitze von einem Seil stabilisiert wird. Das Seil ist mit einer aus - geklügelten Konstruktion im Dachboden und den angrenzenden Wänden verankert. Vom obersten Wohngeschoss führt es quer durch den Hof über den Stützenkopf bis in eine Hängekonstruktion, wo es von einem Gegengewicht gespannt wird. Zu hohe Seilkräfte können so verhindert werden.
[ Andreas Lutz, dipl. Bauing. ETH, APT Ingenieure GmbH, Peter Osterwalder, dipl. Bauing. ETH/SIA (Ingenieur für Kunst am Bau) ]TEC21, Mo., 2008.02.04
04. Februar 2008 Andreas Lutz, Peter Osterwalder