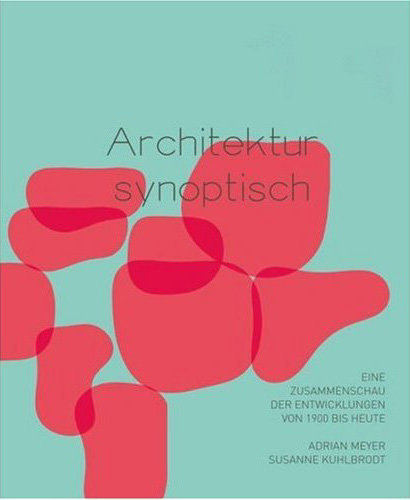Das Alterswohnhaus Neustadt II in Zug verbindet Alt und Neu zu einem in sich stimmigen Ganzen. Der Stadtarchitekt erklärt, warum das an diesem Ort die richtige Lösung ist – städtebaulich wie architektonisch.
Das Alterswohnhaus Neustadt II in Zug verbindet Alt und Neu zu einem in sich stimmigen Ganzen. Der Stadtarchitekt erklärt, warum das an diesem Ort die richtige Lösung ist – städtebaulich wie architektonisch.
In seinem vielbeachteten Schweizer Beitrag «And Now the Ensemble!» an der Architekturbiennale Venedig 2012 plädierte Miroslav Šik für eine Baukunst des Unspektakulären. Er forderte Berufskollegen, Bauherrschaften und Behörden auf, weniger selbstreferenzielle Objekte zu planen und neue Bauten als das zu begreifen, was sie sind: ein Teil ihrer gewachsenen Umgebung. Das Weiterweben als Entwurfsstrategie hat er nun am Beispiel eines bemerkenswerten Umbaus vorgeführt – der Transformation eines Schulhauses aus den 1960er-Jahren in ein Wohnhaus für ältere Menschen.
Chaotische Umgebung
Die Zuger Neustadt zeichnet sich durch eine sehr heterogene Gestalt aus. Unterschiedliche Visionen und städtebauliche Idealvorstellungen prallen auf engstem Raum aufeinander. In den vergangenen fünfzig Jahren hat man diverse Entwicklungsströmungen aufgegriffen und wieder fallen lassen. Dabei ging fast die ganze, ursprünglich aus dem 19. Jahrhundert stammende Bausubstanz verloren. Entstanden war die Neustadt als typisches homogenes Gründerzeitquartier um den ersten Bahnhof nach 1864; wie in anderen Städten hatte die Bahn die Industrialisierung beflügelt. Das damit einhergehende Bevölkerungswachstum löste eine rege Bautätigkeit von Miet- und Geschäftshäusern aus. Ab 1909 liess die Stadt an der Bundesstrasse das Schulhaus Neustadt durch die Architekten Dagobert Keiser und Richard Bracher errichten. Der markante und bis heute die Innenstadt prägende Bau mit seinen hohen Schweifgiebeln fand in der damaligen Fachpresse grosse Aufmerksamkeit. So wurde etwa die reiche Farbigkeit des neobarocken Baus sowohl im Innern als auch an der Fassade kontrovers diskutiert.[1] 1966–68 folgte als Erweiterung der Schulanlage das funktionalistische Schulhaus Neustadt II der Zuger Architekten Heinrich Gysin und Walter Flüeler (Abb. S. 23).
Effektiv in Gebrauch war diese Erweiterung nicht einmal 40 Jahre: Der Zuger Innenstadt gingen die Kinder aus, denn der Ersatz der Gründerzeitbebauung durch Geschäftsbauten führte zu einem massiven Bevölkerungsschwund. Das Schulhaus musste einer neuen Nutzung zugeführt werden. Infrage kamen Privatschulen, Familien- oder Alterswohnungen. Aufgrund typologischer Eigenschaften – breite Gänge und grosszügige Raumhöhen – und der unmittelbaren Nachbarschaft zu einem Altersheim beschloss die Stadt, Alterswohnungen unterzubringen. Zusätzlich sollte das Gebäude mit einer zweigeschossigen Aufstockung verdichtet werden. Den 2007 ausgeschriebenen anonymen Studienauftrag mit Präqualifikation konnte Miroslav Šik für sich entscheiden. Überzeugt hatte er die Jury mit einer spannungsvollen Volumetrie und einem architektonischen Ausdruck, der eine Versöhnung des Projekts mit seinem schwierigen Kontext verhiess.
Alt und Neu frisch verputzt
Die 18 Alterswohnungen befinden sich in den ersten beiden Obergeschossen des Bestandes und in der zweigeschossigen Aufstockung. Im Erdgeschoss sind eine Arztpraxis und Büros untergebracht (der Spitex und der Verwaltung der Stiftung, die das Altersheim betreibt). Die ursprüngliche Grundrissfigur wird durch den doppelgeschossigen Holzbau weitgehend fortgeführt (Grundrisse, S. 26). Längsseitig springt die Aufstockung teilweise treppenartig zurück, sodass in der engen städtebaulichen Situation räumliche Ausweitungen entstehen. Dadurch erhält die Stirnseite des Volumens eine stehende statt liegende Proportion, was dem Haus eine deutlich höhere Präsenz verleiht (Abb. S. 22). Als Nebeneffekt wirken sich die Rücksprünge positiv auf die Besonnung der Wohnungen aus. Die an sich strenge und dichte Konzeption wird durch die Differenzierung der Kubatur, durch Zugänge im Erdgeschoss und durch Loggien aufgelockert.
Bestand und Aufstockung wurden mit einer konventionellen Wärmedämmung energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Das ganze Haus ist mit einer grüngrauen, vertikal gerillten Kammstruktur verputzt und erhält dadurch eine starke, monolithische Bildhaftigkeit. Handwerklich ist der Putz eine Meisterleistung: Unterbruchsfrei über die 15 m hohe Fassade gezogen, wurde er anschliessend von Hand nachgeschliffen. Die Nobilitierung des herkömmlichen Materials Putz und die hellen Umrahmungen, die einzelne Fenster auszeichnen und die serielle Fensteranordnung individualisieren, verleihen der Fassade die Anmutung eines sorgfältig geschneiderten Kostüms (Abb. S. 27 oben).
Schöne Wohnungen statt trister Zimmer
Im Innern fällt zunächst der breite Gang auf. Er ist mit demselben Putz verkleidet wie die Gebäudefassade, was seinen öffentlichen Charakter unterstreicht. Aus jeder Wohnung kann man über ein internes Fenster in den Gang schauen. Die Bank vor jeder Wohnungstür ist nicht nur eine funktionale Sitzgelegenheit, sondern auch eine Einladung an die Bewohnerinnen und Bewohner, sich den kollektiven Raum anzueignen (Abb. rechts Mitte).
Die einzelne Wohnung betritt man über eine offene Küche; die Garderoben und die Erschliessungsflächen sind in den Wohnbereich integriert. Die 2 ½- und 3 ½-Zimmer-Wohnungen entfalten sich um wohlproportionierte Loggien. Überdies ist jeweils eines der Schlafzimmer durch eine grosse Schiebetüre mit dem Wohnbereich verbunden. Der Zuschnitt der Räume macht die Wohnungen über die Raumdiagonale erlebbar – ein Motiv, das einen perspektivisch spannenden Übergang zwischen den Räumen ermöglicht (Abb. S. 25 unten). Den Architekten gelingt es, trotz der beträchtlichen städtebaulichen Dichte eine durchwegs hohe Wohnqualität zu sichern. Der Blick schweift entweder über den nahen Zugersee zu den innerschweizer Alpen oder auf die Züge, die in den benachbarten Bahnhof einfahren (Bild rechts unten). Eine zurückhaltende Materialisierung und die in Crèmetönen gehaltenen, fast monochromen Oberflächen verleihen den Räumen eine opulente Atmosphäre, ohne das Zeitgenössische zu negieren.
Entstanden sind stimmungsvolle Wohnungen, keine Altersheimzimmer. Die Architekten haben funktionale Notwendigkeiten berücksichtigt, ihr dringendstes Anliegen war es aber, emotionale Bedürfnisse zu befriedigen und Behaglichkeit zu schaffen.
Dass die Wohnungen spezifisch für die Bedürfnisse älterer Menschen konzipiert wurden, ist allenfalls auf den zweiten Blick ersichtlich. Insgesamt versprühen sie ein heiteres Lebensgefühl, das man nicht richtig lokalisieren kann, das jedoch stimmig und für jeden zugänglich ist.
Die Nachbarschaft wird aufgewertet
Als geistiger Vater der «Analogen Architektur» plädiert Šik dafür, die Eigenheiten eines alltäglichen Orts zu studieren und aus dessen Stimmung heraus ein Projekt zu entwickeln, das Altes und Neues zu einem vielfältigen Ensemble vermengt. Die Neustadt II erfüllt diesen Anspruch. Aus städtebaulicher Sicht ist verblüffend, wie es gelingt, selbst unterdurchschnittliche Nachbarbauten einzubinden und damit die Umgebung insgesamt aufzuwerten. Die Qualität des Projekts besteht nicht zuletzt darin, dass es weit über die eigentliche Programmerfüllung hinausgeht. Stand das funktionalistische Schulhaus nur für sich, ist das Haus für ältere Menschen als Stadtbaustein zu verstehen. Indem der «wertkonservative Rebell»[2] – wie der Kritiker Benedikt Loderer Šik einmal treffend titulierte – das Dialogische ins Zentrum des Entwurfs stellt, verfremdet er das Gewohnte mithilfe ungewohnter Stimmungsbilder und schafft ein neues Ganzes. Das Weiterweben als Entwurfsverfahren ermöglicht es, sowohl eine Verbindung zum gebauten Kontext herzustellen als auch eine Vielfalt zu generieren, in der Urbanität spriessen kann.
Dabei entsteht der Dialog auf unterschiedlichen Ebenen und in divergierenden Sprachen – etwa durch die modernistische Kubatur, die klassizistische Formensprache, die französischen Fenster, das Material, die Farben. Die Fassadensprache ahmt das Vorgefundene nicht bloss nach, sondern interpretiert es und modernisiert es moderat – etwa die benachbarten Putzfassaden, die biedermeierlichen Fenstergewände oder die Blumenfenster des Betagtenheims mit dem gerillten Kammputz und den vereinzelten, hellen Fensterlaibungen. Die Heterogenität des Stils ist durchaus gewollt. Oder wie Šik es an anderer Stelle formulierte: «Wir haben verstanden, dass die Stadt heterogen und dennoch einheitlich sein kann.»[3] Aus der grundsätzlichen Bejahung der Zuger Neustadt mit ihren Qualitäten und Unzulänglichkeiten ist im Dialog tatsächlich ein Ensemble entstanden. Dem Weiterbauen verpflichtet, lässt es jedoch – und das ist für die zukünftige Entwicklung entscheidend – unterschiedliche Interpretationen zu.
Dieses Lehrstück bestärkt die städtischen Behörden in ihrem Vorhaben, einer übergeordneten Stadtidee zum Durchbruch zu verhelfen.[4] Möge es ihnen gelingen, das heterogene Allerlei von Solisten langfristig in ein orchestriertes Ganzes zu transformieren!
Anmerkungen:
[01] Vgl. z. B. «Die Schweizerische Baukunst», offizielles Organ des BSA, 1/1909, S. 222–225 und 227–233; «Heimatschutz», Zeitschrift des Schweizer Heimatschutzes (SHS), 7/1912, S. 30–35. Der Bau wurde vor einigen Jahren originalgetreu saniert.
[02] Benedikt Loderer, Hochparterre 1992/1, S. 14–23.
[03] Judit Solt und Andrea Wiegelmann, «Was ist das Verbindende?», Interview mit Miroslav Šik, Quintus Miller, Paola Maranta, Kaschka Knapkiewicz und Axel Fickert, in: TEC21 2012/42-43, S. 28–32.
[04] Die Abteilung Städtebau arbeitet seit fünf Jahren daran, eine Stadtidee für Zug zu formulieren. Statt der bisherigen «Anything goes»-Haltung sollen klare städtebauliche Leitlinien entwickelt werden, die sich aus dem Bestand als kleinstem gemeinsamem Nenner nähren. Ziel ist ein tragfähiges übergeordnetes Stadtensemble.
TEC21, Fr., 2014.02.28
verknüpfte ZeitschriftenTEC21 2014|09 Alterswohnhaus Neustadt II
![]()