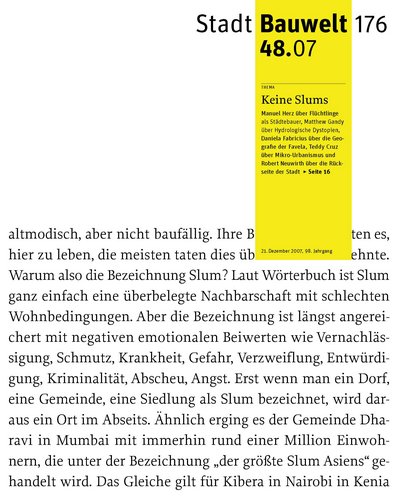Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Innenstadtinitiative Gotha. Vergebliches Mühen gegen den Verfall? | Matthias Grünzig
03 Oscar Niemeyer zum 100. Geburtstag | Jan Friedrich
03 Traveling Landscape. Ai Weiwei in Berlin | Urte Schmid
04 Eröffnung des Museums für Angewandte Kunst im Leipziger Grassimuseum | Hubertus Adam
05 Spartacus. Eva Grubinger in der Frankfurter Schirn-Kunsthalle | Ulrich Brinkmann
05 Ästhetik des Widerspruchs. 11. Berliner Gespräch des BDA | Peter Rumpf
WETTBEWERBE
10 Riebeckplatz-Hochhäuser in Halle | Günter Kowa
12 Entscheidungen
14 Auslobungen
THEMA
16 Ein „Eid des Hippokrates“ für Architekten? | Manuel Herz
18 ... die Rückseite der Stadt | Robert Neuwirth
26 Hydrologische Dystopien in Mumbai | Matthew Gandy
36 Die widersprüchliche Geographie der Favela | Daniela Fabricius
46 Flüchtlinge als Städtbauer in Eastleigh, Nairobi | Manuel Herz
56 Mikrourbanismus an der Grenze zwischen San Diego und Tijuana | Teddy Cruz
REZENSIONEN
68 Stadtarchitekturen | Axel Simon
68 Multi-National City | Florian Heilmeyer
69 The Suburbanization of New York | Carolin Mees
69 Media city | Christian Brensing
69 Schütte-Lihotzky: Millionenstädte Chinas | Wolfgang Kil
70 Ingenieurbaukunst in Deutschland 2007/2008 | Robert Meyer
70 Deutsches Architekturjahrbuch 2007/08 |
70 /06/07/ Jahrbuch.architektur.HDA.graz |
71 The A-Z of Modern Architecture | Eva Maria Froschauer
RUBRIKEN
07 wer wo was wann
66 Autoren
67 Kalender
72 Anzeigen