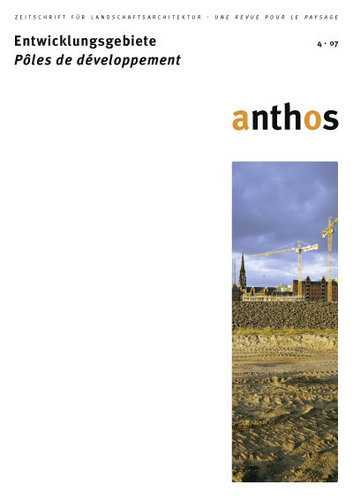Editorial
Die Transformation der Industrie- in eine Dienstleistungsgesellschaft in den letzten Jahrzehnten hat in den europäischen Städten gewaltige Umwandlungsprozesse in Gang gesetzt. Citynahe Industrie und Gewerbegebiete, aber auch Hafen-, Militär- und andere Areale werden nicht mehr gebraucht und stehen zur Disposition. Sie stellen ein enormes Entwicklungs- und Gestaltungspotenzial dar und eröffnen die Chance für eine eigentliche urbane Renaissance.
Wie aber nutzen die Städte ihre Chance? Können sie die öffentlichen Interessen in diesen von Finanz- und Immobilienkräften beherrschten Prozessen überhaupt wahrnehmen – zudem in einem Umfeld latenter neoliberaler Planungsfeindlichkeit? Wird nun auch das gebaut, was man längerfristig wirklich braucht – und in welcher Qualität?
Dass es hierzu nach wie vor die klassischen Instrumente der Richt- und Nutzungsplanung braucht, steht ausser Zweifel; sie setzen einen unabdingbaren Rahmen. Doch mit ihnen allein ist die Entwicklung unter den Bedingungen des heutigen Bodenrechtes nicht zu steuern. Neue Strategien sind gefragt. Unsere Städte haben das erkannt und ihr Instrumentarium entsprechend erweitert. Stadtentwicklung wird verhandelt. Wichtige Stichworte hierzu sind: Kooperative Entwicklungsplanung unter Einbezug aller Beteiligten; zwischen den Grundeigentümern und der Verwaltung ausgehandelte Konzepte und Verträge, welche zur Sicherung von öffentlichen Freiräumen führen sowie zur materiellen und finanziellen Beteiligung der Grundeigentümer an deren Realisierung; der Transfer von gesetzlichen Freiflächenziffern von einem Areal auf ein anderes und so weiter. Eine ganz zentrale Rolle spielen Sondernutzungspläne (Gestaltungspläne), mit denen städtebauliche Qualitäten ermöglicht werden, die über die normalen Vorgaben der Bau- und Zonenordnung hinausgehen.
Neben den Städten, in denen tendenziell bauliche Verdichtungen und höhere Renditen zur Debatte stehen, wie zum Beispiel in Zürich, gibt es natürlich auch die Regionen mit stark abnehmenden Einwohner- und Arbeitsplatzzahlen, für die ganz andere Lösungen gefunden werden müssen, wie das Fallbeispiel Dessau zeigt.
In Übersichtsbeiträgen und anhand von Einzelbeispielen aus grösseren und kleineren Städten stellt «anthos» in diesem Heft verschiedene Strategien und Projekte vor, die zeigen, wie die Anliegen der Freiraumplanung in die Entwicklungsprozesse eingebunden werden können.
Bernd Schubert