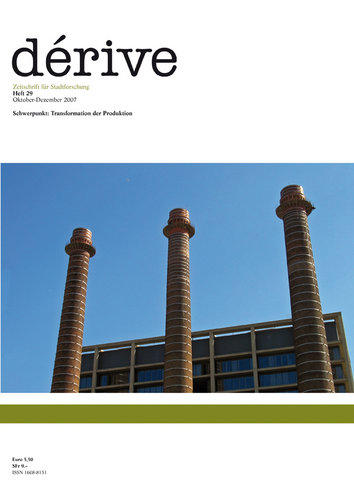Editorial
Editorial
Dass der inflationär gebrauchte Terrorismusvorwurf nicht immer begründet ist und vielen Sicherheitsfanatikern und Angstschürern allzu leicht über die Lippen kommt, ist für niemanden eine große Überraschung. (Die gleichzeitige Verharmlosung islamistischen Terrors als Widerstand oder moralisch gerechtfertigte Notwehr, die leider gerade innerhalb der Linken viel zu verbreitet ist, macht das Thema nicht gerade einfacher.) Dass jedoch Stadtforschung in Kombination mit der Verwendung von Begriffen wie Gentrification oder Prekariat und einer Abneigung gegenüber Mobiltelefonen kombiniert mit dem Nichtwissen, was Leute, die man trifft, in Ihrer Freizeit alles treiben (oder auch nicht), bereits ausreichende Verdachtsmomente sind, gegen jemanden einen Haftbefehl auszustellen, verschärft die Situation ein weiteres Mal und zwar ganz erheblich. All das trifft vermutlich nicht nur auf mich, sondern auf so manch andere dérive-LeserInnen zu.
Der Stadtforscher Andrej H. saß von 31. Juli bis zum 22. August 2007 in Berlin- Moabit in Untersuchungshaft, weil die Staatsanwaltschaft gegen ihn einen bis heute nicht aufgehobenen Haftbefehl ausgestellt hat und ihm nach dem berühmt-berüchtigten Paragraf 129a vorwirft, Mitglied der so genannten „militanten gruppe“ (mg) zu sein. Laut diversen Zeitungsberichten und Stellungnahmen dürften die Gründe für diesen Verdacht tatsächlich nicht viel umfassender sein, als oben beschrieben. Andrej H. wurde neun Monate lang observiert, sein Arbeitsplatz zweimal durchsucht, sein Computer und seine Unterlagen beschlagnahmt. Hält man sich vor Augen, was diverse InnenministerInnen – darunter auch der österreichische und der deutsche – an Überwachungsmaßnahmen (Stichwort: Online-Durchsuchung mittels Trojaner) planen, mag man sich die Auswirkungen im Falle einer Umsetzung gar nicht vorstellen. Informationen über die Verhaftung von Andrej H. finden sich auf zahlreichen Websites (Wikipedia, Telepolis, etc.). Die Möglichkeit zur Unterzeichnung einer Solidaritätserklärung gibt es auf der Website http://www.freeandrej.net.ms.
Diese Ausgabe von dérive widmet sich in ihrem Schwerpunkt dem Thema Transformation der Produktion und somit der veränderten Rolle, die Industrie für die und in der Stadt einnimmt. Näheres dazu im Einleitungsartikel von Erik Meinharter, der den Schwerpunkt redaktionell betreut hat.
Im Magazinteil bringt die neue Folge von Daniel Kalts Serie zur Kunst im öffentlichen Raum ein Interview mit den KünstlerInnen Angelo Stagno und Andrea van der Straeten, in dem sie über ihr Projekt vogelfrei sprechen. Thomas Ballhausen und Günter Krenn blicken in ihrem Beitrag über Propaganda und Ausstellungspraxis während des Ersten Weltkriegs in eine Zeit zurück, als die Leinwand ebenso wie städtische Orte der Unterhaltung in die polymediale Kriegspropaganda eingegliedert wurden. Wie angekündigt, ist in dieser Ausgabe der zweite und letzte Teil von Loic Wacquants Text Entzivilisierung und Dämonisierung zu lesen. Loic Wacquant hat – zu unserer Freude – dérive einige weitere Texte, die bisher noch nicht auf Deutsch erschienen sind, angeboten. Er wird uns also auch in Zukunft als Autor erhalten bleiben. Erstmals in dérive zu lesen ist ein Text von Hilary Tsui, die in Der Abriss des Star Ferry Pier über die nicht gerade sanfte Stadterneuerung Hong Kongs und den Widerstand dagegen berichtet. Manfred Russos Serie über die Geschichte der Urbanität begibt sich diesmal in die USA und analysiert die Utopie des Protestantismus. Mir bleibt eine interessante Lektüre zu wünschen und mich dafür zu entschuldigen, dass Platz und Zeit wieder einmal zu knapp waren, um allen Wünschen und Anfragen gerecht zu werden.
Das nächste Heft, dérive 30, bringt den Schwerpunkt Stadt im Film.
Christoph Laimer
Inhalt
Schwerpunkt: Transformation der Produktion
Erik Meinharter
Klassik als Beruhigungsmittel? Industriearchitektur um 1900
Berthold Hub
Die Stadt und die alte Industrie
Susanne Hauser
Eisenhüttenstadt: Identitäts- und Imagewandel einer Stadt
Christoph Haller
Die Danziger Erfahrung: Von Symbolen der Macht zu globalen Akteuren
Mariusz Czepcynski
Magazin
Turn Terror into Sport. Eine Intervention des theatercombinats
Rudolf Kohoutek
Natur bricht durch. Über Vögel und Menschen in der Stadt
Daniel Kalt
Der Abriss des Star Ferry Piers. Stadterneuerung und Bewahrung lokaler Kultur in Hong Kong
Hilary Tsui
Elias im schwarzen Ghetto
Loïc Wacquant
Bewegliche Ziele, starre Körper. Propaganda und Ausstellungspraxis während des Ersten Weltkriegs
Thomas Ballhausen und Günter Krenn
Kunstinsert
Zbynék Baladran
Serie: Geschichte der Urbanität – Teil 21
Utopie III; Die amerikanische Utopie des Protestantismus
Manfred Russo
Besprechungen
Räume und Prekaritäten in der Kulturökonomie: Gibt es da einen Zusammenhang?
Oliver Frey über Die Räume der Kreativszenen von Bastian Lange und Prekarisierung auf hohem Niveau von Alexandra Manske
Kreativität als postfordistischer Imperativ
Andre Krammer über Kritik der Kreativität herausgegeben von Gerald Raunig und Ulf Wuggenig
Archäologie des Hansaviertels
Christa Kamleithner über die Ausstellung, Tagung und Filmreihe die stadt von morgen
Stadtentwicklung lernen
Christian M. Peer über Intermediäre Organisation in der Stadtentwicklung von Sabine Gruber
Lilith und ihre Töchter
Susanne Karr über die Ausstellung Beste aller Frauen. Weibliche Dimensionen im Judentum im Jüdischen Museum Wien
Pragmatische Temporalität
Robert Temel über Urban Pioneers herausgegeben von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin
Kunst und List
Andre Krammer über Artful Transformation von Bettina Springer
Niederösterreich in Salzburg
Paul Rajakovics über die Ausstellung bau | kunst | öffentlicher raum der Initiative Architektur Salzburg
Transformation der Produktion
Sinkende Beschäftigtenzahlen, Auslagerung, Schließung oder Abzug der Produktionsstätten, das Ende des modernen Industriezeitalters, … solche und ähnliche Schlagworte prägen den Diskurs über das Verhältnis von Industrie und Stadt. Prognosen und Szenarien überschlagen sich in Superlativen um die wirtschaftlichen Veränderungen in den Industrieländern zu beschreiben. Industriestaaten sind sie jedoch immer noch. Eine Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts hat für Österreich im Betrachtungszeitraum 1995 bis 2003 sogar, wenn Industrie nach Wirtschaftskammersystematik definiert wird, eine Steigerung der industriellen Produktion festgestellt.[1] EUROSTAT konstatiert ebenfalls eine steigende Industrieproduktion in der Eurozone im Betrachtungszeitraum 2004 bis 2006.[2] Tendenziell ist in Westeuropa und der EU industrielle Produktion nicht rückläufig, sondern steigert ihre Produktivität, bei gleichzeitigem Beschäftigungsabbau. Die Industrie schrumpft also nicht,[3] sondern transformiert ihre Produktionsweisen auf dem globalen Markt. Eine Veränderung der Unternehmensstruktur als Reaktion auf den Wandel vom fordistischen zum post-fordistischen Wirtschaftssystem ist ablesbar. Es ist davon auszugehen, dass dieser Wechsel der ökonomischen Rahmenbedingungen nicht ruckartig und allumfassend vollzogen wird,[4] sondern Systeme nebeneinander bestehen und aufeinander Einfluss ausüben. Am Beispiel der Stahlindustrie kann die Umformung in global aufgestellte groß dimensionierte und dezentralisierte Konzerne festgestellt werden. Diese produzieren zwar noch immer lokal, aber differenzieren ihre internationalen Standorte nach Produkten. AcelorMittal lieferte zum Beispiel aus Differdange in Luxemburg diesen August 2007 die Stahl-Träger für das WTC Memorial in New York, obwohl Mittal-Steel auch in den USA stark präsent ist. Transportkosten werden geringer eingestuft als Zeitkosten. Eine De-Industrialisierung findet also nicht statt, eine Wandlung zur postindustriellen Informationsgesellschaft vielleicht, eine Veränderung der Relation von Produktion und Standort ist allerdings eindeutig erkennbar. Die alten – fordistischen - räumlich stabilen Verhältnisse zwischen Industrie und Stadt geraten in Bewegung.
Das Verhältnis von Stadt und Industrie
Das Zeitalter der Industrialisierung war auch eines der Urbanisierung. Technische Neuerungen ermöglichten die Verwertung von Bodenschätzen. Fabriken und Werke entstanden und forcierten die urbanen Entwicklungen der nahegelegenen Dörfer und Städte. Ein Beispiel dafür ist die SaarLorLux-Region[5], die aufgrund der Möglichkeit die Minette, ein „armes Erz“, mittels des Thomas-Verfahrens zu verarbeiten, Mitte des 19. Jahrhunderts einen Urbanisierungsschub erlebte. In Folge der großen Arbeitskräftenachfrage und des kapitalistischen Liberalismus wurden urbane Entwicklungen, wie der massive Wohnbau der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, an Industriestandorte und Industrieentwicklungen gebunden. Solche schubartigen urbanen Entwicklungen sind auch in Wien bis heute in den Gründerzeitvierteln sichtbar. Diese Bautätigkeit in Folge des massiven Wohnraumbedarfes war nicht mehr von sozialen Utopien der Modellsiedlungen des späten 19. Jahrhunderts, wie jener in Saltaire, Kronenberg oder die frühe Form der Familistere Godins, geprägt, die mehr vom Wohnen einer kleinen sozialen Gemeinschaft in einer ländlichen Idylle ausgingen. Die rasende Entwicklung der Produktionstechniken hat diese idealisierten und idealistischen Wohnformen der neuen industriellen Gesellschaft schnell überholt. Die Suche nach einer Antwort auf die Produktionsbedingungen in urbaner Dimension, wie die Vision einer Bandstadt für Wolgograd von Miljutin, war der nächste Schritt der Tradierung von industriellen Produktionsbedingungen und Anforderungen auf eine städtische Struktur.
Neben den baulichen Ansprüchen ergab sich auch eine ideelle Verbindung von urbanen Entwicklungen und industriellem Wachstum. Wie Berthold Hub in seinem Artikel in diesem Heft zeigt, haben auch Architekten wie Peter Behrens auf die ihn umgebenden sozialen Bedingungen wie auch auf die Anforderungen der Technik reagiert. Die Bauwirtschaft ist heute selbst Teil der Industrie, auch wenn sie nur saisonbereinigt in die Kennzahlen einfließt. Der Industriebau ist ein eigener hochspezialisierter Sektor in Architektur und Bauingenieurwesen. Der historisch stark geprägte Zusammenhang von industrieller und urbaner Entwicklung blieb in den Köpfen bestehen.
Das Erbe der Industrialisierung
Ein spezifisches räumliches Symptom einer Veränderung der Produktionsweisen und deren Produkte ist in ihrer Form und Größe oft sehr auffällig. Es überstrahlt den Diskurs über Prozesse, die weit über den realen Ort hinaus reichen: Die Transformation der Flächen der Stahl- und Kohleindustrie. Dies hängt nicht nur mit ihrer räumlichen Dimension zusammen. Stahl und Kohle ist die Gründungsindustrie der Europäischen Union, die aus der ursprünglichen Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl EGKS hervorgegangen ist. Der Anteil der im Sektor Metallerzeugung und –bearbeitung sowie Herstellung von Metallerzeugnissen Beschäftigten an der Zahl aller ArbeitnehmerInnen ist immer noch einer der größten. Besonders für die Gründungsmitglieder und deren Wirtschaftsgeschichte ist jede Änderung in diesem Sektor stark mit der eigenen Geschichte verbunden. Die IBA Emscher Park im Ruhrgebiet bildete in Deutschland den Anfang einer bis heute, zum Beispiel mit dem Teilbereich Ronneburg der Buga2007,[6] fortgesetzten Veränderung und Konversion alter Industriestandorte dieses Produktionsbereiches. Luxemburg, das seinen Reichtum auch dem Erzabbau und Stahl verdankt, ist ebenfalls stark an einem sensiblen Umgang mit der eigenen Regionalentwicklung im Süden des Landes und der eigenen Wirtschaftsgeschichte interessiert. Auch hier sind in der Südregion des Landes viele Projekte zur Entwicklung der aufgelassenen Werksgelände und Lagerflächen entwickelt worden. Konversionen, Musealisierungen, urbane Integrationen, Industrieparks, Erlebnisgelände, … ; die Bandbreite der angewandten Strategien ist groß, und fast so unterschiedlich wie die geographische Lage der Produktionsstätten war. Die Produktion bleibt in der Nachbarschaft so lange sie kann. Das erste und größte industrielle UNESCO Weltkulturerbe in Deutschland, die Völklinger Hütte, ist im Vergleich mit dem sie umgebenden, noch im Betrieb befindlichen, Werksgelände der Saarstahl ein kleines historisches Relikt.
Diese Herausforderungen, diesen Erbstücken der lokalen Produktionsstätten neue urbane Positionen zuzuweisen, reichen von problematischen städtischen Erweiterungen auf abgelegenen und von den bestehenden urbanen Strukturen abgetrennten Flächen, unwägbarem Risiko aufgrund der im Boden vorhandenen Kontaminierungen bis hin zur Gefahr einer romantischen Verklärung des Verfalls. Auf diese Vielfalt der Strategien und deren gesellschaftlichen Zusammenhang verweist Susanne Hauser in ihrem Beitrag.
Geänderte Rahmenbedingungen
Die Stadt hat mit ihrem Erbe der Industrialisierung zu arbeiten und verändert sich mit den neuen räumlichen Ansprüchen oder verlassenen Terrains des globalen Wirtschaftens. Dies geht über die offensichtlichen durch Produktionsverlagerung frei gewordenen Flächen hinaus. Sie sind jedoch die eindringlichsten Symptome einer Verlagerung der großformatigen, flächenverbrauchenden Produktion aus der Stadt in eine andere Region. Oder sie sind Folge der Entwicklung einer flächen- und ressourcenschonenderen Produktionsweise. Ist daher die moderne urbane Ökonomie ruraler, kleinteiliger, disperser und „sauberer“ geworden? Ist die globale Stadt ein global wirtschaftendes Dorf? Die Form des oben beschriebenen Überganges und Bruches hat einen starken Einfluss auf die Entwicklungsfähigkeit der Stadt-Umland-Region. Findet, so wie bei der ehemaligen DDR, ein – im Verhältnis zur westeuropäischen Wirtschaftsentwicklung – spontaner Wechsel der Rahmenbedingungen statt, hat dies nicht nur auf die Stellung der Industrie Auswirkungen. Wie Christoph Haller in seinem Beitrag zeigt, ist auch das individuelle Festhalten an der eigenen Geschichte und Entstehungsgeschichte der Stadt direkt mit der Veränderung konfrontiert. Auch soziale Gemeinschaften wie Gewerkschaften und über viele Dienstleister verbundene StadtbewohnerInnen, z.B. in den USA[7], die ihre Entstehung und Struktur in der fordistischen Industrieentwicklung erarbeitet haben, reagieren empfindlich auf das Verändern des Stellenwerts der industriellen Produktion ihrer Stadt. Die Beziehung Stadt – Industrie ist in Bewegung geraten. Das zeigt sich sehr deutlich in der Diskussion über die räumliche Stellung der Produktion, wie Mariusz Czepcyn´ski sie anhand der Entwicklung Danzigs nachweist.
Blickfelderweiterung
In einem Paper von Kathy Pain[8] werden die Erkenntnisse des Forschungsvorhabens POLYNET[9] der Universität Loughborough große Stadtregionen in Westeuropa (Randstad, Ruhrgebiet, …) betreffend mit den antizipierten globalen wirtschaftlichen Entwicklungen einer „Asianation“ kombiniert. Dies zeigt deutlich auf, dass bei einer globalen Betrachtung der wirtschaftlichen Entwicklungen und deren beweglichem Netzwerk die einzubeziehende räumliche Ausdehnung einer Untersuchung von urbanen Prozessen ebenfalls größer werden muss. Die in den Ländern des europäischen Raumes feststellbaren urbanen Entwicklungstendenzen entsprechen laut dieser Studie denen einer globalen Stadt, wie sie von Saskia Sassen schon 2001 beschrieben wurden: Globale Städte müssen mit dem Paradox einer Gleichzeitigkeit von Verdichtung und Streuung der Produktion umgehen können.
[ Erik Meinharter ist Redakteur von dérive, Mitarbeiter eines Planungsbüros und Lektor an der Universität für Bodenkultur. ]dérive, Di., 2007.10.23
[1] Struktur und Entwicklung der Industrie Österreichs (IWI-Studie 126, Schneider, Lengauer, Brunner), Industriewissenschaftl. Institut., 2006.
[2] STAT/07/7 EUROSTAT, Euro-Indikatoren Pressemitteilung vom 15.Januar 2007.
[3] Gemeint ist hier der Gesamtbereich der Industrie in der Definition nach EUROSTAT, wobei es in Teilbereichen trotzdem zu Schließungen kommen kann, wie z.B. in der Tabakindustrie. Der Abbau von Stellen hängt zumeist auch mehr mit der globalen Aufstellung der Firmen und der daraus folgenden Verteilung und Fokussierung der Produktion auf die verschiedenen Produktionsstätten – nach Ertrag, Lohnniveaus, vorhandenen Produktionsmitteln etc. – zusammen.
[4] Die Begriffe sind ja Umschreibungen von Wirtschaftssystemen und –zusammenhängen und nicht punktuell installierte und umgeschaltete Formen des Wirtschaftens.
[5] Umfasst die Regionen Saarland (D), Lorraine (F), Luxembourg (L).
[6] Einen Überblick der derzeitigen landschaftsarchitektonischen Projekte bietet die Ausgabe Juni 2007 der Zeitschrift Garten & Landschaft: „Nach Bergbau und Industrie“, Callwey Verlag
[7] Einblick in diese Thematik liefern die Arbeiten von Eric Boria, der an der Loyola University Chicago die Veränderung der Arbeit im Zusammenhang mit „Stahl-Städten“ erforscht. Z.B. „Some Notes on Fordism and the Industrial City“, der unter http://www2.cddc.vt.edu/digitalfordism/fordism_materials/boria.html (Stand 28.09.2007) zu finden ist.
[8] GaWC Research Bulletin 225 (A): The Urban Network Transformation: Planning City-Regions in the New Globalization Wave, der Globalization and Wold Cities – Study Group & Network: www.lboro.ac.uk/gawc (Stand 21.9.2007)
[9] siehe das INTERREG IIIB Projekt POLYNET (2006): Sustainable Management of European Polycentric Mega-City Regions, Hall and Pain, oder im Buch: The Polycentric Metropolis – Learning from Mega-City Regions in Europe, Hall Peter, Pain Kathryn. (Hrsg.), Earthscan Publications. Ltd, London 2006ABFRAGEN: EU Daten Prodcom PRODCOM Produktionsstatistiken letzte Daten 21.09.2007 von 2006.
23. Oktober 2007 Erik Meinharter
Der Abriss des Star Ferry Piers
(SUBTITLE) Stadterneuerung und Bewahrung lokaler Kultur in Hong Kong
Die rein ökonomisch ausgerichtete Stadtentwicklung in Hong Kong, die generell die Entwicklung lukrativer Immobilien favorisiert, ist zunehmend mit dem kulturellen Erbe und mit der lokalen Kultur (im Allgemeinen) im Konflikt. Der Abriss des Star Ferry Piers (eigentlich Edinburgh Place Ferry Pier) im Dezember 2006 hat nicht nur einen großen Aufschrei bei lokalen AktivistInnen ausgelöst, sondern ganz generell zu einer Diskussion über das mangelnde politische Bewusstsein für die Bewahrung des kulturellen Erbes in der Stadtplanung und -entwicklung geführt. Das manifestiert sich speziell in der kurzsichtigen, profitorientierten Einstellung de Regierung ebenso wie in der Gleichgültigkeit gegenüber dem Interesse der BürgerInnen von Hong Kong an ihrem kulturellen Erbe.
Dieser Essay nimmt den Abriss des Star Ferry Piers als Ausgangspunkt, um die aktuellen problematischen Stadtentwicklungsprogramme in Hong Kong und deren zersetzende Auswirkungen auf die lokale Kultur und die kollektiven Erinnerungen zu diskutieren. Neben dem Hinweis auf „provokative“ Reaktionen und Proteste wird eine Serie von künstlerischen Aktionen im öffentlichen Raum, die sich als alternative Stellungnahme zu den Regierungsbeschlüssen verstanden, im Vordergrund stehen.
Eine Anlegestelle für Fährschiffe?
Warum sich darum kümmern?
Konfrontiert mit der Notwendigkeit, eine zentrale Figur in der Liga der Weltstädte zu werden, erfinden sich Großstädte weltweit, vor allem postindustrielle und asiatische Städte, ständig neu, um sich dem internationalen Umfeld und dessen Veränderungen anzupassen. Im Gegensatz zu ihren europäischen Kontrahentinnen, deren städtebaulicher Fokus eher auf Regeneration anstatt auf Neuentwicklung liegt, hat Planung in asiatischen Städten, inklusive Hong Kong, einen weit radikaleren Ansatz: Alte Gebäude und Viertel werden einfach über Nacht abgerissen; historische Stadtviertel weichen Einkaufszentren; sogar eine völlig neue Stadtlandschaft kann ohne Rücksicht auf Bestehendes entworfen werden, wenn aufsehenerregende Projekte geplant sind, die mit den lokalen oder internationalen Mitbewerberinnen konkurrieren können.
Die Zerstörung und das Verschwinden des kulturellen Erbes ist für Hong Kong also nichts Neues. Sogar die Hutongs, das enge Gassenwerk, das seit der Ming-Dynastie das Zentrum von Peking umgibt, wurden ohne besondere Emotionen teilweise abgerissen. Warum verdient der Abriss einer Anlegestelle für Fährschiffe mitsamt ihrem Turm unsere Aufmerksamkeit?
Bevor die Briten Hong Kong übernommen haben und es zu einem Zentrum der Finanzwelt entwickelten, war Hong Kong bloß eine Ansammlung kleiner Dörfer mit wahrnehmbarer, traditioneller (Volks-)Kultur. Mit einer (Kolonial-)Geschichte von nur 155 Jahren hat die Region keine Orte von nationaler oder historischer Bedeutung, die in die ausschließlich auf nationaler Ebene operierende UNESCO-Liste für kulturelles Erbe passen würden.[1] In Hong Kong hat die Bewahrung des kulturellen Erbes viel mehr mit dem Erhalt der Alltagskultur und den kollektiven Erinnerungen zu tun. Der Star Ferry Pier mit seinem Turm, der 1958 errichtet wurde und eines der wenigen verbliebenen öffentlichen Gebäude der Streamline-Moderne in Hong Kong war, trug einen Teil der Geschichte Hong Kongs, seiner ausgeprägten Alltagskultur, speziell der lokalen Lebenswelt, und der kollektiven Erinnerung von Millionen BürgerInnen Hong Kongs. Vor allem weil es der Ort war, an dem 1966 drei Nächte dauernde Proteste gegen die Regierung statt fanden, die von der Entscheidung der britischen Kolonialverwaltung, den Fährtarif um 25 Prozent zu erhöhen, ausgelöst wurden.
Hong Kongs kulturelle Identität
Die Suche nach Hong Kongs Identität war bereits lange vor der Übergabe an China im Jahr 1997 ein schwieriges und komplexes Thema. Obwohl Hong Kong ein „postkolonialer“ Raum ist, passt es in keine der konventionellen Definitionen von „postkolonial“, weil es weder vor der britischen Herrschaft ein unabhängiger Nationalstaat war noch nach der Übergabe unabhängig wurde. Heute ist es eine selbstverwaltete Region, jedoch auf chinesischem Hoheitsgebiet gelegen und China zugehörig. Regiert wird Hong Kong nach der Formel „ein Land, zwei Systeme“ und „Hong Kong’s people governing Hong Kong“. Deshalb ist Hong Kongs Kampf mit seiner kulturellen Identität und die Notwendigkeit, sich auf der internationalen Bühne zu positionieren und zu repräsentieren, eine ideologisch fürwahr herausfordernde Aufgabe und in seiner gegenwärtigen Praxis sehr widersprüchlich. Das Thema der Bewahrung des kulturellen Erbes in Hongkong findet deshalb im Unterschied zu sonstigen asiatischen Städten auf einer zusätzlichen Bedeutungsebene statt und bedarf einer weit intensiveren Untersuchung.
Die Landgewinnung am Victoria Harbour
Der Victoria Harbour, der buchstäblich der Ursprung Hong Kongs ist und der Grund, weshalb die Stadt prosperiert, wurde Sanierungsphasen unterzogen, seit die Regierung in den 1990er Jahren das Central and Wan Chai Reclamation-Projekt gestartet hat. Entlang beider Seiten des Ufers befinden sich die zentralen Geschäftsviertel – ein Umstand, der das Projekt vorantreibt. Dort befinden sich die teuersten Grundstücke – der Stadt und weltweit.
Die dritte Phase des Central Reclamation-Projekts schloss die Gewinnung von insgesamt16 Hektar Land entlang des Hafens ein: für eine Station des Flughafenexpresses, den westlichen Abschnitt der projektierten North Island Line, die Überbrückung von Central-Wan Chai, neue Star Ferry Piers, neue Straßen und weitere Geschäftsflächen mit geschätzten Kosten von rund 330.000 Euro . Mit der Verabschiedung des Antrags im Jahr 2002 war das Schicksal des Star Ferry Pier (im Dezember 2006 abgerissen) und des Queen´s Pier (im April 2007 für den Abriss geschlossen) besiegelt.
Es war nicht das erste Mal, dass ein Ferry Pier wegen eines Landgewinnungsprojekts geschlossen wurde. Blake´s Pier wurde in den frühen 1990er Jahren abgerissen, um für die erste Phase des Central Reclamation-Projekts Platz zu machen.[2] Der Antrag für die dritte Phase der Reclamation und die Entscheidung, die Piers abzureißen, haben heftige öffentliche Reaktionen und Proteste der lokalen Bevölkerung ausgelöst.
Öffentliche Reaktionen
Am letzten Betriebstag, dem 11. November 2006, kamen 15.000 BesucherInnen, um einen letzten Blick auf den Pier zu werfen und eine letzte Fahrt zu machen.[3] Vor dem Abriss riefen mehrere politische Parteien und Bürgerinitiativen die Öffentlichkeit auf, für den Erhalt des Piers zu kämpfen: AktivistInnen starteten öffentlichkeitswirksame Proteste; In-Media, ein von AktivistInnen betriebenes Online-Magazin, unterstützte das Anliegen auf seiner Website; das SEE-Network (Society, Environment, Economy), das Kampagnen für die Bewahrung von lokalen Kulturen und eine nachhaltige Stadtentwicklung in Hong Kong betreibt, organisierte Aktivitäten, um das Thema einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln; und auf Initiative des Pädagogen und Künstlers Kith Tsang besetzte eine Gruppe junger Leute öffentlichen Raum in der Nähe des Piers und inszenierte künstlerische Performances als Antwort auf die Entscheidung der Regierung.
Kunst-Aktionen im öffentlichen Raum
Kunst im öffentlichen Raum wird in Hong Kong selten angewandt, besonders wenn es darum geht, soziale und politische Anliegen zu vermitteln. Diese von Tsang initiierte Serie der künstlerischen Interventionen war die erste ihrer Art in Hong Kongs Kunstszene. Die Gruppe von KünstlerInnen trat – beginnend im August 2006 bis nach dem Abriss – ohne Unterbrechung jeden Sonntag von drei bis fünf Uhr am Nachmittag auf. Unter den ProtagonistInnen waren u. a. der Performance-Künstler Leung Po Shan und eine Gruppe junger KünstlerInnen, die ursprünglich TeilnehmerInnen des von Kith Tsang geleiteten Sommer-Workshops Kunst im öffentlichen Raum waren. Die Aktionen hatten das Ziel, eine breitere Öffentlichkeit auf den Abriss aufmerksam zu machen und einer jüngeren Generation das Konzept des öffentlichen Raums zu vermitteln.
Tsang versteht Kunst im öffentlichen Raum als eine ausdrucksstarke und effektive Möglichkeit, zu den Geschehnissen in der Stadt Stellung zu nehmen, speziell für diejenigen, die keine Möglichkeit haben, ihre Meinung via Massenmedien zu verbreiten. Tsang wies darauf hin, dass die Regierung sehr ausgeklügelte Methoden anwandte, um den Central Reclamation-Plan voranzutreiben, öffentliche Partizipation zu verhindern und das Recht der Teilnahme am städtischen Planungsprozess zu negieren.
Tsang, selbst Aktivist, glaubt, dass die Bewahrung der Kultur nicht nur mit der Infrastruktur, sondern mit dem Leben selbst zu tun hat. Die Regierung sollte dieses Anliegen fördern und zu einer positiven Lebensqualität der Bevölkerung beitragen. Das Entwicklungsmodell für die Stadterneuerung, das in Hong Kong angewendet wird, neigt zur Zerstörung von sozialen Netzwerken, speziell denjenigen von älteren Menschen. Eine Methode, Menschen umzusiedeln, die die Stadtregierung anwendet, besteht darin, diese nach den Marktpreisen ihres Eigentums zu entschädigen. Das ist für SeniorInnen, die in älteren Gebäuden leben, die in den letzten Jahrzehnten nicht renoviert wurden und deswegen einen niedrigen Marktpreis haben, eine große Benachteiligung.
Die Abrissbirne schafft freie Flächen für Developer
Der Star Ferry Pier ist nur einer von vielen Orten, die einen wichtigen Teil lokaler Kultur verkörpern und bereits abgerissen wurden. Die Lee Tung Street (wird gerade neu entwickelt) – wird bei der lokalen Bevölkerung auch Wedding Card Street genannt, weil sie für das Drucken und Verkaufen von Hochzeits- und Visitenkarten sowie Kalendern bekannt ist. Das Viertel wurde für neue Wohntürme und Shopping-Malls abgerissen. Eine Bürgerinitiative kämpfte drei Jahre lang gegen die Zerstörung. Der Queen´s Pier (im April 2007 für den Abriss geschlossen) ist der zweite Pier, der in Hong Kong gebaut wurde. Er wurde in den Jahren 1953/54 für Zeremonien und öffentliche Anlässe errichtet. Er war Landungsbrücke für die An- und Abreise vieler früherer Hong Konger Gouverneure sowie einheimischer und von außerhalb kommender prominenter Würdenträger und Persönlichkeiten.[4] AktivistInnen, DenkmalschützerInnen und Bürgerinitiativen führen seit einigen Monaten eine Kampagne in Form von Sitzblockaden, Protesten und Hungerstreiks, um den Queen´s Pier zu retten. Der Wan Chai Market (die Zerstörung ist für Anfang 2008 geplant) – wurde 1937 gebaut und ist einer der letzten Märkte mit Streamline-Moderne-Architektur. Am Gelände wird ein luxuriöser Wohn- und Geschäfts-Komplex entwickelt.[5] Die Central Police Station (Betrieb wurde im Dezember 2005 eingestellt) und Victoria Prison sind benachbarte Gebäude und gehören zu den declared monuments[6] Hong Kongs. Es sind zwei der wenigen noch existierenden kolonialen Zeitzeugen. Der älteste Teil der Polizeistation wurde 1864 errichtet. ImmobilienentwicklerInnen haben ihr Auge auf diese nun funktionslosen Gebäude geworfen.
Wie geht es weiter?
Während die Regierung wertvolle Plätze Hong Kongs, die über Jahrzehnte Teil der Alltagskultur waren, niedergewalzt hat, investiert sie riesige Summen in ein neues „kulturelles Erbe“ für die lukrative Tourismus-Industrie. Eines der Hauptprojekte in diesem Zusammenhang ist Ngong Ping 360, das aus der Ngong Ping Skyrail und dem Ngong Ping Village besteht. Ngong Ping Skyrail ist eine 5,7 km lange (derzeit wegen mehrerer Unfälle stillgelegte) Seilbahn, die Ngong Ping auf der Insel Lantau, auf der der gigantische Tin Tan Buddha steht und das Po Lin Kloster liegt, mit Tung Chung, einem Gebiet nahe dem Flughafen von Hong Kong, verbindet. Das Ngong Ping Village wurde in der Nähe der Seilbahnstation im Design traditioneller chinesischer Architektur gebaut und ist mit kulturellen Attraktionen chinesischen Ursprungs und Shops internationaler Ketten ausgestattet.
Auf der Suche nach einem neuen Image nach der britischen Herrschaft, speziell für die finanzstarke Tourismus-Industrie, entschied die Tourismusbehörde 2001, Hong Kong als „Asia´s World City“ neu zu erfinden. Sie hat unversehens – einer stereotypen Mode folgend – entschieden, Hong Kongs Wurzeln in der chinesischen Kultur und ihrem Erbe auszubeuten. Hong Kong Disneyland, Ngong Ping 360 und weitere touristische Sehenswürdigkeiten (wie z. B. eine Bruce-Lee-Statue auf der Avenue of Stars) am Ufer des schrumpfenden Victoria Harbours zeigen, dass das Hauptziel der Regierung die Generierung von Einkünften ist; der lokale kulturelle Kontext und die Lebensqualität bleiben unberücksichtigt.
Die problematische Stadterneuerung geht Hand in Hand mit einer ungeschickten Image-Strategie: Shopping-Malls schießen nach wie vor wie Pilze aus dem Boden, obwohl es wenig Platz gibt und kaum echter Bedarf dafür besteht; weitere „spektakuläre“ Erlebnisse für TouristInnen werden geplant und endlose klischeehafte kulturelle Repräsentationen ständig entwickelt. Ohne echtes Verständnis und Respekt für seine lokale Kultur wird die Regierung von Hong Kong auf lange Sicht höchstwahrscheinlich einen weiteren charakterlosen Ballungsraum schaffen, der seinen Platz neben einer Reihe vieler anderer chinesischer Städte einnimmt und seine Ambition, „Asia´s World City“ zu werden, ziemlich sicher verfehlen wird.
[ Hilary Tsui arbeitet als unabhängige Kulturschaffende, Kuratorin und Autorin in Wien. Sie ist Gründerin und Programmdirektorin von city transit Asia-Europe (www.city-transit.org). ]dérive, Di., 2007.10.23
[1] siehe die Artikel der Konvention: UNESCO World Heritage Convention, verabschiedet 1972: http://www.whc.unesco.org/?cid=175
[2] Wallis, Keith (2000): Harbour reclamation plans gathering pace. In: The Standard, 31.7.2000
[3] South China Morning Post, 17.12.2006
[4] Cha Sui-San, Peter (2001): A survey report of Historical Buildings and Structures within the Project Area of the Central Reclamation Phase III, February 2001: A Historical and Architectural Appraisal of Queen’s Pier, Central (Annex B, P.3). Im Auftrag der Regierung von Hong Kong, EIA (Environmental Impact Assessment).
[5] So, Una & Tong, Stephanie (2004): Hopes Raised for Historic Market. In: The Standard, 4. August 2007 (http://www.thestandard.com.hk/news_detail.asp?pp_cat=2&art_id=50548&sid=14791822&con_type=1&d_str=20070804&sear_year=2007).
[6] siehe Declared Monuments in Hong Kong, http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Monument/en/monuments_53.php (siehe auch: http://en.wikipedia.org/wiki/Declared_monuments_of_Hong_Kong)
23. Oktober 2007 Hilary Tsui
Turn Terror into Sport
(SUBTITLE) Eine Intervention des theatercombinats
„massensteppchoreografie samstag 15.9. / wir laden Euch herzlich ein zu / turn terror into sport / 100 wiener bürgerinnen und bürger intervenieren mit einer massenchoreografie / auf dem maria-theresien-platz am 15. september um 18h30 in wien / zwischen dem heldenplatz, dem ort politischer versammlungen, und dem museumsquartier als ort massenhaften kulturellen konsums, entsteht eine massive rhythmische intervention in die stadt. / eine koproduktion von tanzquartier wien und theatercombinat.“
Auf dem Platz rund um das Wiener Maria-Theresien-Denkmal befanden sich zur angegebenen Zeit um einiges mehr an Menschen als gewöhnlich. Weitere Indizien für eine bevorstehende Aufführung gab es jedoch keine. Doch: Jugendliche in bedruckten T-Shirts verteilten ein Programm. Kein eindeutiger Ort innerhalb dieses Raums, ein erst allmählich wahrnehmbarer Beginn: zwischen der Menge der ZuschauerInnen aufgestellte AkteurInnen, Klappern der eisenbeschlagenen Schuhe der StepperInnen. Die ZuschauerInnen konnten keinerlei Ahnung haben, wo und wohin sich die Aktion im Raum entwickeln würde. Erhöhte Spannung, wenn AkteurInnen ganz nah kamen, oder knapp einen Weg durch die Menge suchten, zu einer anderen Zusammenballung, rund um das Denkmal herum.
Die Trennung zwischen AkteurInnen und Publikum war auch insofern aufgehoben, als sich jedeR zum Mitmachen hatte anmelden können und dafür einen Gratiskurs in Stepptanz bekam. AkteurInnen wie Publikum in derselben street-ware, anfangs nicht zu unterscheiden. Die SprecherInnen meist unsichtbar, in der Menge oder gerade auf der anderen Seite des Denkmals. Kein eindeutiger Stil der Step-Performance: Härter, sanfter, nicht eindeutig decodierbare Gesten, zwischen Musical, Volksaufstand, Militärparade oder Gymnastikübung.
Minimalismus der Texte, Zurückhaltung der äußeren Aktion: So kommt es zu einem Pendeln zwischen Konzentration und Zerstreuung, Aufbau und permanenter Dekonstruktion von Aura, Destruktion der Nicht-Erwartungen. Ein flirrender Zustand, zwischen seine Freunde von Ferne grüßen, von der Gewalt der Shakespeare-antiken Worte aufgeschreckt sein, dann wieder Suche, wo das Zentrum der Aktion sich räumlich fortsetzen würde. Scannen und Decodieren der heterogenen Informationen, der Körper und der Bedeutungen. Dazwischen kleine Ratlosigkeit, Verlorenheit in der Menge, zart anklopfende Langeweile, Zurückgeworfen-Sein auf sich selbst.
Eine Sequenz von laufend notwendigen Orts-Entscheidungen der einzelnen ZuschauerIn: bleibe ich hier stehen, versuche ich zu folgen, nehme ich die vermutete Richtung der Bewegung vorweg und gehe voraus … und muss mich dabei – wie auch die AkteurInnen – durch die „Massen“ drängen? Oder stell ich mich auf das Podest des Denkmals, um „mehr sehen“ zu können? turn terror into sport als Vorweg-Auskopplung von Coriolan; turn terror into sport – jene unglaubliche Wendung im Original des Coriolan (1607!), einer Tragödie von Shakespeare, die im 4. Jahrhundert vor Christus im Übergang von der Patrizier- zur Plebejerherrschaft spielt. Beginn der römischen Republik. Die ZuschauerInnen als Mitgestalter eines Raum-Körpers. ZuschauerInnen beobachten ZuschauerInnen und damit sich selbst, und welche Position jedeR einzelne auf diesem Platz und zu den wechselnden Zentren der Aktion einnimmt: Verharren, wieder den StepperInnen nachgehen, zusammenzucken, wenn der Text skandiert wird.
Ein Bürger: Seid Ihr alle entschlossen, lieber zu sterben als weiter zu hungern?
Alle: Entschlossen, entschlossen.
Ein Bürger: Ihr wisst, dass Gaius Martius der Hauptfeind des Volkes ist?
Alle: Das wissen wir, das wissen wir!
Ein Bürger: Töten wir ihn, dann erhalten wir Korn zu unserem eigenen Preis. Ist das ein Urteil?
Alle: Hören wir auf, kein Reden mehr darüber; lasst es uns tun. Los, Los!
(…)
Sicinius: Was ist die Stadt wenn nicht das Volk?
Alle: Richtig. Das Volk ist die Stadt.
Wenige betreiben so radikal die „Bespielung“ öffentlicher Räume, wie Claudia Bosses theatercombinat. Schlachthof (massakermykene; 1999/2000), Donaucity (palais donaustadt, 2005), U-Bahn-Stollen unter der Mariahilferstraße (die perser; 2006) und nunmehr bevorstehend im Betriebsbahnhof Breitensee: Coriolan (Oktober 2007).
Im Zentrum des theatercombinats stehen unter anderem: rhythmische Sprach- und Körperarbeit, strukturierte Improvisation, Musikalisierung der Sprache, und über allem seit 2004 das Thema „Raumforschung“. Und für die meisten Produktionen gilt: In die architektonischen Strukturen wird nicht eingegriffen, sondern über den Widerstand mit ihnen gearbeitet. Es gibt weder Zuschauerraum noch Bühne. Der Raum ist Gesamterfahrungsraum für Zuschauer und Spieler. Die Proben sind öffentlich. Für jede Veröffentlichung werden neue Versuchsanordnungen erstellt, so Bosse.
„he stopp‘d the fliers and by his rare example made the coward turn terror into sport: ein satz aus shakespeares tragödie Coriolan, in der fortwährend interessen, ordnungen, regeln, rhetoriken, glieder, staats- und körperbilder aneinanderschlagen. stadt – straße – forum – capitol – lager – schlachtfeld. patrizier, plebejer, volksvertreter, senatoren; soldaten, offiziere, helden.“ (Aus dem Programm)
Coriolan ist der zweite Teil der Serie Tragödienproduzenten von theatercombinat und hat am 17. Oktober 2007 um 20 Uhr Premiere in thepalace, Betriebsbahnhof Breitensee, U3 Hütteldorferstraße. Es folgen Aufführungen am 20., 24., 27., 31. Oktober und am 3., 7. und 14. November. Tragödienproduzenten ist ein Projekt unter der Leitung von Claudia Bosse in Zusammenarbeit mit Gerald Singer, Christine Standfest, Doris Uhlich, Lena Wicke und Gästen.dérive, Di., 2007.10.23
23. Oktober 2007 Rudolf Kohoutek