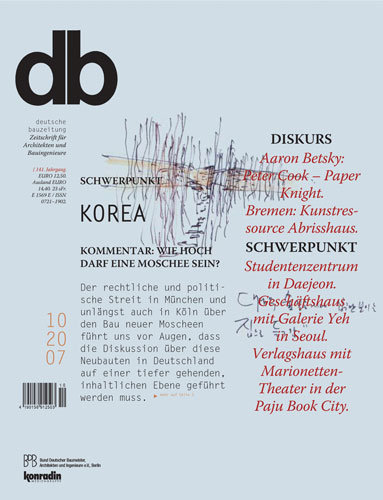Editorial
Abseits des Baubooms in China ist auch in Südkorea eine neue Zeit der Architektur angebrochen. Unser Autor Mathias Remmele war vor Ort und hat eine Fülle von Eindrücken, Geschichten, Erkenntnissen und Projekten mitgebracht. Unter Berücksichtigung verschiedener Bauaufgaben gewährt das vorliegende Heft einen Einblick in das noch relativ unbekannte »Architekturland« Korea und dokumentiert bemerkenswerte Positionen einer jungen Architektengeneration und einer Gesellschaft im Aufbruch. elp/uk
Inhalt
Diskurs
03 Kommentar
Wie hoch darf eine Moschee sein? | Cengiz Dicleli
06 Magazin
12 On European Architecture Peter Cook – Paper Knight | Aaron Betsky
Im Blickpunkt
14 Bremen-Tenever:Abrisshaus als Kunstressource | Kai-Uwe Scholz
Schwerpunkt
18 Korea
19 Zum Thema – Zeitgenössische Architektur in Südkorea | Mathias Remmele
22 Studentenzentrum in Daejeon von Seung H-Sang | Pai Hyungmin
30 Geschäftshaus mit Galerie Yeh in Seoul von Unsangdong Architects Cooperation | Mathias Remmele
36 Verlagshaus mit Marionetten-Theater sowie ein Wohnhaus von Suh Hailim | Till Wöhler
44 Ein Wohnhaus und ein Geschäftsgebäude von Cho Byoungsoo | Lim Jinyoung
52 Verlagshaus Taehaksa in der Paju Book City von Choi Moon Gyu | Pai Hyungmin
60 Ausstellungsgebäude einer Wohnungsbaugesellschaft in Busan von Cho Minsuk | Mathias Remmele
69 Ausländische Architekten in Korea | Mathias Remmele
72 Forschungsprojekt zur sanierung koreanischer Geschosswohnungsbauten | Jürgen Volkwein, Karl-Heinz Petzinka
Empfehlungen
76 Kalender
76 Ausstellungen
50 Jahre Interbau 1957 (Berlin) | Bernd Hettlage
77 Asmara – Afrikas heimliche Hauptstadt der Moderne (Stuttgart) | uk
78 Neu in …
Frankfurt/Main | Brita Köhler
Meißen | Hartmut Möller
Zürich (CH) | Christian Holl
80 Bücher
Trends
Energie
82 Nachgefragt: Meinungen zur neuen EnEV | Klaus Lambrecht, Wolfgang Ornth, Armin D. Rogall
Technik spezial
84 BMW Welt in München | Christoph Randl
Produkte
Produktberichte
96 Türen, Tore, Trennwände, Schließanlagen | rm
116 Schaufenster
Beschläge, Türantriebe | rm
Anhang
118 Planer / Autoren
119 Bildnachweis
120 Vorschau / Impressum
Fassadenraum
Das Büro Unsangdong Architekten wurde im Jahr 2001 von Jang Yoon Gyoo und Shin Chang Hoon gegründet. Unter den in diesem Heft vorgestellten Architekten sind sie die einzigen, die Korea weder zum Studium, noch zu einem beruflichen Engagement verlassen haben. Dennoch begreifen sie sich, wie ihre stets konzeptgeleiteten Projekte zeigen, als Teil der internationalen Architektur-Avantgarde. Außer durch ihre Bauten haben sie sich auch als Ausstellungsdesigner, Architekturtheoretiker und Galeristen hervorgetan.
Am Südufer des gewaltigen Han-Flusses, der Seoul in zwei ungleiche Hälften teilt, liegt der Stadtteil Gangnam-Gu – heute das wichtigste Geschäftzentrum der koreanischen Mega-Metropole. Während entlang der breiten Hauptstraßen Bürohochhäuser, riesige Hotelkästen und Kaufhäuser das Bild des Viertels prägen, haben sich in den engen, heterogen bebauten Seitenstraßen oft schicke Boutiquen, Möbelgeschäfte, Galerien, Restaurants, Kaffeehäuser und (Karaoke-)Bars angesiedelt. Auch als Wohngegend ist dieses Viertel aufgrund seiner zentralen Lage sehr beliebt – und entsprechend teuer. Inmitten eines der eng bebauten Stadtquartiere von Gangnam-Gu erhebt sich, seine unmittelbaren Nachbarn deutlich überragend, ein siebenstöckiges Gebäude, dessen skulptural und gleichzeitig rätselhaft anmutende äußere Erscheinung die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Seine Hauptfassade präsentiert sich als Abfolge von fünf unregelmäßig geformten, vertikalen Sichtbetonstreifen, die durch schmale Schlitze voneinander getrennt sind. Bald lotrecht verlaufend, bald stumpfkantig vor- und zurückschwingend verleihen diese Streifen der Fassade trotz ihrer augenscheinlichen Schwere und Massivität eine eigentümliche Dynamik. Was sich hinter diesem geschlitzten und in Bewegung geratenen Betonteppich verbirgt und was er überhaupt soll, bleibt zunächst im wortwörtlichen Sinn im Dunkeln. Erst wenn man sich dem Gebäude von seinen Schmalseiten her nähert, erkennt man, dass die Fassadenstreifen dem eigentlichen Baukörper vorgelagert sind und sich dazwischen ein schmaler, kaminartiger Raum entfaltet. Dann dauert es nicht mehr lange und man entdeckt die großen Lettern »Yeh Gallery« und realisiert, dass die Hauptnutzerin dieses Gebäudes eine Kunstgalerie ist – ein möglicher Erklärungsansatz für die ungewöhnliche raumhaltige Fassade.
Das Konzept einer »Verräumlichung der Haut« ...
Unsangdong Architekten entwarfen dieses 2006 fertiggestellte Geschäftshaus im Auftrag der Galerie Yeh, die darin zwei Geschosse bezogen hat. Für die Entwurfsgenese war der Kunstbezug von daher ein naheliegender Ausgangspunkt. Dies gilt umso mehr, als die Architekten selbst in ihrer Arbeit immer wieder eine außergewöhnlich enge Beziehung zur zeitgenössischen Kunst suchen. Seit 2003 betreiben sie die auf experimentelle und konzeptionelle Kunst spezialisierte Galerie JungMiSo, mit der sie die Grenzbereiche zwischen verschiedenen Sparten der künstlerischen Gestaltung ausloten möchten.
Als eine Art »städtische Leinwand« (urban canvas), als aufsehenerregende, riesige Projektionsfläche und als experimentelles Kunstwerk wollen sie die Fassade der Yeh Gallery verstanden wissen. Ihr liegt ein reichlich komplexes und nicht in allen Teilen leicht nachvollziehbares Konzept zugrunde, das Unsangdong Architekten als »Verräumlichung der Haut« (Spatialization of Skin) bezeichnen. Die Formel, nach der sie den Entwurf in einem aufwändigen Prozess generierten, hieß entsprechend »Haut plus Struktur«, »Haut plus Raum« und »Haut plus Programm«. Als wichtigstes formales Motiv diente ihnen die Faltung. Das Ziel, das sie erreichen wollten, war kein geringeres als eine »neue Generation von Raum« zu kreieren.
... und seine Umsetzung
Wie die räumliche und funktionale Aufladung der Haut gelang. Dies offenbart ein genauerer Blick in die Zone hinter den Fassadenstreifen. Sie präsentiert sich über weite Strecken als schmaler, hoher Hohlraum, der da und dort von Doppel-T-Trägern oder von stegartigen, mit einem Geländer abgesicherten Austritten durchbrochen wird. Hinter einem der Fassadenstreifen aber tut sich etwas anderes: Hier sieht es aus, als habe sich das Innere des Hauses quasi in den Hohlraum hineingestülpt. Die erkerartigen Räume, die dadurch auf jedem Stockwerk entstehen – sie liegen genau dort, wo im eigentlichen Baukörper das Treppenhaus verläuft – sind an ihren äußeren Ecken jeweils verglast. Auf diese Weise bietet sich von hier aus ein Blick in den Hohlraum und, durch die schmalen Schlitze zwischen den Fassadenstreifen, auf die Umgebung. Ein stärkeres räumliches Erlebnis bieten die stegartigen Austritte, von denen es vom zweiten Obergeschoss an aufwärts pro Etage jeweils zwei gibt. Über die Aufenthaltsqualität im Fassaden(zwischen)raum mag man geteilter Meinung sein. Bei einem Besuch des Gebäudes gewinnt man den Eindruck, als würde er weniger intensiv und weniger fantasievoll genutzt als von den Architekten ursprünglich konzipiert und erhofft – nämlich vor allem für kurze Zigarettenpausen. So ungewöhnlich und bisweilen spektakulär die Ausblicke sein mögen, die sich von hier aus ergeben, insgesamt wirkt die innere Fassadenzone eben doch zu düster und zu beengt, als dass man sich auf Dauer dort wohlfühlen würde. Der ästhetischen Wirkung von Unsangdongs Raum-Fassaden-Erfindung tut das freilich keinen Abbruch. Wer immer das Gebäude betreten möchte, muss jene merkwürdige Zwischenzone passieren, in welcher der Blick, unwillkürlich einer kaminartigen Sogwirkung folgend, nach oben abgelenkt wird in eine Sphäre, die unsere räumliche Erfahrung herausfordert und unsere Vorstellung von dem, was eine Fassade ist, in Frage stellt.
Weit weniger spektakulär als der Fassadenbereich präsentiert sich das Innenleben des Gebäudes. Erdgeschoss und erstes Obergeschoss beherbergen die Kunstgalerie der Bauherrin. Die Ausstellungsräume sind deutlich höher als die übrigen Nutzgeschosse und durch eine interne Treppe miteinander verbunden. Der Innenausbau erscheint denkbar nüchtern: Betonboden, weiße Putzwände und eine von Unterzügen strukturierte Sichtbetondecke unter der direkt sichtbar die Klimainstallationen verlaufen. Aufmerksamkeit erregt hier einzig die über beide Galeriegeschosse reichende »schwebende« Sichtbetonwand, hinter der sich die in den oberen Ausstellungsraum führende Treppe verbirgt.
Die Räume im zweiten bis fünften Obergeschoss, die wahlweise als Büro oder als Laden genutzt werden können, sind um den fassadenseitig situierten Erschließungs- und Versorgungskern herum organisiert. Die Nutzfläche nimmt hier entsprechend der sich nach oben hin zuspitzenden Gebäudeform von Stockwerk zu Stockwerk langsam ab. Ein eindrückliches Raumerlebnis bietet erst wieder das Dachgeschoss mit seinen überhohen Decken und dem weiten Blick über die Stadtlandschaft.
Zu den chronischen Problemen einer auf elaborierten Konzepten basierenden Architektur gehört es, dass die gebaute Realität den theoretisch und plangrafisch formulierten Idealen nur selten entspricht. Zu den Vorzügen der konzeptgeleiteten Architektur gehört es, dass ihr auf zahlreichen Ebenen ein großes Innovationspotenzial innewohnt, das dazu angetan ist, die Entwicklung der Baukunst voranzubringen. Die Yeh Gallery von Unsangdong Architekten darf als Beispiel für beide Fälle gelten. Man mag bezweifeln, dass hier eine »neue Generation von Raum« geschaffen wurde, aber man kommt nicht umhin festzustellen, dass hier eine neuartige und spannende Fassade mit räumlicher Tiefenwirkung entstanden ist, die eine große ästhetische Anziehungskraft entfaltet. Und das ist doch schon verdammt viel.db, Di., 2007.10.02
02. Oktober 2007 Mathias Remmele
verknüpfte Bauwerke
Geschäftshaus mit Galerie Yeh
Die Schönheit des Ursprünglichen
(SUBTITLE) Ein Wohnhaus auf dem Land und ein Geschäftsgebäude
Cho Byoungsoo studierte in den USA, wo er auch über viele Jahre als Hochschullehrer tätig war. Trotz seines kosmopolitischen Hintergrundes ist er einer der koreanischen Architekten, die sich in ihrer Arbeit sehr stark mit spezifisch koreanischen Traditionen der Gestaltung beschäftigen. Sein Werk ist als Versuch einer Synthese aus westlicher Moderne und orientalisch geprägter Material- und Raumerfahrung lesbar.
Den besonderen Charakter einer Kultur über die Aura eines für sie typischen Artefaktes verdeutlichen zu wollen, mag ein ungewöhnlicher Ansatz sein, trotzdem möchte ich diesen Essay über die Architektur Cho Byoungsoos mit dem »Sabal« beginnen, einer schlichten Reis- und Suppenschale, wie sie in Korea während der Choseon-Dynastie (1392–1910) verbreitet war. Ein Sabal ist weder so kunstvoll und zart, wie das »Goryeo-Cheongja«, ein repräsentatives Porzellan aus der Goryeo Dynastie (918–1392), noch weist es eine so reduzierte, klare Form auf wie das »Choseon-Begja«, ein Porzellan der vorhergehenden Choseon Dynastie. Es wurde von routinierten, erfahrenen Meistern in einem zügigen Arbeitsprozess gefertigt – ohne explizit künstlerischen Anspruch, ohne Dekor. In diesem rauen und doch zur gleichen Zeit kultivierten Geschirr, dessen unmittelbare Materialität eine tiefe Würde ausstrahlt, findet Cho Byoungsoo ein Vorbild an Nützlichkeit und formaler Einfachheit. Die Qualitäten eines Sabal auf den Raum zu übertragen, sieht er als ein wesentliches Ziel seiner Arbeit.
Material und Sinnlichkeit
Cho Byoungsoo blickt heute auf eine 13-jährige Praxis als Architekt zurück. Seine Ausbildung begann er an der Montana State University in den USA. Dort wie auch an vielen anderen Hochschulen war in den achtziger Jahren die Vermittlung der sozialen Verantwortung des Architekten ein wichtiges Ausbildungsziel, was ihn nachhaltig beeinflusst hat. Später studierte er an der Graduate School der Harvard University, wo Rafael Moneo und Mack Scogin großen Eindruck auf ihn machten. Moneos Überzeugung, dass das Nachdenken über Architektur vom Nachdenken über das Material nicht getrennt werden kann und die in seiner Arbeit zentrale Frage nach dem Umgang mit dem Material haben Cho Byoungsoos Haltung zur Architektur und seine Entwurfsmethode geprägt. Tatsächlich pflegt er einen fast handwerklichen Umgang mit Materialien. In seinem Büro findet man zahlreiche Proben – Natursteine, Beton, Stahl, Holz und Glas –, mit denen er gerne herumexperimentiert. Dabei interessieren ihn hauptsächlich deren atmosphärische Eigenschaften und die Frage, welche Spuren Zeit und Gebrauch auf ihnen hinterlassen. In der Kombination aber auch Konfrontation verschiedener Materialien sieht Cho eine Möglichkeit, Architektur jeweils einen charakteristischen Ausdruck zu verleihen und die sinnliche Wahrnehmung seiner Bauten zu erweitern. Bereits in den ersten Entwurfsüberlegungen thematisiert er das Material, wobei ihm seine jahrelange Erfahrung zugute kommt, die sich nicht zuletzt auch in realistischen Budgets äußert. Bei fast allen seinen Projekten übernimmt sein Büro auch die Bauaufsicht. Für diesen Teil der Arbeit ist in erster Linie Chos Bruder zuständig, mit dem er seit Langem zusammenarbeitet.
Bereits die ersten Arbeiten Chos nach seiner Rückkehr 1991 offenbarten die Richtung, in der sich seine Architektur in den kommenden Jahren entwickelte. Parallel zu seinen Projekten beschäftigte er sich eingehend mit den »Dalgongne«, den traditionellen Arme-Leute-Siedlungen Koreas, die mittlerweile fast alle verschwunden sind. Im Mittelpunkt seiner Recherche stand die architektonische und städtebauliche Qualität dieser anonymen Strukturen sowie ihre ursprüngliche Materialität. Diese Erkenntnisse hatten einen direkten Einfluss auf seine frühen Bauten: Bei seinem Studio in Seongbuk-Dong, einem Stadtteil von Seoul, lotete er das Zusammenspiel von Materialien aus, die er bewusst der Witterung aussetzte, um daran ihr Alterungsverhalten studieren zu können. Bei zwei weiteren Frühwerken, dem »« Form-Haus und dem »« Form-Haus» versuchte er eine Art Synthese von traditionellem koreanischen Wohnstil und moderner, westlich geprägter Wohnkultur zu schaffen. Einen vorläufigen Höhe- und Wendepunkt in der architektonischen Entwicklung Cho Byoungsoos markieren das Haus »Camerata Hwang In-yong Music Studio» im Heyri Art Village (2004) und das »« Form-Haus in Sugogri»(2005). Meisterlich nutzte er in diesen beiden Projekten formale Reduktion und eine bewusst raue Materialbearbeitung, um authentische, atmosphärisch dichte Räume zu schaffen.
In Cho Byoungsoos Verständnis ist architektonische Schönheit eng an das Material und die Funktion gekoppelt. Deshalb sieht er Schönheit etwa an einer sonnenbeschienenen, schmucklosen Fassade einer alten Scheune, wie man sie in Montana findet, genauso wie in der ernsten Würde eines einfachen Zweckraumes. Sein Interesse für die emotionalen Aspekte der Architektur zeigt, dass er sie als einen Ausdruck von Lebenserfahrung begreift. Es geht ihm nicht um eine vordergründige Schönheit oder die reine Form, sondern um eine organische Architektur, die auf Erfahrung und Erkenntnis beruht. Entsprechend gilt sein Interesse am Material weniger den damit verbundenen konstruktiv-technischen Möglichkeiten, sondern dessen emotionalen Qualitäten. Ein Kritiker hat über seine Architektur einmal festgestellt: »Seine Räume scheinen nur aus Material und Licht zu bestehen. Man fühlt sich darin als sei man in der freien Natur.«
Mit diesem Fokus auf die räumliche und emotionale Qualität der Architektur steht Cho Byoungsoo quer zur Tendenz der zeitgenössischen Architektur, der es vor allem um die Haut der Gebäude, um deren äußere Erscheinung zu tun ist. Seine Gebäude bieten dem Leben Raum, stehen in engem Bezug zu Natur und Landschaft und sie zeichnen sich durch jene Art von räumlicher »Uneindeutigkeit« aus, die er als ein zentrales Merkmal alter koreanischer Architektur identifiziert.
Die Kiste als Experimentierfeld: Embedded house und ramp building
Nach dem »« Form-Haus hat Cho Byoungsoo sich auf eine formal einfache Architektur konzentriert. Sein neues Thema wurde die »Kiste« (Box). Die Beschäftigung damit hat seine architektonische Sprache radikalisiert. Die Box diente ihm als Studienobjekt, um die wesentlichen Funktionen und die Schönheit des Raumes zu erforschen. Ein schlichter Raum, so seine Überzeugung, unterstützt die Wahrnehmung, er ist wie ein Gefäß für »Erfahrung und Erkenntnis«. Der Charakter seiner Architektur nähert sich dem des eingangs erwähnten Sabal Geschirrs.
Cho Byoungsoos neuere Projekte – 3-Boxes House, Split House, Ramp Building, Embedded House, Be-twixt und Gallery Sagan – sind Ergebnisse seiner Auseinandersetzung mit der Kistenform. Besonders spannend erscheint in diesem Zusammenhang das Embedded House, das als Transformation des 3-Boxes House aus drei kistenförmigen Körpern gelesen werden kann oder das Split House, das aus zwei kistenförmigen Körpern besteht. Dieses für einen in Korea sehr bekannten Schriftsteller und Zen-Maler entworfene Haus liegt in der Nähe des Dorfes Hwacheon in einer gebirgigen Landschaft. Die Konfiguration des Gebäudes folgt der Nutzung des Hauses, das sowohl die Arbeitsräume als auch die Wohnung des Künstlers beherbergt. Um es möglichst organisch in die umgebende Natur zu integrieren, hat Cho die Baukörper der Landschaftsformation entsprechend verzerrt. Mit seinen schmucklosen Sichtbetonoberflächen mag es im ersten Moment hermetisch geschlossen wie ein Bunker oder eine Garage wirken.
Tatsächlich aber verfügt das Gebäude über zwei schmale, zwischen seinen Baukörpern eingeschobene Gärten und kommuniziert auf vielfältige Weise mit seiner Umgebung. Für den Bauherrn, einen Naturliebhaber, wurden einige Fenster so tief positioniert, dass sie sich für eine meditative Betrachtung der Landschaft anbieten. Eine weitere Besonderheit, das hohe, auf die Dachfläche ausgreifende Fenster, ist der Vorliebe des Künstlers, den Mond zu betrachten, geschuldet.
Das Ramp Building ist zusammen mit dem fast zeitgleich entstandenen Be-twixt das erste multifunktionale Geschäftshaus Chos. In Korea wird bei Geschäftshäusern meist nur Wert auf eine optimale Flächenausnutzung gelegt, nicht aber auf architektonische Qualitäten. Deshalb waren diese Projekte für ihn neue und spannende Aufgaben. Beim Ramp Building nutzte er das leicht abschüssige Terrain, um vom oberen Straßenniveau ausgehend, eine als Betonkörper ausgebildete Rampe tief in das an dieser Stelle völlig verglaste Gebäude eindringen zu lassen. Sie dient einerseits der Erschließung eines Verkaufsraumes, andererseits soll sie etwas vom Leben auf der Straße ins Gebäude holen. Auch die an der Außenseite des Gebäudes aufgehängten Treppen lassen sich als ein Versuch interpretieren, zwischen Innen- und Außenraum zu vermitteln. Ein hoher Drahtschirm schließlich markiert, dem Straßenverlauf folgend, die Grundstücksgrenze und definiert dabei einen Binnen-Außenraum, eine Art von Puffer gegen die laute Geschäftigkeit des umgebenden Stadtraums.
Die Bauten aus Chos Box-Serie sind als Versuche über eine Grundform lesbar. Seine Fähigkeit, formal einfache Räume durch den überlegten Einsatz von Materialien, durch ausgefeilte Detaillösungen und eine klare Konstruktion in emotional aufgeladene Erfahrungsräume zu verwandeln, ist an den Wohnhäusern klarer ablesbar als an den städtischen Geschäftshäusern. Die Qualität von Cho Byoungsoos Architektur kommt insofern im Embedded House klarer zum Ausdruck als im Ramp Building.
Cho selbst wuchs in einem Hanok, einem traditionellen koreanischen Haustypus auf, bei dem Innen- und Außenraum in einem engen Wechselverhältnis stehen, gleichsam organisch miteinander verbunden sind. Außerdem hat er, fasziniert von der traditionellen koreanischen Porzellankunst, einige Zeit in einer Werkstatt verbracht. Was ihn beschäftigt, sind »Dinge, die existieren und Dinge, die existiert haben« »eine zeitgenössische, vernakuläre Architektur«, eine Architekur der »Erfahrung und Erkenntnis« sowie das Thema der »Struktur und Abstraktion«. Er ist ein Architekt, der die Moderne neu interpretiert und dabei den Versuch wagt, eine zeitgenössische Architektur mit Bezügen zur spezifisch koreanischen zu schaffen.db, Di., 2007.10.02
02. Oktober 2007 Lim Jinyoung
verknüpfte Bauwerke
Ramp Building
Embedded House
Subversives Raumwunder
Der Architekt Cho Minsuk gehört zu den führenden Vertretern der jungen koreanischen Architekturszene. Nach seinem Studium an der Yonsei University in Seoul und der Columbia University in New York arbeitete er zunächst in verschiedenen Büros, unter anderem bei OMA/Rem Koolhaas in Rotterdam, ehe er sich 1998 in New York selbstständig machte. Gemeinsam mit Park Kisu gründete er 2003 in Seoul das Büro Mass Studies, das mit seinen avantgardistischen Projekten bald weit über Koreas Grenzen hinaus Aufmerksamkeit erregte.
So grauenhaft einem aus mitteleuropäischer Perspektive die mitunter riesigen Wohnblocks, die heute das Bild der koreanischen Städte prägen, in gestalterischer und städtebaulicher Hinsicht auch erscheinen mögen – sie gehören zur architektonischen Realität des Landes, ja sie sind ein Teil seiner kulturellen Identität. Kein anderer Architekt in Korea hat sich so intensiv und kritisch mit dem Phänomen dieser Wohnungetüme auseinandergesetzt wie Cho Minsuk, der sie ebenso spöttisch wie treffend als »Hilbersheimer« bezeichnet. Die Zahlen, die er präsentiert, um die Bedeutung dieser Architektur- und Wohnform für die koreanische Gesellschaft zu illustrieren, sprechen für sich: noch 1990 haben erst 30 Prozent aller Südkoreaner in einem Apartmenthaus gelebt, 2006 waren es bereits 70 Prozent. Diese Ziffern belegen einerseits die schier unglaubliche Dynamik des koreanischen Wohnungsbausektors, sie deuten andererseits auf eine allmählich absehbare Sättigung des Marktes hin. Manche Beobachter meinen freilich, der Boom werde noch sehr lange anhalten, denn mittlerweile hat man damit begonnen, die ersten, aus den sechziger und siebziger Jahren stammenden Apartmenthäuser abzureißen und durch modernere Anlagen zu ersetzen. Der Bau (zunehmend luxuriöser) Großsiedlungen mit Hunderten, ja Tausenden von Eigentumswohnungen verspricht weiterhin ein gutes Geschäft zu sein; für ihre Vermarktung allerdings muss mehr getan werden als in den letzten Jahrzehnten. Das ist der wesentliche Grund, weshalb die großen, landesweit agierenden Baugesellschaften, die solche Siedlungen entwickeln, errichten und verkaufen, mehr und mehr in Branding-Maßnahmen investieren.
Ein faustischer Pakt
Vor diesem Hintergrund ist die von Cho Minsuk entworfene Xi Gallery in Busan zu sehen. Denn es handelt sich hier nicht etwa um eine im Kunstbereich tätige Galerie, sondern – zumindest im Kern – um den Showroom einer der großen Baugesellschaften. Ein Gebäude also, in dem das Unternehmen seine Produkte in Form von Musterwohnungen der interessierten Öffentlichkeit vorstellen und verkaufen möchte. Bei der Xi Gallery und einigen artverwandten Projekten, die in jüngster Zeit entstanden sind, geht es nicht mehr allein um den Vertrieb. Um die Attraktivität der Showrooms zu steigern, werden sie mit Zusatzfunktionen aufgeladen – in der Regel kultureller und gastronomischer Art. Das Bauunternehmen tritt dabei als Sponsor auf und lockt so ein größeres Publikum in sein Haus. Das wiederum soll sich positiv auf den »Brand« auswirken; man kennt diese Art von Marketing-Konzept. Bemerkenswert, dass sich die Baugesellschaften, die sich bisher herzlich wenig um die architektonische Qualität ihre Produkte gekümmert haben, auf einmal gezwungen sehen, mit kreativen Kräften zu arbeiten. Für die Architekten wiederum ist die Zusammenarbeit mit den Baugesellschaften ein heißes Eisen, da sie hier mit ihrer Arbeit zur Verbreitung von Bauten beitragen sollen, die ihren eigenen Ansprüchen und Vorstellungen meist diametral gegenüberstehen. Nicht ohne Grund spricht Cho Minsuk bei diesem Projekt von einem »faustischen Pakt« auf den er sich eingelassen habe.
Eine abstrakte Landschaft
Die Xi Gallery liegt an der mehrspurigen Hauptstraße eines heterogen bebauten, eher peripheren Stadtquartiers von Busan, der zweitgrößten Stadt Koreas. Zwischen belanglosen Wohn- und Geschäftshäusern ist bereits die ebenso ungewöhnliche wie rätselhafte äußere Erscheinung des Neubaus dazu angetan, die Aufmerksamkeit der Passanten zu erregen. Zunächst nimmt man einen unregelmäßig geformten, kompakten Baukörper von erheblichen Dimensionen wahr, der auskragend auf einem teilbegrünten Sockel sitzt. Dass er trotz seines Volumens keinesweg bedrückend schwer wirkt, verdankt er seiner hellen Farbigkeit und vor allem seiner transluzenten, aus vertikal ausgerichteten Luftkissen bestehenden Fassade. Sie ist das Erkennungszeichen dieses Gebäudes, das vor allem bei Dunkelheit, wenn die Luftkissenfassade von innen beleuchtet in wechselnden Farben erstrahlt, weithin sichtbar ist. Während der kompakte, auf einem annährend quadratischen Grundriss basierende Baukörper wenig über seine mögliche Nutzung verrät, lässt er keinen Zweifel daran aufkommen, wo sich sein Eingang befindet und dass er von vielen Menschen betreten werden will: Eine großzügige, sich nach oben hin verbreiternde Freitreppe markiert an einer straßenseitigen Gebäudeecke den verglasten Haupteingang, über dem das luftkissenverkleidete Volumen in einer dramatischen Geste nach oben schwingt.
Für die Xi Gallery konnte Mass Studies eine klare dreiteilige Gliederung entwickeln: zu unterst eine Sockelzone mit Parkhaus, Lager- und Technikräumen, darauf eine mittlere Ebene mit den gemeinnützig-kulturellen Sondernutzungen, die das Bauwerk für die Allgemeinheit attraktiv machen sollen und zu oberst, in dem mit Luftkissen verkleideten Teil, der Ausstellungsbereich der Baugesellschaft – eine mit einer großen Messehalle vergleichbare, offene Raumstruktur, in die Musterwohnungen eingebaut werden.
Im Zentrum des Gebäudes und der entwerferischen Anstrengungen steht also nicht der Showroom, sondern der Bereich, in dem sich der Bauherr als freimütiger Gastgeber und kultureller Wohltäter präsentiert.
Ein einfaches Landschaftsmotiv hat die Gestaltung der mittleren Ebene inspiriert. Cho Minsuk spricht von einem Tal zwischen zwei Bergen. Das Tal ist die diagonale Hauptachse durch das Gebäude, deren Richtung schon durch die Freitreppe am Außenbau vorgegeben ist. An ihrem, dem Haupteingang gegenüberliegenden Ende erreichen die Besucher eine Fläche für Wechselausstellungen und einen Veranstaltungssaal, der für Vorträge, Filmvorführungen aber auch kleinere Musik- oder Theaterdarbietungen geeignet ist. Auch die dezent im hinteren Teil des Gebäudes situierten Büros und Verkaufsräume der Wohnungsbaugesellschaft werden von hier aus erschlossen. Rechts und links der Hauptachse erheben sich die »Berge«. In ihrem Inneren, das über tiefe Einschnitte in den Berg-Flanken erreichbar ist, befinden sich Räumlichkeiten für eine Koch- und eine Yoga-Schule sowie ein Spielbereich für Kinder. Die Berge sind als komplexe geometrische Körper geformt, deren verschieden geschnittenen Außenflächen auf die vielfältigste Weise gestaltet und genutzt werden. Mal sind die Flanken mit Kakteen bepflanzt, mal werden sie für Wasserspiele genutzt, mal weisen sie eine treppenartige Struktur auf, die sich als Ruheplatz und bei Bedarf auch als Zuschauertribüne anbietet.
Unvergleichliches Raumkontinuum
Eine ganze Reihe von »regulären« Treppen und Rolltreppen erschließen den Besuchern die Berggipfel, von denen aus sowohl der Wohnungs-Showroom im Obergeschoss als auch ein weiterer Veranstaltungssaal erreichbar sind, dessen Volumen quasi als umgekehrter Berg in den Luftraum über der Zentralachse hineinragt. Ähnlich komplex geformt wie die das Tal flankierenden Berge sorgt er im Zusammenspiel mit ihnen im Innern der Xi Gallery für jenes ungemein komplexe Raumkontinuum, das jeden Besuch des Gebäudes zu einem unvergleichlichen Erlebnis macht. Wer das Gebäude durchwandert – und dazu packt einen beim Betreten sogleich die Lust – bemerkt, wie sich der Raum Schritt für Schritt verändert, wie er sich verengt und wieder weitet, sich immer wieder neue Perspektiven ergeben, sich die Atmosphäre je nach Licht und in Abhängigkeit von den jeweils vorherrschenden Materialien und Farben wandelt. Das ist ein Vergnügen sondergleichen und eine bewundernswerte entwerferische Meisterleistung, die umso mehr erstaunt, wenn man bedenkt, in welch sagenhaftem Tempo dieser rund 50 Mio $ teure Bau geplant und errichtet wurde: Die Entwurfsphase dauerte gerade einmal von November 2006 bis März dieses Jahres. Und die Bauarbeiten, die im gleichen Monat begannen, konnten schon im August weitgehend abgeschlossen wurden.
Mass Studies haben in der Xi Gallery ein gestalterisches Feuerwerk gezündet, das seinen Besuchern eindrücklich vor Augen führt, was Architektur kann, über welche räumlichen Möglichkeiten sie verfügt, was sich mit Material und mit Farben alles machen lässt. Man kann das als subversive erzieherische Maßnahme begreifen, denn wie fad und geistlos müssen den Besuchern nach diesem Erlebnis die Stangenwaren im Showroom der Wohnungsbaugesellschaft erscheinen.db, Di., 2007.10.02
02. Oktober 2007 Mathias Remmele
verknüpfte Bauwerke
Ausstellungsgebäude einer Wohnungsbaugesellschaft