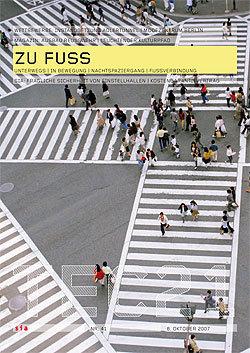Editorial
Strassen wurden von jeher vielfältig genutzt. Transport, Handel, Handwerk und Kommunikation fanden auf der Strasse statt. Mit dem Aufkommen der Automobile wurden die Fussgänger und Fussgängerinnen von der Strasse verdrängt. Heute wird die Strasse als Erweiterung des Wohn- und Arbeitsraums wieder aktuell: zu Fuss zur Schule, zur Arbeit, zum Einkaufen, zu Fuss unterwegs in der Freizeit. «Unterwegs» auf den Schweizer Strassen war die Autorin des ersten Artikels. Sie zeigt Lücken im Fusswegenetz und Möglichkeiten zu deren Schliessung auf.
Doch nicht nur die Fussgänger und Fussgängerinnen bewegen sich. Der Bund ist ebenfalls «in Bewegung». Damit das Leben in den Stadt- und Dorfzentren nicht ausstirbt, wird die Mobilität zu Fuss gefördert. An welcher Geschwindigkeit wird der Bund sich orientieren? Wissenschafter der Universität Hertfordshire (GB) untersuchten in 32 Grossstädten auf der ganzen Welt die Schrittgeschwindigkeit von Fussgängern. Dafür wurde die Zeit gestoppt, die 35 Testpersonen für eine Strecke von 20 Metern durch die Stadt brauchten. Das Ergebnis zeigte Anfang dieses Jahres, dass die Menschen in Singapur mit 10.55 Sekunden am schnellsten gehen. Zu den gemütlichen Fussgängern gehören die Berner mit 17.37 Sekunden.
Zu gehen, egal, ob schnell oder langsam, kann nachts unangenehme Gefühle hervorrufen. Der Artikel «Nachtspaziergang» beleuchtet die Situation der Fussgänger bei Dunkelheit, beschreibt Empfindungen und bietet Lösungen, damit das Sich-Bewegen durch die Nacht nicht zur Hetzjagd wird, sondern genossen werden kann. Die Forderung an ein Fusswegenetz – direkt, sicher und attraktiv – griff man im Dreiländereck auf. Die neue Fussgänger- und Radwegbrücke über den Rhein zwischen Friedlingen (D) und Hüningen (F) erlaubt den vom vielen Sitzen geprägten Menschen das länder-übergreifende Flanieren.
Daniela Dietsche
Inhalt
05 wettbewerbe
Instandsetzung Adlertunnel | Modezentrum in Berlin
12 magazin
Ausbau Reusswehr: Referendum ergriffen | Leuchtender Kulturpfad | Langsamverkehr: Mit- und Nebeneinander|Basel markiert Begegnungszonen|Zürich:Neues im Westen
22 Unterwegs
Marlène Butz | Schwachstellen im Fusswegenetz können mit einer vorausschauenden Planung umgangen werden.
27 in Bewegung
Gabriele Gsponer | Den Fussgängerverkehr zu fördern ist ein Ziel des Bundes.
29 Nachtspaziergang
Christian Vogt | Nachts verstärkt sich das Bedürfnis nach Sicherheit im öffentlichen Raum. Umso wichtiger ist die Beleuchtung.
33 fussverbindung
Clementine van Rooden | Standort und Konstruktion der längsten Fussgänger-Bogenbrücke bei Basel orientieren sich an der Aussicht über die Brückenenden.
37 sia
Fragliche Sicherheit von Einstellhallen | Krankenkassenprämien optimieren | Der Kostengarantievertrag SIA
44 Produkte
53 impressum
54 veranstaltungen
Unterwegs
Das Gehen zu Fuss ist die natürlichste Fortbewegungsart. (Fast) alle sind täglich zu Fuss unterwegs. Als Autofahrerin, Velofahrer oder Benutzerin des öffentlichen Verkehrs legt man täglich mehrere Etappen zu Fuss zurück. Attraktive, sichere und direkte Fusswege sind die Voraussetzung dafür, dass sie benützt werden. Eine vorausschauende Planung und eine gute Umsetzung sind dabei zentral.
Fussgänger und Fussgängerinnen möchten, wie alle Verkehrsteilnehmenden, zügig und ungehindert vorwärtskommen. Da das Gehen nicht nur zweckgerichtet ist, brauchen sie neben direkten, sicheren Fusswegen auch Aufenthaltsbereiche, in denen sie vom Fahrverkehr ungestört im Gehen innehalten können. Die FussgängerInnen bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit, die in die Verkehrsplanung einbezogen werden müssen. Kinder sind den Gefahren der Strasse mangels Erfahrung besonders stark ausgesetzt. Sie können Entfernungen und Geschwindigkeiten nicht abschätzen und sich nicht auf mehrere Dinge gleichzeitig konzentrieren. Bei Menschen mit (auch zeitweiser) Gehbehinderung sinkt die Geschwindigkeit der Fortbewegung und Reaktionsfähigkeit. Personen mit Sehbehinderung sind in erhöhtem Masse darauf angewiesen, dass Hindernisse und Störungen auf Gehflächen minimiert werden. Eine Hörbehinderung wird für andere Verkehrsteilnehmende nicht als Gefahr erkannt. Ältere Menschen können von mehreren der genannten Einschränkungen betroffen sein. Sie reagieren nicht mehr so schnell wie früher. Unerwartete Ereignisse können zu Unentschlossenheit und Unsicherheit führen.
Fusswege Planen
Die Bedürfnisse der Fussgänger und Fussgängerinnen werden oft als zweitrangig angesehen und in Verkehrsplanungen nicht angemessen berücksichtigt. Es gibt systematische Fehler und Schwachstellen im Netz. Fehlende Verbindungen, die zu Umwegen zwingen, Fusswege entlang stark befahrener Strassen, Trottoirs, die unvermittelt enden, oder Orte, wo das Queren nicht möglich oder sehr gefährlich ist, senken die Sicherheit und die Attraktivität eines Fusswegnetzes. Für die Verbesserung ist hier eine systematische Planung notwendig. Fusswegnetze müssen attraktiv, direkt, sicher und komfortabel sein. Eine Fusswegplanung darf sich nicht auf die Zentrumsgebiete beschränken. Handlungsbedarf besteht insbesondere in Aussenquartieren, an Siedlungsrändern und in Umnutzungsgebieten. Zu berücksichtigen sind vor allem die Bedürfnisse der Kinder: Schulwege und Freizeitwege sind mehr als eine Überwindung der Distanz zwischen Wohnung und Schule oder Spielplatz. Für die motorische, psychische und soziale Entwicklung der Kinder ist es wichtig, dass sie selbstständig zur Schule gehen, im Quartier Freundinnen und Freunde besuchen und im Freien spielen können.
In Siedlungskernen und anderen geeigneten Gebieten empfiehlt es sich, Fussgängerzonen einzurichten. Diese bieten die höchste Aufenthaltsqualität für die Fussgänger. In Fussgängerzonen gilt Fahrverbot. Die mittels Ausnahmeregelung ausgenommenen Fahrzeuge fah-ren im Schritttempo, und die Fussgängerinnen haben Vortritt. Ist dies nicht möglich, kann durch die Einrichtung einer Begegnungszone und eine attraktive Gestaltung eine ähnlich hohe Qualität geschaffen werden. In Begegnungszonen gilt Tempo 20, und die Fussgänger haben überall Vortritt. Begegnungszonen eignen sich auch für die Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren. Sie sollten allerdings so gestaltet sein, dass spielende Kinder nicht durch parkierte Autos behindert werden. In den übrigen Wohnquartieren sind flächendeckend Tempo-30-Zonen vorzusehen.
Schwachstellen entscheiden über die Attraktivität
Es sind «Kleinigkeiten», die darüber entscheiden, ob es angenehm ist, zu Fuss zu gehen. Oft wird das Trottoir bloss als Ausweich- und Restfläche behandelt. Personen, die mit Kinderwagen oder Gepäck unterwegs sind, müssen sich an Fahrzeugen vorbeiquetschen, die unerlaubterweise auf dem Trottoir stehen – oder sie sind gezwungen, auf die Fahrbahn auszuweichen, was nicht nur eine Komforteinbusse darstellt, sondern auch ein beträchtliches Sicherheitsrisiko. Baustelleninstallationen verstellen die Gehwege, und häufig wird leider vergessen, dass bei Baustellen auf öffentlichem Grund nicht nur für die Motorfahrzeuge Ausweichmöglichkeiten angeboten werden sollten, sondern auch für die FussgängerInnen. Im Winter kommt eine jahreszeitlich bedingte Schwachstelle hinzu: Zuerst werden die Fahrbahnen vom Schnee befreit. Die Schneeberge werden dabei häufig auf dem Trottoir «entsorgt».
Dabei kann bereits mit kleinen Massnahmen eine grosse Qualitätssteigerung erreicht werden. Eine Schwachstellenanalyse hilft, die Potenziale zu erkennen. Sie ist besonders aussagekräftig, wenn engagierte Gruppierungen aus dem betreffenden Quartier (z. B. Elternvereinigungen, Quartiervereine etc.) in die Analyse miteinbezogen werden. Sie kennen aus der alltäglichen Erfahrung die Probleme.
Fussgängerstreifen und andere Querungsmöglichkeiten
Die Attraktivität eines Fusswegnetzes hängt auch von sicheren Querungsmöglichkeiten ab. Fussgängerstreifen gelten gemäss dem Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG) als Verbindungsstücke im Fusswegnetz. Fehlende Fussgängerstreifen stellen also eine Lücke im Fusswegnetz dar, was mit dem FWG nicht zu vereinbaren ist.
Fussgängerstreifen sind für Zufussgehende vortrittsberechtigte Querungsstellen, und sie «markieren» die Präsenz von Fussgängerinnen und Fussgängern. Die gelbe Markierung auf der Fahrbahn wirkt unmittelbar. Fussgängerstreifen leiten Zufussgehende zu den Querungsstellen, die bezüglich Sicherheitsanforderungen optimiert sind. Sie dienen somit der Erhöhung der Sicherheit und der Attraktivität des Fusswegnetzes. Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten, die sich nicht sicher genug im Verkehr bewegen können, sind auf vortrittsberechtigte Querungen angewiesen.
Tempo 30 und Fussgängerstreifen – ein Widerspruch?
In Fussgänger- und Begegnungszonen braucht es keine Fussgängerstreifen, weil die FussgängerInnen auf der ganzen Fläche Vortritt haben. Etwas komplizierter sieht es bezüglich Tempo-30-Zonen aus. Bei der Einführung von solchen Zonen steht regelmässig der Erhalt bzw. die Entfernung von Fussgängerstreifen zur Debatte. Artikel 4 der «Verordnung über die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen» lautet: «Die Anordnung von Fussgängerstreifen ist unzulässig. In Tempo-30-Zonen dürfen jedoch Fussgängerstreifen angebracht werden, wenn besondere Vortrittsbedürfnisse für Fussgänger dies erfordern, namentlich bei Schulen und Heimen.» Der Bund hat bei der Abfassung der Verordnung also Spielraum vorgesehen, sodass an wichtigen Orten auch in Tempo-30-Zonen Fussgängerstreifen markiert werden können. Es liegt bei den Kantonen bzw. bei den für die Signalisation zuständigen Stellen, die gemäss Bundesrecht vorgesehenen Ausnahmen in der Praxis umzusetzen. Eine einheitliche Praxis konnte bisher nicht etabliert werden. Es gibt Bewilligungsstellen, die sehr restriktiv verfahren, andere sehen «besondere Vortrittsverhältnisse» als vielerorts gegeben. «Fussverkehr Schweiz» empfiehlt, dass bei wichtigen Querungsstellen den FussgängerInnen weiterhin der Vortritt gewährt wird.
Anstelle von oder ergänzend zu Fussgängerstreifen kommen auch andere Fussgängerschutzmassnahmen in Frage, namentlich an Orten, wo die Sichtbeziehungen zu den Warte-räumen eingeschränkt sind. Als Kombination von Verkehrsberuhigung und Querungssicherung wirken Fahrbahnerhöhungen (Aufpflasterungen) geschwindigkeitsdämpfend und bieten dadurch einen hohen Schutz. Fahrbahneinengungen (Trottoirnasen) verbessern die Sichtverhältnisse und verkürzen die Querungsdistanz. Ein Kreuzen der Fahrzeuge ist an der Querungsstelle nicht mehr oder nur noch langsam möglich.
Das Erstellen von Unter- oder Überführungen wird nicht empfohlen, da diese mit erheblichen Nachteilen verbunden sind wie beispielsweise Umwege, Vandalismus und Verschmutzung oder problematisch sind in Bezug auf mangelnde Behindertengerechtigkeit und Sicherheit vor Übergriffen. Der Fussverkehr soll als gleichberechtigter Verkehrspartner in Erscheinung treten und sich ebenerdig fortbewegen können.
Konflikte zwischen FussgängerInnen und Velofahrenden
Bei einer Verkehrsplanung muss stets auch die Beziehung zwischen Velofahrenden und Fussgängern und Fussgängerinnen einbezogen werden. Obwohl beide Verkehrsarten gefördert werden sollen, da sie gesund, platzsparend und umweltfreundlich sind, haben sie sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Sie sollten deshalb nur in Ausnahmefällen auf der gleichen Fläche geführt werden. FussgängerInnen brauchen Bereiche, in denen sie sich ungestört vom Fahrverkehr aufhalten können. Velos sind Fahrzeuge, und als solche gehören sie auf die Fahrbahn. Veloprobleme sollen auf der Fahrbahn gelöst werden, indem den Velos ausreichend Platz zur Verfügung gestellt wird, auch durch Spurreduktionen zu Lasten des motorisierten Verkehrs. Die Schaffung gemeinsamer Fuss- und Radwege oder die Freigabe von Gehflächen für Velofahrende hat für diese zwar den Vorteil einer erhöhten Durchlässigkeit, doch schmälern Konfliktsituationen mit Zu-Fuss-Gehenden die Attraktivität dieser Routen für beide Verkehrsarten.
[ Marlène Butz, dipl. Geografin, Projektleiterin bei «Fussverkehr Schweiz» ]TEC21, Mo., 2007.10.08
Anmerkungen
«Fussverkehr Schweiz» und «Pro Velo Schweiz» haben eine Broschüre mit dem Titel «Fuss- und Veloverkehr auf gemeinsamen Flächen – Empfehlungen für die Eignungsbeurteilung, Einführung, Organisation und Gestaltung von gemeinsamen Flächen in innerörtlichen Situationen» erarbeitet. Bezug: für Fr. 25.– bei den beiden Verbänden oder als Download unter: www.fussverkehr.ch/publikationen.php oder www.pro-velo.ch/brosch/index_d.php
08. Oktober 2007 Marlène Butz
In Bewegung
Für eine nachhaltige Personenmobilität will der Bund die Potenziale des Langsamverkehrs besser nutzen. Neben dem motorisierten Individualverkehr und dem öffentlichen Verkehr soll er als dritte Säule der schweizerischen Personenverkehrspolitik gestärkt werden.
88 Minuten ist die Bevölkerung der Schweiz im Durchschnitt täglich unterwegs, davon 35 Minuten zu Fuss. Die in diesen 35 Minuten zurückgelegten Wege haben unterschiedlichste, teilweise miteinander kombinierte Zwecke und Ziele wie Schule, Arbeit, Einkaufen oder Freizeit. Diese Ziele werden jedoch nicht alle ausschliesslich zu Fuss erreicht. Oft setzt sich ein Fussweg aus einer Vielzahl von kürzeren und längeren Wegetappen in Kombination mit anderen Verkehrsmitteln (kombinierte Mobilität) zusammen. Die Bedeutung eines attraktiven, sicheren und zusammenhängenden Fusswegnetzes als Grundlage für den Fussverkehr wurde bereits 1979 erkannt. Volk und Stände haben an der Urne mit grosser Mehrheit einen entsprechenden Grundsatzentscheid gefällt und mit Artikel 88 in der Bundesverfassung verankert. Der Nationalrat wollte seinerzeit auch die Velowegnetze in den Verfassungstext aufnehmen, scheiterte damit aber in der Differenzbereinigung. Mit Blick auf die heutigen Forderungen, den CO2-Ausstoss des ganzen Verkehrssystems erheblich zu reduzieren, wäre die Wiederbelebung dieser «alten» Idee eine zentrale Voraussetzung, den Veloverkehr zu stärken. Vor bald 30 Jahren lag der Fokus darauf, die Wanderwege zu erhalten und zu schützen, in erster Linie gegen die fortlaufende Asphaltierung und Öffnung für den motorisierten Verkehr. Doch auch die Fusswege wurden vorausschauend in die Verfassung und die nachfolgenden gesetzlichen Regelungen aufgenommen. Das auf den 1. Januar 1987 in Kraft gesetzte Fuss- und Wanderweggesetz (FWG) bildete lange Zeit die einzige Grundlage für die Aktivitäten des Bundes.
Der Langsamverkehr in der Agglomerationspolitik
Seit der Abstimmung im Jahr 2004 über die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen NFA (Art. 86 Abs. 3 BV) hat der Bund die Kompetenz und den Auftrag, sich zusammen mit den Kantonen auch im Agglomerationsverkehr zu engagieren. Dieser Auftrag wurde mit dem Infrastrukturgesetz (IFG) präzisiert. Damit erhält die Bundesgesetzgebung erstmals eine Grundlage, Bundesbeiträge an Infrastrukturen des Langsamverkehrs auszurichten. Die Verkehrssysteme in den Agglomerationen stossen heute vielerorts an Kapazitätsgrenzen und beeinträchtigen Bevölkerung und Umwelt. Der Langsamverkehr ist deshalb konsequent materiell und formell als dritte Säule des Personenverkehrs in alle Elemente der Agglomerationsprogramme zu integrieren. Auf der Suche nach politisch und finanziell tragfähigen Lösungen, um den Agglomerationsverkehr zu reduzieren, bietet der Langsamverkehr ein beträchtliches, bisher zu wenig genutztes Potenzial. Fuss- und Veloverkehr können in den Agglomerationen als eigenständige Mobilitätsformen einen erheblichen Anteil der Kurzstreckenmobilität direkt abdecken. Bei längeren Distanzen ist die flächendeckende Feinerschliessung für diese beiden Fortbewegungsarten – quasi die «first and last mile» der Verkehrspolitik – ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit des kombinierten Personenverkehrs. Mit Blick auf diese Basisfunktion des Langsamverkehrs bilden der vollständige Einbezug und die Verankerung adäquater Massnahmenpakete für den Fuss- und Veloverkehr (inkl. Wandern für den Bereich Naherholung) eine der Grundanforderungen des Bundes an die Mitfinanzierung der Agglomerationsprogramme. Die Rahmenbedingungen zur Förderung des Fussverkehrs zu verbessern ist damit eine Verbundaufgabe. Bund, Kantone und Gemeinden sind gemeinsam verantwortlich, dass ein attraktives, sicheres, zusammenhängendes und hinreichend dichtes Fusswegenetz geschaffen und erhalten wird. In den nächsten zwanzig Jahren stehen sechs Milliarden Franken Bundesbeiträge für Verkehrsinfrastrukturen des öffentlichen Verkehrs, des motorisierten Individualverkehrs sowie des Fuss- und des Veloverkehrs in Städten und Agglomerationen zur Verfügung. Der Ball für die optimale Förderung des Fuss- und Veloverkehrs in den Agglomerationen liegt zurzeit bei den kantonalen und kommunalen Behörden. Sie erstellen die Agglomerationsprogramme, um sie nachher beim Bund zur Genehmigung und Mitfinanzierung einzureichen. Um diese Bestrebungen zu unterstützen, hat das Bundesamt für Strassen (Astra) in allen drei Landessprachen die Arbeitshilfe «Der Langsamverkehr in den Agglomerationsprogrammen» verfasst.
Vision und Strategie des Bundes
Der Langsamverkehr soll dazu beitragen, dass die heutigen und die künftigen Mobilitätsbedürfnisse möglichst umweltschonend, gesundheitsfördernd und volkswirtschaftlich effizient befriedigt werden können. Dazu wird das Grundanliegen, den Langsamverkehr neben dem motorisierten Individualverkehr und dem öffentlichen Verkehr zu einem gleichberechtigten dritten Pfeiler einer effizienten Personenverkehrspolitik zu entwickeln, konsequent weiterverfolgt. Der Stärkung des Fussverkehrs unter Beachtung der Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist dabei vor allem in urbanen und periurbanen Räumen eine hohe Beachtung zu schenken.
[ Gabriele Gsponer, Dipl. Ing. agr., Bundesamt für Strassen (Astra), Abteilung Strassennetze, Bereich Langsamverkehr, Spartenleiterin Fussverkehr und Wandern ]TEC21, Mo., 2007.10.08
[1] Keller, H.; Hauser, M.: Verfassungsgrundlagen des Langsamverkehrs, Teil 1 (Bestehende Bundeskompetenzen und gebotene Verfassungsänderungen). Bundesamt für Strassen (Hrsg). Materialien Langsamverkehr Nr. 111, Bern 2006.
[2] Bundesgesetz vom 4.10.1985 über Fuss- und Wanderwege (FWG).
[3] Bundesgesetz vom 6.10.2006 über den Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen (Infrastrukturfondsgesetz, IFG); wird voraussichtlich auf den 1. Januar 2008 in Kraft gesetzt.
[4] Bundesamt für Strassen (Astra): Der Langsamverkehr in den Agglomerationsprogrammen. Bern 2007 (www.langsamverkehr.ch).
08. Oktober 2007 Gabriele Gsponer
Fussverbindung
Das Dreiländereck bei Basel hat der neuen Fussgängerbrücke den Namen gegeben. Über den Rhein gespannt, verbindet sie Weil am Rhein (Deutschland) mit Hüningen (Frankreich) und steht keine 200 m von der Schweizer Landesgrenze entfernt. Seit der Eröffnung im März 2007 soll die neue Verbindung die Fussgängerinfrastruktur der industrialisierten Region verbessern und die Beziehungen über die Ländergrenzen hinweg fördern.
Im Juli 2001 schrieben die Stadt Weil am Rhein und die Communauté de Communes des Trois Frontières (CC3F) einen Wettbewerb für eine Fuss- und Radwegbrücke über den Rhein aus. Die Planungsgemeinschaft Leonhardt, Andrä und Partner / Feichtinger Architectes aus Berlin bzw. Paris gewannen die Konkurrenz und erhielten 2004 den Auftrag für die Planungsarbeiten der Dreiländerbrücke. Die Eröffnung der komplett aus Stahl gefertigten Bogenbrücke fand im März dieses Jahres statt.
Die Asymmetrie des Bauwerks
Die Fussgängerverbindung über den Rhein liegt in der Achse der Hauptstrasse von Friedlingen, einem Ortsteil von Weil am Rhein, und der Rue de France von Hüningen mit dem historischen Turm im Hintergrund. Die beiden Aussichten über die Brückenenden hinweg spielten für das architektonische Konzept eine wesentliche Rolle. Um die Sichtachse für die Fussgänger nicht zu unterbrechen, neigt sich der südliche Bogen um 16° zur Seite und gibt dem Brückenquerschnitt seine Asymmetrie – eine starke und eine schwache Achse prägen die Tragstruktur. Entsprechend sind die Querschnitte der Haupttragelemente ungleich ausgebildet. Der stärkere, vertikale Nordbogen besteht aus zwei hexagonalen, 900 mm hohen Stahlkästen, der schwächere, geneigte Südbogen hingegen aus einem Stahlrohr mit dem Durchmesser von 609 mm. Durch diese spezielle Formgebung wird der nördliche Bogen etwa doppelt so stark belastet wie der südliche.
Ein Teil des Bogenschubs wird an den Auflagerpunkten umgelenkt und an den Brückenenden nach unten gespannt. Dadurch konnte die Gesamthöhe des Bauwerks auf 23 m gesenkt werden. Vom Schnittpunkt der Stahlbogen mit dem Fahrbahndeck bis zu deren Scheitelpunkt misst der Bogenstich sogar nur 16.95 m. Bei einer freien Spannweite von 229.40 m zwischen den Bogenfusspunkten erscheint die Brücke entsprechend flach und schlank. Um das erforderliche Lichtraumprofil der Rheinschifffahrt dennoch freizuhalten, wurde die Gehwegplatte mit einer Kuppenausrundung ausgebildet. Der Hochpunkt befindet sich in Brückenmitte. Die orthotrope Platte aus 10 mm dickem Deckblech und Trapezhohlsteifen hat ein Quergefälle von 2 % und liegt alle 3.10 m auf Querträgern auf. Die anfallende Last wird auf die beiden Längsträger weitergeleitet. Auch bei diesen Tragelementen wurde die Asymmetrie umgesetzt. Der nördliche Träger besteht aus zwei hexagonalen Querschnitten mit 600 mm Bauhöhe, der südliche ist ein Rohr mit 325 mm Durchmesser. Beidseitig hängt der Gehweg alle 9.30 m mit galvanverzinkten Spiralseilen an den Stahlbögen. Die Seildurchmesser variieren entsprechend der Belastung von 30 bis 36 mm.
Die statische Berechnung des asymmetrischen Gesamtsystems erfolgte mit einem räumlichen Stabwerksmodell. Zur Erfassung der korrekten Quersteifigkeit wurde die Gehwegplatte mit einer Finite-Element-Struktur in das Programm eingegeben. Der massgebende Bemessungslastfall für die schlanke Tragkonstruktion war in Querrichtung die Windbelastung. In Brückenlängsrichtung war die Verkehrslast auf der halben Brückenlänge bemessungsrelevant. Die Durchbiegung in diesem Lastfall beträgt 1275 mm, was in etwa L/200 entspricht.
Die schlanke Konstruktion
Um den Einfluss der grossen Durchbiegungen zu berücksichtigen, erfolgte die Schnitt-kraftermittlung nach Theorie III. Ordnung. Die Überhöhung musste bei der Dimensionierung der Tragelemente ebenfalls berücksichtigt werden. Sie konnte infolge der Nichtlinearität nicht direkt aus der Durchbiegung, sondern musste aus der Überlagerung der einzelnen Abtriebskräfte infolge des Eigengewichtes ermittelt werden.
Wegen der schlanken Konstruktion ist die Brücke schwingungsanfällig – man spürt regelrecht die Dynamik, wenn man über die Gehwegplatte geht. Um die Schwingungsanfälligkeit der leichten Konstruktion zu testen, wurden im Januar 2007 am Bauwerk Untersuchungen mit bis zu 1000 Teilnehmern durchgeführt. Nennenswerte Schwingungen stellten sich erst bei einer Brückennutzung von über 500 Personen ein. Bei üblicher Nutzung treten sie nicht auf. Es besteht somit kein relevantes Gefährdungsbild.
Die sich aus der statischen Berechnung ergebenden Auflagerreaktionen wiesen grosse Horizontalkräfte in Richtung Süden auf. Demgegenüber waren die vertikalen Auflagerkräfte wegen der leichten Stahlkonstruktion relativ klein. Darum war die Anordnung von konventionellen, horizontal ebenen Auflagern nicht möglich. Mit Kalottenlagern an den beiden Bogenenden auf der französischen Seite und der längsverschieblichen Lagerung am Ufer von Weil am Rhein konnte die Lastabtragung jedoch gewährleistet werden. Konstruktiv aufwändig waren auch manche Knotenpunkte. Die unterschiedlichen Profilquerschnitte und die grosse Spannweite in Verbindung mit der geringen Brückenhöhe verursachten beispielsweise «schleifende» Schnittpunkte der Bögen mit dem Gehbahndeck. Am nördlichen Bogen beträgt die Länge eines Knotenpunktes ganze 7.70 m. An dieser Stelle wurde ein geschweisster Knoten mit Stahl- und Gussblechen ausgebildet. Die Schweisszugänglichkeit war aber bei den geringen Querschnittshöhen teilweise schwierig. Ausserdem entstanden bei einigen Knotenpunkten in den Stahlquerschnitten hohe Spannungen. Eine konventionelle Ausbildung von Schweissknoten war dann nicht immer möglich. So wurden an den Auflagern zur Verbindung der Haupttragglieder Gussknoten angeordnet. Die freie Formwahl bei der Verbindung der Querschnitte und die einfache Anpassung der Wandstärke entsprechend der statischen Beanspruchung begünstigten diese Konstruktionsweise.
Auf dem Rhein zum endgültigen Standort
Die gesamte Brücke wurde auf dem Vormontageplatz gefertigt. Er befand sich etwa 500 m rheinabwärts auf französischer Seite. Nach dem etwa halbjährigen Zusammenbau der kompletten Konstruktion wurden temporäre Abspannungen an den Brückenenden eingebaut, um die Stabilität und die Steifigkeit zu gewährleisten. Mit Schwerlastfahrzeugen wurde das Bauwerk auf im Fluss treibende Pontons verladen und anschliessend im November 2006 an seine endgültige Lage geschifft. Dafür war die Rheinschifffahrt für einen Tag gesperrt. Nach dem Vorspannen der Zugabspannungen am Brückenende konnten die Lager vergossen werden. Die Brücke war den Fussgängern und Radfahrern nach den Abschlussarbeiten ab März 2007 zugänglich – und diente während des Hochwassers vom letzten August bereits als Aussichtsplattform.TEC21, Mo., 2007.10.08
08. Oktober 2007 Clementine Hegner-van Rooden, Uwe Häberle
verknüpfte Bauwerke
Passerelle sur le Rhin