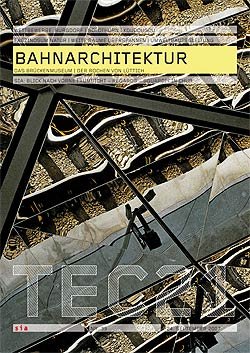Editorial
Bahnhöfe stehen zwischen Bahn und Stadt (oder Bahn und Dorf) und damit am Schnittpunkt zweier Systeme. Egal, ob man die beiden Systeme als gegensätzlich betrachtet die lineare, dynamische Bahn und der lokal verankerte, aus «Immobilien» bestehende Ort oder ob man beides, Stadt und Bahn, als Netz begreift: Der Bahnarchitektur fällt die Aufgabe zu, zwischen den zwei Systemen zu vermitteln. Als Übergänge zwischen zwei Sphären mit je grosser kultureller Bedeutung müssen Bahnhöfe nicht nur hohe funktionale Aufgaben erfüllen, sondern auch auf symbolischer Ebene als transitorische Orte funktionieren. Oder weniger kompliziert: Je wichtiger uns die Bahn wieder wird, desto schöner und publikumsfreundlicher müssen unsere Bahnhöfe sein.
Der in Bau befi ndliche TGV-Bahnhof in Lüttich von Santiago Calatrava (ab S. 30) verspricht beide Aufgaben, die städtebaulich-symbolische wie die funktionale, mit Bravour zu meistern. Zunächst fällt aus der Distanz die grosse Form ins Auge, das grosse Dach aus Stahl und Glas. Es erinnert mit seinen Vordächern und seinen Perrondachverlängerungen an einen Stachelrochen, der sich auf dem Grund der Stadt niedergelassen hat. Doch erfreulicherweise erschöpft sich die Architektur nicht in der grossen symbolischen Geste. Unter dem monumentalen Bogen über dem Bahnhofplatz öffnet sich der ebenerdige Zugang in die Bahnhofhalle. Die übersichtliche, fussgänger- und passagierfreundliche Erschliessung setzt sich als Prinzip durch die gesamte Anlage hindurch fort bis ins Parkhaus und ins Stadtviertel auf dem Hügel hinter dem Bahnhof.
Der Fall der Aussersihler Bahnviadukte (ab S.22) zeigt exemplarisch, dass sogar Kunstbauten solche Qualitäten entwickeln und räumlich wie symbolisch zwischen Bahn und Stadt vermitteln können. Man kann hier zwar nicht vom einen ins andere System umsteigen, doch die Viaduktanlage mit ihren über hundert Gewölben und rund zwei Dutzend Stahl- und Betonbrücken lässt sich teilweise begehen, und die Steinbögen werden bald wieder mit Ladeneinbauten gefüllt. Indem sie in geschwungener Linie durch die rasterförmige Blockrandbebauung im Zürcher Industriequartier schneiden, schaffen Wipkinger- und Letten-Viadukt neben, auf und unter sich eine ausserordentlich abwechslungsreiche Abfolge von Stadträumen. Als lebendiges Museum der Brückenbaugeschichte, als Zeugen der Stadtentwicklung, aber auch wegen ihrer starken Wirkung als Ort im Schnittpunkt der zwei Systeme Bahn und Stadt haben die Aussersihler Viadukte eine Bedeutung, die ihren Schutz und ihre Pfl ege als Baudenkmal ohne weiteres rechtfertigen.
Ruedi Weidmann
Inhalt
Wettbewerbe
Burgerheim in Burgdorf | Umbau in Solothurn | Markt in Koudougou |
Magazin
Faszinosum Natur | Weite Räume überspannen | Mit der RhB ins Tirol? | Umweltbaubegleitung weiterentwickeln
Das Brückenmuseum
Katja Hasche
Die Aussersihler Bahnviadukte sind nicht nur ein ingenieurtechnisches Denkmal. Nach ihrer Sanierung wird auch ihr städtebauliches Potenzial genutzt.
Der Rochen von Lüttich
Clementine van Rooden, Daniela Dietsche
Die Gleise und Bahnsteige von Lüttich werden künftig von einer filigranen Glas- und Stahlkonstruktion überspannt.
SIA
Blick nach vorne | Raumplanung erweitern|
«Umsicht Regards Sguardi» in Chur |
33. ZNO-Sitzung | Haftung für den Kostenvoranschlag
Produkte
Impressum
Veranstaltungen
Das Brückenmuseum
Die Aussersihler Bahnviadukte in Zürich sind mit ihren zahlreichen unterschiedlichen Brückentypen ein eigentliches Brückenmuseum und ein Denkmal erster Güte für die Technikgeschichte wie für die Stadtentwicklung Zürichs. Ihre Zukunft war lange ungewiss. Dank dem Entscheid der SBB für eine neue Durchmesserlinie vom Hauptbahnhof nach Oerlikon können sie erhalten bleiben. Ein Teil bleibt in Betrieb und wurde saniert, ein Teil wird als Fuss- und Radweg umgenutzt.
Die filigranen Stahlfachwerkbrücken, die sich im Zürcher Industriequartier über die Limmat schwingen, bilden mit den angrenzenden Fabrikgebäuden und der Topografie des Flussraums eine malerische industriehistorische Landschaft. Dass sie Teil einer Viadukt-anlage sind, die den Zürcher Hauptbahnhof mit Wipkingen und dem Tunnel nach Oerlikon verbinden, ist aufgrund der Verstädterung heute von der Strasse aus nur noch schwer ablesbar. Hingegen ist es im Zug als eindrückliche Passage über die Limmat und die Dächer des Industriequartiers erlebbar. Die Anlage umfasst das doppelspurige Wipkinger Viadukt und das niedrigere, einspurige Letten-Viadukt der ehemaligen rechtsufrigen Zürichseelinie, das heute als Fuss- und Veloweg dient. Zwischen Vorbahnhof und Heinrichstrasse verlaufen die beiden Viadukte parallel, anschliessend führen sie getrennt über die Limmat nach Wipkingen beziehungsweise in den Letten (Bild 14). Die Viaduktanlage wurde grösstenteils zwischen 1889 und 1898 unter der Leitung von Nordostbahn-Chefingenieur Robert Moser (1838–1918) von Tausenden Arbeitern, zwei Drittel davon Italiener, gebaut. Im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Seebahn ersetzte sie den Erddamm von 1856, dessen Lage noch am Verlauf der Röntgenstrasse ablesbar ist. Dieser hatte sich mit 12‰ als zu steil erwiesen (Viadukt 9.5‰) und behinderte das Wachstum der Stadt, da er nur im Bereich des Sihlquais Durchgänge aufwies (Bild 2).
Mit 940 bzw. fast 1000 m Länge bildeten die Aussersihler Viadukte über lange Zeit das längste zusammenhängende Brückenbauwerk des SBB-Streckennetzes. Die repräsentativen Ingenieursbauten entstanden damals auf dem unverbauten Sihlfeld. Die hohen Öffnungen sollten eine ungehinderte Entwicklung der Stadt unter dem Brückenwerk hindurch ermöglichen (Bild 4). Wie überall im 19. Jahrhundert veränderte der Eisenbahnbau die Stadt. Im Vorbahnhofsgebiet siedelten sich Fabriken an, die Massengüter verarbeiteten, und in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft entstanden Arbeiterquartiere mit ihrem typischen rechtwinkligen Strassenraster und ihrer dichten Blockrandbebauung. Die Aussersihler Viadukte durchschneiden diese Struktur schräg und in geschwungener Linie und schaffen so aussergewöhnliche Stadträume. Gemäss städtebaulichen Vorschriften wurden Wohnblöcke bis zu 7.5 m an die Viadukte herangebaut, Gewerbegebäude teilweise noch näher. Obwohl die Bögen ursprünglich durchgängig bleiben sollten, siedelte sich darin schon bald Gewerbe an. 1915 erlaubte ein Bauamtsbeschluss die Vermietung der Brückenbogenräume an Gewerbetreibende.
Drei Abschnitte
Die Aussersihler Viaduktanlage lässt sich in drei bauliche Abschnitte gliedern: Die Bogenbrückenkette in der Konterkurve über den Vorbahnhof stellte mit ihren markanten Parabelfachwerkträgern für viele Reisende eine Landmarke dar. 2004 wurden die Träger durch eine Stahl-Beton-Konstruktion ersetzt. Das S-förmige Kernstück des Viadukts bilden die steinernen Viaduktbögen zwischen Vorbahnhof und Limmat mit ihren 53 Öffnungen mit 103 Gewölben. Während die Bögen aus ästhetischen Gründen gemauert sind, wurden für die Überbrückung der sechs geplanten Quartierstrassen Parallelfachwerkträger mit oben und unten liegender Fahrbahn eingesetzt, zur höheren Sicherheit bei Entgleisungen mit durchgehendem Schotterbett (Bild 5). Den Flussraum der Limmat überspannten schliesslich zwei unterschiedliche Konstruktionen. Die engmaschige Gitterfachwerkträgerbrücke der Wipkinger Linie von 1856 wurde 1898 durch einen Parallelfachwerkträger mit doppelten Streben ersetzt (Bild 8). Die drei in allen Achsen geneigten Fachwerkbogenbrücken der Letten-Linie entstanden 1891–1894 (Bild 11). Eine Besonderheit ist einer der letzten Schwedler-Träger in der Schweiz, der die Letten-Linie über das Sihlquai führt. Bei dieser nach Ingenieur Johann Wilhelm Schwedler benannten Trägerform sind die Streben nur auf Zug belastet. Die ältesten noch vorhandenen Teile des Viadukts sind die Erddämme und die Brückenpfeiler der Wipkinger Linie beidseits der Limmat. Mit Baujahr 1855 gehören sie zu den ältesten Bahnbauten der Schweiz.
Sanierungsgeschichte
Während der über hundertjährigen Nutzung der Viaduktanlage wurden, namentlich zwischen 1931 und 1984, immer wieder Unterhalts- und Sanierungsarbeiten notwendig, vorwiegend an den Gewölben. Die Arbeiten standen im Spannungsfeld zwischen Gewährleistung der betrieblichen Sicherheit, Aufrechterhaltung des Fahrbetriebs und – in jüngster Zeit – Erhalt der historischen Bausubstanz. Auf Risse und Wasserdurchlass anfällige Mauerstellen wurden saniert und ganze Gewölbebereiche mit neuem Steinmaterial erneuert – unter anderem 1940 nach einem britischen Bombenangriff. Um das Mauerwerk vor eindringendem Regenwasser zu schützen, wurde 1939–1942 abschnittweise ein Betonüberzug als Abdichtung oberhalb des Gewölbemauerwerks angebracht. 1954 erfolgte im Zug einer Verbreiterung des Sihlquais der Ersatz des reparaturbedürftigen Hausteinviadukts von 1855 durch eine Beton-Plattenbalkenbrücke.
Umfassende Sanierungs- und Ausbaumassnahmen wurden erstmals im Rahmen des Projekts Bahn 2000 geplant. Für den beabsichtigten viergleisigen Ausbau des Bahnabschnitts zwischen Vorbahnhof und Oerlikon schrieb die Kreisdirektion 3 der SBB 1988 einen Totalunternehmer-Wettbewerb aus. 1993 wurde das Wettbewerbsprojekt etappiert. Der geplante neue Tunnel von Wipkingen nach Oerlikon entfiel, das Projekt beschränkte sich auf Ausbau und Sanierung der Anlage vom Vorbahnhof bis Wipkingen. 1997 erhielt das Siegerteam mit der Bauunternehmung Specogna, den Architekten Bétrix & Consolascio und dem Ingenieurbüro Rigendinger den Zuschlag für die Projektausführung. Doch da entstand im Quartier und auf politischer Ebene eine grosse Opposition gegen den vierspurigen Ausbau. Die SBB sahen schliesslich davon ab und planten stattdessen die neue Durchmesserlinie nach Oerlikon, deren Baubeginn für den Herbst 2007 vorgesehen ist. Das damalige Wettbewerbsprojekt wurde auf die Erneuerung der Vorbahnhofbrücken beschränkt; die Sanierung der übrigen Viaduktanlage wurde aus dem Projekt Bahn 2000 ausgegliedert und unabhängig davon durchgeführt.
Die Vorbahnhof-Brücken
Die Erneuerung der Vorbahnhof-Brücken wurde aus betriebstechnischen Gründen notwendig. Um im Rahmen des Projekts Bahn 2000 mehr Züge in kürzerer Zeit in den Bahnhof Zürich einschleusen zu können und getrennte Gleise für Schnellzüge und S-Bahnen zu schaffen, wurde eine neue Brückenanlage geplant. Diese sollte auf der Seite nach Wipkingen zweigleisig, auf der Seite des Hauptbahnhofs viergleisig ausgebildet sein und die Züge mit Hilfe einer komplexen Weichenanlage rasch verteilen. Aufgrund der das Stadtbild prägenden Wirkung der bestehenden Brücken sprach sich die städtische Denkmalpflege zunächst für deren Erhalt aus. Die zwölf Parabelträger aus Stahlfachwerk wurden jedoch bis auf die massiven Hausteinpfeiler abgetragen. Ein kleiner Rest ist heute im so genannten Kohlendreieck (Bild 14) aufgestellt. Die neuen Brückenelemente wurden als Verbundkonstruktion aus Stahl und Beton mit Auflagern auf die bestehenden Pfeiler gelegt. Sie bestehen aus drei konvergierend verlaufenden Stahlkastenträgern mit einem Betontrog, in dem das Schotterbett mit den Gleisen liegt. Die logistischen Herausforderungen an die Baustelle mitten im Gleisfeld des Vorbahnhofs waren gross. Die Bauzeit dauerte von 2000 bis 2004, die Kosten betrugen rund 120 Mio. Franken.
Sanierung des Wipkinger Viadukts
Die übrigen Teile des Wipkinger Viadukts wurde 2003–2006 saniert. Die Viaduktbauten sind im Schweizerischen Inventar der Kulturgüter als Objekte von regionaler Bedeutung bewertet. Im Inventar der kunst- und kulturhistorischen Objekte der Stadt Zürich sind sie als Objekte von kommunaler Bedeutung eingetragen. Neben der städtischen Denkmalpflege war auch die SBB-Fachstelle für Denkmalschutzfragen involviert. Es gab aus denkmalpflegerischer Sicht jedoch keine grundsätzlichen Einwände, da die Sanierung aus bahntechnischen und finanziellen Gründen auf die zwingend notwendigen Massnahmen reduziert wurde. Die Instandsetzung konzentrierte sich auf die Hausteinbereiche und die Stahlbrücken der Wipkinger Linie. Für deren Sanierung wurden sämtliche Gewerbe-Einbauten abgebrochen. Das bestehende Mauerwerk zeigte übliche Alterungserscheinungen wie verwitterte oder poröse Steine, ausgebrochene Fugen und Risse (Bild 9). Die Gewölbe und die unteren Bereiche der Pfeiler bis einen Meter über Terrain bestehen aus Lägern-Kalkstein, die oberen Pfeilerwände sowie die Seitenwände der Gewölbe aus Sandstein. Die Lager der Stahlbrücken sind bei den Widerlagern auf Granitquadern versetzt. Die Natursteinoberflächen wurden gereinigt und abgeklopft und im Fall von Schalenbildung zurückgearbeitet. Beim Ersatz von gänzlich verwitterten Steinen wurde auf die Verwendung adäquater Natursteine geachtet. Bei schadhaften und offenen Fugen musste das bestehende Fugenmaterial entfernt und mit Mauermörtel neu verfugt werden. Starke Risse mit Rissbreiten von mehr als 2 mm wurden mit Spezialmörtel gefüllt, um das Eindringen von Wasser in das Natursteinmauerwerk zu verhindern und die Verwitterung entlang den Rissflanken zu stoppen.
Strukturdynamische Untersuchungen der Empa zeigten, dass Pfeiler, die markante Vertikalrisse in Fugen und Steinen aufwiesen, in ihrem Tragverhalten beeinträchtigt waren. Bei den betroffenen Pfeilern wurde durch die Injektion von Feinstzement eine kraftschlüssige Verbindung zwischen den tragenden Quadern des Aussenmauerwerks und dem Füllmaterial der Kernmauerung hergestellt. Diese Massnahme betraf die acht Endpfeiler der Viaduktsektoren, die als Widerlager der Stahlbrücken über die Strassenöffnungen dienen, und 15 weitere Pfeiler. Zur Sicherung der stark belasteten Auflagerbänke der Stahlbrücken wurden zusätzlich unter jedem festen Brückenlager Zuganker eingebaut (Bild 10). Im Bereich des Schotterbetts stellten lose Randsteine ein Sicherheitsproblem dar. Die Granitblöcke, die ursprünglich durch ihr Eigengewicht hielten, waren im Lauf der Zeit durch das Gewicht der schweren Unterhaltsmaschinen immer weiter nach aussen gedrückt worden. Um sie zu sichern, wurden die Steine mit Armierungen verankert. Die teilweise gelockerten Geländer von 1896 stellten ebenfalls eine Gefahr für die Arbeiter des Gleisunterhalts dar. Die SBB-Fachstelle für Denkmalschutzfragen setzte sich für einen Erhalt der originalen Gusseisenpfosten ein. Bei einem Brückenersatz im Raum Schaffhausen wurden identische Pfosten sichergestellt und beim Wipkinger Viadukt als Ersatz für fehlende Geländerpartien wiederverwendet. Dabei wurden die heutigen Sicherheitsnormen berücksichtigt.
Sanierung der Stahlbrücken
Bei den Stahlbrücken wurden genaue statische Berechnungen und Spannungsmessungen vor Ort durchgeführt, um die zu erwartende Lebensdauer zu ermitteln. Die Sanierung der Limmatbrücke wurde daraufhin auf 30 Jahre ausgelegt, die der kleineren Stahlbrücken auf 20 Jahre. Bei der Limmatbrücke zeigte eine chemische Untersuchung, dass der alte Anstrich durch Schwermetall belastet war. Der bestehende Korrosionsschutz befand sich in einem schlechten Zustand und musste erneuert werden. Ferner wurden die oberen und die unteren Windverbände mit Stahl verstärkt. Um die strengen Vorschriften des Buwal einzuhalten und Emissionen zu vermeiden, musste die Brücke eingehaust werden. Die Arbeiter gelangten durch eine Schleuse in die hermetisch abgedichtete Baustelle. Um einen uneingeschränkten Fahrbetrieb der Züge zu gewährleisten, standen für Arbeiten im Bahnbereich jeweils nur die Nachtzeiten zwischen 1 und 4.30 Uhr zur Verfügung.
Bei den Stahlbrücken über Heinrich- und Limmatstrasse wurden ebenfalls Altlasten gefunden. Auch sie mussten für die Erneuerung des Korrosionsschutzes eingehaust werden. Einzelne Tragelemente der Stahlkonstruktion wurden verstärkt. Wesentlich unkomplizierter verlief die Sanierung der Stahlbrücken über Josefstrasse und Neugasse. Hier befand sich der Korrosionsschutz in akzeptablem Zustand und musste nur örtlich ausgebessert werden. Bei der Brücke über die Neugasse wurden einzelne Tragelemente verstärkt.
Insgesamt betrugen die Kosten für die Sanierung der Hausteinbereiche und Stahlbrücken rund 10 Mio. Franken. Erschwerende Bedingung war, dass die täglich auf dem Viadukt verkehrenden 450 Züge nicht behindert werden durften. Um die Betriebs- und Tragsicherheit des Viadukts für weitere 50 Jahre zu gewährleisten, sind bereits für 2020 weitere Massnahmen vorgesehen. Da der Bahnverkehr zu diesem Zeitpunkt zumindest teilweise auf die neu erstellte Durchmesserlinie umgeleitet werden kann, besteht dann die Möglichkeit, die schadhafte, 1939–1942 eingebaute Abdichtung unterhalb des Schotterbetts zu erneuern. Eine neue Abdichtung soll das anfallende Regenwasser, das bisher in das Mauerwerk sickert und zu Frostbildung und oberflächlichen Steinabplatzungen geführt hat, ableiten. Ob und wann die Stahlbrücken ersetzt werden müssen, ist noch offen. Laut SBB ist die Lebensdauer von Brückenbauwerken generell auf 100 Jahre ausgelegt. Wie genügend Beispiele belegen, kann sie jedoch durch Sanierungsmassnahmen und Verstärkungen signifikant verlängert werden.
Die Zukunft im und auf dem Viadukt
Gemeinsam mit SBB Immobilien schrieb die Stadt Zürich einen Wettbewerb für die Neunutzung der Viaduktbögen als Ersatz für die abgebrochenen Einbauten und für eine landschaftlich gestaltete Fortsetzung des Fuss- und Velowegs auf dem Letten-Viadukt aus. Das im Sommer 2004 ausgewählte Wettbewerbsprojekt von EM2N Architekten und Zulauf, Seippel, Schweingruber Landschaftsarchitekten (heute: Schweingruber Zulauf) soll zwischen Frühling 2008 und Ende 2009 realisiert werden (Bild 15). Die Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich (PWG) hat die Einbauten in Letten- und Wipkinger Viadukt im Baurecht übernommen. Zwischen Heinrich- und Geroldstrasse entstehen für 32 Mio. Franken rund 38 Laden-, Atelier- und Gewerberäume und im Spickel der beiden Viadukte an der Limmatstrasse Zürichs erste Markthalle.
Das Letten-Viadukt wird seit Eröffnung der S-Bahn 1990 nicht mehr von der Bahn genutzt. Das Trassee entlang des Wasserwerkkanals entwickelte sich zum Eidechsenparadies und dann zum Treffpunkt der offenen Drogenszene. 1995 wurde das Gebiet polizeilich geräumt. Um es rasch mit einer neuen Nutzung zu besetzen, wurde es der Badeanstalt am Ufer gegenüber zugeordnet. Unter Einbezug der Quartierbewohner entwickelten die Landschaftsarchitekten Rotzler Krebs Partner 2002 ein Freiraumkonzept, das den improvisierten Charakter des Gebiets betont und zwei Nutzergruppen gerecht werden soll: Erholungssuchenden und Eidechsen. Der östliche Teil bleibt mit Bahnschotter bedeckt und Pflanzen und Tieren vorbehalten. Für Badegäste stehen anschliessend Liegewiesen und Beachvolleyballfelder zur Verfügung. Lange Sitzstufenanlagen und dicht bepflanzte Bänder aus mehrstämmigen Birken schieben sich aneinander vorbei und erinnern an die Dynamik der ehemaligen Gleisanlagen. Das Trassee beim Bahnhof Letten gestalteten die Landschaftsarchitekten als Fuss- und Fahrradweg und führten ihn auf der Bahnbrücke über die Limmat (Bild 12). Die Brücke war schon 1998 ins Eigentum der Stadt übergegangen, auf den übrigen Teilen des Letten-Viadukts räumten die SBB der Stadt ein Fuss- und Fahrwegrecht ein. 2008/09 soll der Weg gleichzeitig mit den Einbauten quer über das gesamte Industriequartier verlängert werden. Vor einer ungewissen Zukunft steht der alte Bahnhof Letten samt Umschwung. Die Stadt möchte ihn der SBB abkaufen, um das Erholungsgebiet zu sichern, und ein als Bauzone ausgewiesener Bereich reizt zum Verdichten. Konkrete Planungen liegen noch nicht vor. Über den Kauf wird der Gemeinderat voraussichtlich noch dieses Jahr entscheiden.
Alles in allem bilden die Aussersihler Viadukte ein in der Schweiz einzigartiges Denkmal für den Eisenbahnbau, sowohl für die Ingenieurkunst in seinem Dienst als auch für die Stadtentwicklung in seiner Folge. Die Viadukte schaffen einmalige stadträumliche Qualitäten im Zürcher Industriequartier, deren Potenzial heute erkannt ist und durch die neuen Mieter in den Bögen endlich auch genutzt und besser zur Geltung kommen wird.TEC21, Mo., 2007.09.24
24. September 2007 Katja Hasche
Der Rochen von Lüttich
Zur neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Brüssel und der deutschen Grenze gehören zahlreiche Kunstbauten und der neue TGV-Bahnhof in der belgischen Stadt Lüttich. Eine monumentale, aber filigrane Konstruktion aus Glas und Stahl von Santiago Calatrava wird ab 2008 die Gleise überspannen.
Heute nutzen täglich 35 000 Menschen die Infrastruktur des Bahnhofs Liège-Guillemins. Künftig werden 50 000 Personen erwartet. Gemäss einer Machbarkeitsstudie von 1995 genügt der bestehende Bahnhof den Anforderungen an die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke nicht. Durch einen international ausgeschriebenen Wettbewerb suchte die Euro Liège TGV SA eine Idee für ein modernes, multifunktionales Reisezentrum als Nahtstelle zwischen Bahn und Passagier. Lange, gerade Bahnsteige, die das Einfahren der Züge in den Bahnhof und das Ein- und Aussteigen für die Passagiere erleichtern, sollten die hohen Anforderungen an die Geschwindigkeit, die Erreichbarkeit, den Passagierkomfort und die Sicherheit erfüllen. Den Wettbewerb für den Entwurf des neuen TGV-Bahnhofs in Lüttich gewann 1997 das Architektur- und Ingenieurbüro von Santiago Calatrava. In Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Greisch aus Belgien baut es gegenwärtig den neuen Bahnhof.
Fussgänger auf drei Ebenen
Aus der Stadt kommend, betreten die Reisenden einen weitläufigen Vorplatz. An dessen Ende überspannt ein riesiger Bogen die Bahnhofsfront und bildet den grosszügigen Eingangsbereich. Der Bahnhof kann von beiden Seiten betreten werden, sodass die zerschneidende Wirkung der Gleise aufgehoben wird. Auf der gesamten Breite gelangen die Reisenden ebenerdig in den Bahnhof und erblicken auf der linken Seite das Reisezentrum und die Fahrkartenschalter. Rechts hingegen bietet sich Infrastruktur zum Verweilen an: eine Bar, ein Restaurant sowie Läden und Warteräume. Auf dem Niveau über dem Reisezentrum liegen die Gleise und Bahnsteige. Von den 13 Bahnsteigen des alten Bahnhofes bleiben neun erhalten. Dazu kommen fünf neue, 8 m breite und grosszügig ausgestaltete Plattformen. Drei davon, 450 m lang, werden zukünftig eine Doppeleinheit des TGV aufnehmen können. Auf der dritten Ebene erlauben zwei Passerellen das Queren zwischen den Perrons und den ebenerdigen Austritt in das höher gelegene Quartier hinter dem Bahnhof. Alle drei Ebenen sind durch Treppen, Rolltreppen und Glasaufzüge verbunden, sodass sich die Passagiere mühelos im ganzen Bahnhof bewegen können. Das erste Gleis kann gar direkt vom Vorplatz aus erreicht werden.
Kräftefluss im Skelett
Über den Gleisen und den Bahnsteigen wölbt sich in Längsrichtung ein Dach, das den neuen Bahnhof prägt. Die monumentale, aber doch filigrane Konstruktion aus Glas und weissem Stahl überdeckt die Gleise und die gesamte neue Infrastruktur der Anlage. Sie lebt von ihrem organischen Erscheinungsbild und hat keine Fassade im klassischen Sinn. Das statische System scheint komplex, ist im Grunde aber einfach. Die insgesamt 39 Bogen aus Stahl sind im Abstand von 1.92 m parallel angeordnet. Am Rand sind sie während der Bauphase mit Verbänden gegeneinander ausgesteift. Als hohle Blechträger konstruiert, haben die Stahlbogen über ihre Länge einen variablen Querschnitt und eine statische Höhe von bis zu 1.20 m. Mit einem Auflagerabstand von mehr als 157 m und einer Scheitelhöhe von 35 m über Terrain weist das Bauwerk eine beeindruckende Grösse auf. Dementsprechend gross sind die Lasten, die diese Tragstruktur aufnimmt und ableitet. Doch nicht die Belastung bestimmte die Dimensionierung der Tragkonstruktion, sondern die nötige Begrenzung der Verformungen, die durch die Glasverkleidung des Daches gegeben sind. Das komplexe Verhalten, vor allem infolge der Windeinwirkungen, konnte mit einem dreidimensionalen Finite-Elemente-Programm analysiert werden. Die sich aus den Berechnungen ergebenden Beanspruchungen und Verformungen wurden schliesslich in Windkanalversuchen verifiziert. Die Bogenenden sind auf Stahlträgern am Rand der Passerellen gelagert. Von dort aus fliessen die Kräfte in je fünf Auflager. Diese sind als Vierfüsser und gänzlich aus Stahl konstruiert. Allseitig unverschiebbar, aber in Bogenachse gelenkig, geben die Auflager die Reaktionen in die Betonfundamente ab. Mit dieser Auflagersituation kann die Steifigkeit des Daches in Längsrichtung erreicht werden. In Querrichtung wird die Aussteifung durch die geneigten Bogen der zwei Vordächer sichergestellt. Vier Stahlbogen, die diese Seitendächer stützen, sind wiederum in einem weissen, dreibeinigen Betonsockel verankert. Beide auskragenden Seitendächer (Casquettes genannt) sind mit dem gesamten zentralen Hauptdach verbunden und lassen das Bahnhofsgebäude wie einen Rochen aussehen, der sich mit seinen zwei Flügeln (Vordächer) und fünf Schwänzen (Bahnsteige) an den Hügelhang schmiegt.
Verknüpfung mit dem Strassennetz
Das Vordach auf der Rückseite überspannt das dreistöckige Parkhaus am Fusse des Hügels von Cointe. Es wird durch eine Brücke und eine Überführung direkt an die Autobahn angeschlossen. Diese Zufahrt wird nach der Fertigstellung des Bahnhofs eröffnet. Für das Parkhaus musste der Hügel auf einer Länge von rund 200 m abgetragen werden. Dafür wurden präzise Voruntersuchungen gemacht, denn die Stabilität einiger Erdschichten in diesem Bereich ist prekär. 1950 lösten hier die Erschütterungen des Zugverkehrs einen Hangrutsch aus. Fachspezialisten aus der Geologie und der Vermessungstechnik entschieden sich, die Baugrube mit einer Pfahlwand zu sichern. Dazu wurden armierte Betonpfähle mit einem Durchmesser von 1.50 m verwendet. Jeder einzelne Pfahl wurde rückverankert. Die Anker wurden etappenweise alle 3 m gesetzt, bis die Baugrube eine Gesamttiefe von 18 m erreichte. Um den Wasserdruck hinter der Pfahlwand abzusenken, legten die Planer Pumpensümpfe im Fussbereich der Pfahlwand an. Nach dem Errichten des Parkhauses verlieren die temporären Anker ihre Funktion. Sie werden im Erdreich belassen und bauen allmählich ihre Zugkraft ab. Die neue Tragstruktur des Parkhauses übernimmt sukzessiv den anfallenden horizontalen Erd- und, nach dem Abstellen der Pumpen, auch den Wasserdruck.
Organische Struktur aus Weissem Sichtbeton
Das grosszügige Dach aus Stahl und Glas prägt den Bahnhof. Doch darüber hinaus werden im Gebäude auch 65 000 m³ armierter Beton verarbeitet. Für das Parking werden 28 000 m³ verwendet, für die zentrale Passage und Technikkorridore unter den Gleisen 17 000 m³, für die Haupthalle noch einmal 13 000 m³ und schliesslich 13 000 m³ für zwei Retentionsbecken, die das Wasser der 33 000 m² grossen Dachfläche aufnehmen. Alle massiven Bauteile, die für die Passanten sichtbar sind (etwa 23% der gesamten Betonmenge), werden aus weissem Sichtbeton erstellt. Das Planerteam stellte dafür hohe Anforderungen und verlangte strenge Qualitätskontrollen. Spezialisten bestimmten die Eigenschaften der Schalung, den Wassergehalt, die Zusätze und die Vibrationsdauer bei der Verarbeitung des Betons. Mit mehr als hundert Betonproben auf der Baustelle kontrollierten sie alle Anforderungen.
Zahlreiche Oberflächen der Betonbauteile sind gekrümmt und präsentieren sich als organische Formen. Gebogene Träger und geschwungene Stützen, die an Knochen eines Skelettes erinnern, tragen in den Innenräumen die Kräfte ab. Wenn der Reisende im Bauch des Rochen zu den Gleisen eilt oder durch die Ladenzone schlendert, wird er aber von der Struktur nicht erdrückt. Im Gegenteil, was tatsächlich schwer und statisch ist, erscheint leicht und dynamisch.
Bestehender Bahnhof
Die letzten Arbeiten am neuen Bahnhof werden voraussichtlich bis Anfang 2009 ausgeführt. Sie beinhalten die Verglasung des Daches, die gesamte Haustechnik, die Beleuchtung und die Bahninfrastruktur (Signaletik), die Ausbauarbeiten (Läden, Schalterhallen, Büros) sowie die Umgebungsgestaltung. Bis dahin darf der Zugverkehr, wie schon während der gesamten Bauzeit, nicht unterbrochen werden. Dies erforderte verschiedene Bauphasen und die Aufrechterhaltung des Betriebs des benachbarten alten Bahnhofs. Bis vor wenigen Wochen hielt der alte Bahnhof mit der Hälfte seiner früheren Kapazität den Bahnbetrieb aufrecht, nun ist er abgebrochen. An seiner Stelle wird der Rochen mit fünf Schwänzen diese Funktion übernehmen.TEC21, Mo., 2007.09.24
24. September 2007 Clementine Hegner-van Rooden, Daniela Dietsche