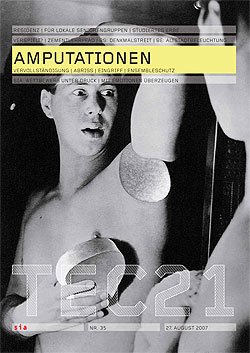Editorial
In «Brüchige Tage» beschreibt der Autor Philippe Besson die letzten Tage im Leben von Arthur Rimbaud. Aus der Perspektive seiner Schwester Isabelle, die er in ein fiktives Tagebuch kleidet, versucht Besson, die Qualen des «poète maudit» einzufangen: das seelische Leiden an der Welt, das ihn zeitlebens trieb, und das physische an der Krankheit, die ihn nun, in den letzten Monaten seines Lebens, ans Bett fesselt.
Das Thema der Amputation ist in dem Buch omnipräsent. Die Geschwulst am Knie, die wuchert, bis das Bein amputiert werden muss: Der physische Eingriff wird zum Sinnbild für den Verlust der Bewegungsfreiheit. Die Fluchten vor dem bigotten Elternhaus, die den Dichter bis nach Afrika verschlugen, sind ihm nun verwehrt. Er ist in seinem Körper gefangen.
Eindringlicher sind die Schilderungen seines Siechtums aus Rimbauds eigener Feder: «Montagmorgen wird mein Bein amputiert. TODESGEFAHR... (...) Ich habe ein Holzbein bestellt, es wiegt nur zwei Kilo, es wird in 14 Tagen fertig sein... (...) Was für eine Langeweile, was für eine Erschöpfung und Trauer, wenn ich an die früheren Reisen denke... Wo sind die Bergüberquerungen, die Gewaltritte, die Streifzüge, die Wüsten, Flüsse und Meere? Und jetzt das Leben eines BETTLER-ARSCHS! Denn ich beginne zu begreifen, dass Krücken, Holzbeine und mechanische Beine Verarschungen sind... Mein Leben ist vorbei, ich bin nichts als ein unbeweglicher Stummel...»[1]
Diametral entgegengesetzt empfindet Rimbauds Schwester Isabelle. Für sie sind die Fliehbewegungen Rimbauds die Amputation: «Weggehen ist eine Entwurzelung, eine Art Amputation. Mit allem zu brechen, ist eine Gewalttat. Wenn man sein Vaterland verlässt, verliert man zwangsläufig einen Teil von sich.»[2]
Tel quel übertragen lässt sich das nicht auf die Architektur. Und doch: Ohne sich von Bauwerken zu verabschieden, Amputationen eben an einem Stadtkörper vorzunehmen, ist kein Fortkommen. Würden Bauten nicht amputiert, würden wir feststecken in der Vergangenheit. Amputationen schaffen Raum für die Weiterentwicklung, verhindern die Musealisierung, wenn nicht gar die Mumifizierung einer Stadt. Doch wenn die Abrissbirne einen Lebensnerv trifft, das Glied abstirbt und durch eine Prothese ersetzt wird, «ein KUNST-Bein, das nicht einmal passt» (um wieder mit Rimbaud zu sprechen)[3], beraubt uns das der «Gedächtniskomponente» – ein treffender Begriff aus dem Fachartikel «Rekonstruktion als Ensembleschutz».
In «Eingriff als Schrumpfung» wird thematisiert, wie der Zürcher Platzspitzpark nach und nach dezimiert wurde. Die heilsame Wirkung des Phantomschmerzes wird in «Abriss als Initialzündung» dokumentiert, und «Rückbau als Vervollständigung» ist ein Plädoyer dafür, eine Prothese zu entfernen, statt den ganzen Baukörper zu ersetzen.
Rahel Hartmann Schweizer
Inhalt
Wettbewerbe
Residenz | Für lokale Seniorengruppen | Studiertes Erbe
MAGAZIN
Verspieltes Kunstgedächtnis? | Zementlehrpfad im Geopark Breggia | Reha-Klinik fördert Biodiversität | Basel: Denkmalstreit am Messeplatz | Sachsen: Steinzeitbrunnen entdeckt | Bern: Altstadtbeleuchtung saniert
Vervollständigung
Michael Hanak
Der Rückbau des Kongresshauses in Zürich würde den Bau in seiner ursprünglichen architektonischen Konzeption rehabilitieren.
Abriss als Initialzündung
Christian Holl
Nachdem das Kulturforum abgerissen worden war, klaffte in Köln jahrelang ein Loch. Kulturschaffende sprangen in die Lücke.
Eingriff als Schrumpfung
Eeva Ruoff
Städtische Parkanlagen werden oft als Baulandreserve behandelt. Exemplarisch illustriert der Zürcher Platzspitzpark den Schrumpfungsprozess.
Ensembleschutz
Christian Kammann
Die Münchner Studentenwohnlage «Oberwiesenfeld» ist denkmalgeschützt und doch nicht sanierbar. Die Rekonstruktion schützt das Ensemble.
SIA
Wettbewerb unter Druck | Mit Emotionen überzeugen | Absage für Tag der offenen Tür
Produkte
Impressum
Veranstaltungen
Rückbau als Vervollständigung
Das Kongresshaus in Zürich soll einem Neubau weichen. Dagegen regt sich in Fachkreisen und in der Bevölkerung massiver Widerstand. Es erscheint unverständlich, einen hochkarätigen Zeugen der Architekturgeschichte zu opfern, der weitgehend intakt erhalten ist. Ein Problem sind allerdings die nachträglichen Zu- und Umbauten, die das ursprüngliche architektonische Konzept stören. Diese könnten jedoch zurückgebaut, die Qualitäten des Bauwerks wieder freigelegt werden.
Es braucht etwas Vorstellungskraft, sich den dunkelbraunen Saalaufbau wegzudenken und im zugebauten Hof den vermittelnden Leerraum zu sehen. Die Unscheinbarkeit des Äussern und die Betriebsamkeit im Innern täuschen über die Qualitäten des Gebäudes hinweg. Bei genauerer Betrachtung der Originalsubstanz steht fest: Das Kongresshaus in Zürich ist ein schweizweit erstrangiges Bauwerk. Die Qualität der Architektur überzeugt noch heute, trotz baulichen Umwandlungen und fast 70 Jahren intensiver Nutzung.
Das Zürcher Kongresshaus entstand im Hinblick auf die Landesausstellung von 1939 und verkörpert – wie kein anderer Bau in der Schweiz – den Wandel der Moderne, den der Zweite Weltkrieg und das verstärkte Nationalbewusstsein im architektonischen Schaffen mit sich brachten. An den Ausstellungsbauten der «Landi» kündigte sich hierzulande ein Umdenken an: weg von den radikalen, kategorischen Grundsätzen des Neuen Bauens, hin zu einer moderateren, aufgelockerten baulichen Umwelt. Als Gegenbewegung zur damaligen Globalisierung in der Architektur, die nach der Ausstellung in New York 1932 «International Style» genannt wurde, zeichnete sich die Tendenz zur regionalen Rückbesinnung ab.
Die Bauten des Architekturbüros von Max Ernst Haefeli, Werner Moser und Rudolf Steiger machen diese Entwicklung vom Neuen Bauen zur Nachkriegsmoderne gut sichtbar, ja sie nahmen sie vorweg. Bereits die ab 1930 realisierte Werkbundsiedlung Neubühl in Zürich, der wichtigste Beitrag des Neuen Bauens in der Schweiz, war mit seinen Vordächern nicht so radikal wie seine streng kubischen Vorbilder. Am während und nach dem Zweiten Weltkrieg ausgeführten Kantonsspital Zürich wurden mit der städtebaulichen Figur und den Materialkombinationen (Stein, Holz, Putz) viele Themen deutlich, die in den 1950er-Jahren und darüber hinaus den Diskurs prägten.
Weiterbauen
Das 1937–1939 gebaute Kongresshaus markiert den Wendepunkt zwischen früher und später Moderne. Grossflächige Fensteröffnungen, gekonnte Lichtführung, fliessende Raumverbindungen stehen im Zeichen des Neuen Bauens. Ornamentale Detailgestaltungen und traditionelle Handwerkstechniken formulieren eine spezifisch schweizerische Architektursprache. Die wohl höchste Qualität, welche die Architekten Haefeli, Moser und Steiger am Kongresshaus-Komplex erzielten, liegt in der Kombination der bestehenden Tonhalle mit dem dazugebauten Kongresshaus. Alt und Neu sind zu einer Einheit verbunden. Im Wettbewerb von 1936 waren weder Abbruch noch Erhalt der Tonhalle vorgeschrieben. Das Siegerprojekt liess sie stehen, riss den vorgebauten rotundenartigen Pavillon mit den Türmen ab und setzte an seine Stelle die genial verschränkte Erschliessung zwischen den alten und den neuen Sälen. Während der Ausführung «neutralisierte» man die historistische Baugestaltung von 1892; Gipsverzierungen wurden entfernt und ruhigere Farben gewählt. Die alte Tonhalle ist in das neue Ganze eingepasst und mit der neuen Kongresshausarchitektur gleichsam «verschliffen» worden. Gleichwohl sind beide Seiten klar voneinander getrennt, ja in den Materialien auf eine Kontrastwirkung angelegt.
Umbauten und Aufbauten
Nach seiner Inbetriebnahme wurde das Kongresshaus allmählich immer reger benutzt, und bald standen betriebliche Anpassungen an. Haefeli Moser Steiger bauten in den 1940er- und 1950er-Jahren das Untergeschoss aus, die Küche und die Bühne um und stockten den Officetrakt längs der Beethovenstrasse um ein Geschoss auf. Die darauf folgenden Umbau- und Sanierungsarbeiten wurden an Rudolf Steigers Sohn Peter übertragen. Dieser hatte bereits 1947/48 im Büro von Haefeli Moser Steiger den schwierigen Einbau des Weinkellers unter der Tonhalle ausgeführt; dabei hatte sich übrigens gezeigt, dass sich die Fundamente des Auftriebs wegen von den Holzpfählen abgehoben hatten! An Stelle des Weinkellers wurden Ende der 1970er-Jahre die Musikergarderoben eingebaut. Ein aussen angefügter gläserner Treppenturm – der inzwischen wieder entfernt wurde – verband diese mit den darüber liegenden Aufführungssälen.
Der Bereich zwischen Kongresshaus und Tonhalle wurde intensiv benutzt und schien bald zu klein. Vor allem der Kongressbetrieb benötigte mehr Raum. Mitte der 1970er-Jahre verfasste das Büro Steiger Partner im Auftrag der Stadtbaumeisters eine Studie zu möglichen Erweiterungen. Diese ergab, dass ein losgelöster Annexbau auf einem Nachbargrundstück vom Saal zu weit entfernt wäre und die räumlichen Konflikte der beiden Parteien nicht lösen könnte. Daher kam man mit der Direktion überein, mit einem Umbau die betrieblichen Engpässe und Überschneidungen zu beheben. Zu jener Zeit löste der Umbaukredit des Opernhauses von 60 Mio. Franken die Jugendkrawalle von 1980 aus. Daher schien für die Sanierung des Kongresshauses den Politikern nur ein Kredit von unter 40 Mio. Franken vertretbar. In der Volksabstimmung 1981 wurde das Projekt angenommen. Der Tonhallesaal wurde renoviert, ebenso die Fassaden. Doch dann wollte der neue Kongresshausdirektor einen Nightclub und ein Casino einbauen lassen, was im Kostenvoranschlag nicht vorgesehen war. Dazu mochte Peter Steiger nicht Hand bieten – nicht zuletzt, weil der Raum dazu fehlte. Der Auftrag ging an die Generalunternehmung Göhner AG und das Atelier WW / Wäschle Wüst. Es kam zu Kostenüberschreitungen von rund 25 Mio. Franken (nach Abzug der Teuerung), wovon 11 Mio. auf nachträgliche Projektänderungen zurückzuführen waren. Banken und Grossunternehmen gründeten die Kongresshaus Betriebs AG und finanzierten die zusätzlichen Kosten. Der verantwortliche Stadtrat Hugo Fahrner musste sich einer parlamentarischen Untersuchung stellen und wurde nicht wiedergewählt.
Die 1981 bis 1985 erfolgten Umbau- und Erweiterungsarbeiten griffen an wesentlichen Stellen in die bestehende Baustruktur ein – eine Operation am lebenden Körper. Am Ende des Kongressvestibüls, das beide Zugangsseiten transparent miteinander verband, wurde das Spielcasino implantiert. In den angrenzenden Gartenhof wurde ein Tagungszentrum eingefüllt. Der geschwungene Treppenarm in den Garten, ein Werk von Ingenieur Robert Maillart, wurde kurzerhand abgeschnitten. Auf den Gartensaal, wo die Terrasse war, setzte man den so genannten Panoramasaal, der wie eine Prothese als Fremdkörper erkennbar ist. Mit diesen Eingriffen wurden Ausblick, Aussenbezüge, Lichteinfall und innenräumliche Transparenz teilweise verbaut.
Rückbau
An der Stelle des Kongresshauses und auf dem angrenzenden Grundstück plant die Stadt Zürich zusammen mit privaten Eigentümern ein neues Kongresszentrum, das ein architektonisches Wahrzeichen werden soll. Das aus dem Wettbewerb hervorgegangene Projekt von Rafael Moneo liegt überarbeitet vor. Um es realisieren zu können, hat die Baudirektion das Kongresshaus aus dem Inventar der schutzwürdigen Bauten entlassen. Begründet wird der Verzicht auf die definitive Unterschutzstellung mit einer Interessenabwägung: Die heute betrieblich unbefriedigende Situation soll mit einem zukunftsweisenden Projekt gelöst werden. Das 2003 erstellte Gutachten der kantonalen Denkmalpflegekommission bezeichnet Tonhalle und Kongresshaus hingegen als Schutzobjekte von kantonaler Bedeutung und als «Baudenkmäler von hohem Rang»: «Das Kongresshaus weist in seiner volumetrischen und räumlichen Gliederung, in der Gestaltung der Fassaden und in der Ausstattung des Innern nach wie vor jene charakteristischen Qualitäten auf, die seinen Denkmalwert begründen.» Die jüngst erschiene Baumonografie dokumentiert den ursprünglichen Zustand und die historischen Hintergründe (siehe Kasten). Ausserdem ist die originale Bausubstanz etwa zu 90 Prozent erhalten. Damit liegen triftige Gründe vor, das Kongresshaus zu erhalten und auf seine ursprünglichen Qualitäten zurückzubauen. Die misslungenen Eingriffe der 1980er-Jahre lassen sich entfernen. Es wäre eine Amputation, die keine Leerstelle, keine offene Wunde lassen, sondern – im Gegenteil – den ursprünglichen Baukörper wieder vervollständigen würde. Es würde dem Kongresshaus seine konvergente äussere Erscheinung zurückgegeben. Die innenräumlichen Öffnungen und Durchdringungen würden wieder erlebbar. Vom Kongressfoyer würde man den See sehen.
Teilabbruch, Zubau, Umstrukturierung: Das Kongresshaus durchlief einen skandalösen Prozess der Abwertung und Verunstaltung. Die adäquate denkmalpflegerische Massnahme ist in diesem Fall der Rückbau. Vielleicht liesse sich in subtiler Weise weiterbauen. Geschichte braucht Anschauungsbeispiele, erst das exemplarische Bauwerk macht die architekturhistorische Entwicklung fassbar. Und wie kann in der Gegenwart Grossartiges entstehen, wenn wir solches aus der Vergangenheit nicht ehren? – Das Schlüsselobjekt der Schweizer Architektur muss erhalten bleiben.TEC21, Mo., 2007.08.27
27. August 2007 Michael Hanak
Eingriff als Schrumpfung
Die überbaute Fläche unseres Landes nimmt stetig zu. Jede Sekunde wird ein weiterer Quadratmeter überbaut. Parkanlagen hingegen wachsen nicht – im Gegenteil: Sie neigen zum Schrumpfen. Insbesondere wenn sie im Zentrum einer Stadt liegen, werden sie gern als Manövriermasse behandelt, als Baulandreserve. Exemplarisch illustriert dies der Zürcher Platzspitzpark.
Wenn eine Strasse verbreitert werden muss, das Tram eine Wendeschleife braucht oder Parkplatzbedarf herrscht, sind Grünanlagen willkommene «Leerräume». Es wird von vielen Leuten gar nicht mehr verstanden, dass ein Park mehr ist als ein Grünareal: eine künstlerische Gestaltung, in der Freiflächen, Baumgruppen und andere Elemente in einem wohlbedachten Verhältnis zueinander stehen und verschiedene Räume bilden. Welche Sichtachsen geöffnet wurden, ist nicht zufällig. Die Wahl der Bäume und Sträucher erfolgte beim gut gestalteten Park aufgrund ihrer Farbe bzw. des Farbenspiels in den verschiedenen Jahreszeiten, ihres Habitus’ und der Grösse, die sie erreichen. Wird von einem Park ein Stück weggeschnitten oder ein Raum überstellt, geht meist der Wert des Ganzen verloren und bei der historischen Anlage auch zu wenig gewürdigtes Kulturdenkmal.
Schiessplatz und Vergnügungsort
In Spätmittelalter diente das grosse, offene und teilweise mit mächtigen Bäumen bestandene Areal, das von der Schützengasse / dem Beatenplatz bis hinab zum «Spitz» reichte, als Schützenplatz und Viehweide, aber auch als allgemeiner Belustigungs- und Erholungsort der Zürcher. In den 1670er-Jahren wurde mit der Gestaltung der Flussufer begonnen. Auf Kosten der Schützengesellschaft wurden längs der Limmat und der Sihl lange Lindenalleen gepflanzt. Ferner kamen noch zwei kleine «Lust-Wäldgen», die mit Bänken versehen waren, hinzu. Die Bewohner der kleinen, von Befestigungsringen umgebenen, eng bebauten Stadt bekamen damit eine Promenade, an der die barocke Freude an Form und Ordnung im Grünen so schön zum Ausdruck kam wie in den europäischen Grossstädten. Zu Recht waren die Zürcher sehr stolz darauf. J. C. Fäsi stellte in seinem Werk «Der Canton Zürich» 1765 fest, der Schützenplatz «dienet dermalen zu einem allgemeinen Spazier-Plaze. Seine Lage, zwischen beyden Flüssen der Limat und der Sil, macht ihn hier ausnehmend angenehm ... Gereisete Personen versichern, dass ähnlich prächtige Spaziergänge in Europa nur in kleiner Anzahl anzutreffen seyn.»1
Der Park im Spitz
Um 1780 wurde der eigentliche, etwa drei Hektar grosse «Spitz» nach den Plänen des Schanzenherren Johann Caspar Fries zu einem regelrechten Park ausgestaltet. Längs der bogenförmigen Grenze zwischen dem Park und dem Schützenplatz wurde eine Reihe der damals in der Schweiz noch neuen und vielbewunderten Rosskastanien gepflanzt. Die Bodenverhältnisse sagten ihnen zu, und sie wuchsen zu ausgesprochen schönen Bäumen heran. Berichte aus dem letzten Jahrhundert belegen, dass die Bevölkerung grosse Freude an ihnen hatte. Schanzenherr Fries war offen für neuartige Ideen. Gemäss der Abwechslung und Naturverehrung, die den Befürwortern der englischen Landschaftsgärten so wichtig schienen, liess er im Platzspitz nebst den Laubbäumen selbst Tannen und Lärchen setzen, was eine radikale Abweichung von der damals üblichen Baumwahl für Promenaden war.
Den Höhepunkt der mondänen Gestaltung bildete schliesslich die Erstellung des Denkmals für Salomon Gessner im Jahr 1790. Es steht noch immer an seinem alten Platz, allerdings ohne die Bepflanzung, die ihm ursprünglich mehr Gewicht verlieh. Die Kosten des Monuments wurden von seinen Verehrern übernommen. Das Denkmal war auch eine gute Werbung für die Stadt Zürich, genoss doch Gessner dank seiner «Idyllen» einen europäischen Ruf wie kaum ein anderer Zürcher vor oder nach ihm. Die zahlreichen Kupferstiche vom Monument im Platzspitz zeugen von der nochmals stark auflebenden Gessner-Verehrung in den kulturell interessierten Kreisen Europas.
Wegen Missernten und hohen Lebensmittelpreisen richtete man auf dem nördlichen Teil des Schützenplatzes im Jahr 1790 Kleingärten ein, die den städtischen Armen für die Selbstversorgung zur Verfügung gestellt wurden. Der südliche Teil blieb nach wie vor den Schiessübungen vorbehalten, bis diese um 1860 ins so genannte Sihlhölzli verlegt wurden. Der erste Bahnhofbau war schon vorher auf dem südlichen Teil des Kleingartenareals erstellt worden. Die restlichen Pflanzplätze waren danach umso begehrter, aber sie gaben Anlass zu Beschwerden wegen des Düngergestanks.
Der Stadtrat, der Klagen müde, vermietete dann das Gelände 1854 kurzerhand einem Augsburger Geschäftsmann, der dort eine Gasfabrik erstellen liess. Der Vertrag war allerdings für die Stadt ungünstig. Als er ablief, liess der Stadtrat eine neue Gasfabrik im Industriequartier bauen. Die Verlegung der Fabrik kam dem Platzspitzpark sehr zugute.
Obwohl nicht gleich an seiner Grenze stehend, war die Fabrik keine Augenweide und verbreitete unangenehme Geruchsbelästigungen.
Überschwemmungen der Sihl hatten immer wieder Schäden am Park verursacht, vor allem Uferrutschungen. Besonders die Allee längs der Sihl hatte öfters sehr gelitten, und der Stadtgärtner Rudolf Blatter fand es abwegig, trotzdem zu versuchen, die zwei Reihen von gleich grossen Bäumen voll zu erhalten. Er liess deshalb im Jahr 1867 eine «englische» Allee anlegen, zu der sowohl ein Teil der alten Bäume als auch Gruppen von neuen diente. Das Ganze wurde so gestaltet, dass der bisherige Eindruck von zufällig zusammengewürfelten Bäumen verschwand.
Zürich bekommt das Landesmuseum
Die Landesausstellung von 1883 fand primär auf dem Gelände der ehemaligen Gasfabrik und auf der anderen Sihlseite statt, aber auch der Platzspitzpark wurde stark belegt. Anfänglich wurde die Ausstellung nicht besonders gut besucht, gegen Herbst strömten dann die Menschen aber doch aus allen Landesteilen nach Zürich und bescherten der Veranstaltung Erfolg. Die Lage des Ausstellungsgeländes unmittelbar beim Bahnhof trug wohl auch einiges dazu bei. Sie sollte dann auch für die Wahl des Standorts für das Schweizerische Landesmuseum bestimmend sein. 1892 wurde mit dessen Bau begonnen.
Die Anlagen um das neue Museum wurden vom bekannten belgisch-schweizerischen Landschaftsarchitekten Evariste Mertens (1846–1907) in Zusammenarbeit mit Gustav Gull geschaffen. Sie waren auf das Areal der ehemaligen Armengärten begrenzt und tangierten den von Fries gestalteten alten Park nicht. Die Reihe der im 18. Jahrhundert gesetzten Rosskastanien musste erst im Zusammenhang mit der Renovation nach den Zerstörungen von 1993, als der Park von Drogenabhängigen belagert war, gänzlich erneuert werden. Die damalige Renovation des Parks musste schnell erfolgen, es konnte keine Zeit in eine detaillierte Planung investiert werden. Dies kommt nun den Befürwortern von Erweiterungsbauten des Landesmuseums gelegen, die den Platspitz dafür in Anspruch nehmen wollen. Der Park macht gegenwärtig einen gestalterisch unbeholfenen Eindruck, was durch Bauinstallationen für die Renovierung des Museums noch wesentlich gesteigert wird.
Noch schlechter ist es um die Umgebungsgestaltungen auf der Bahnhofseite des Museums bestellt. Seit über einem halben Jahrhundert erfolgten immer wieder Eingriffe, die die Anlagen zusehends entwerteten. Auch für die Gull’sche Architektur bedeuteten Änderungen wie Treppenabgänge in den unterirdischen Bahnhof, die Erhöhung der Fahrbahn der Museumsstrasse und ihre Verengung wegen der Erweiterung des Bahnhofs sowie der Verlust von grossen Alleebäumen eine schwere Beeinträchtigung, die auch die Ausstrahlung des Landesmuseumsgebäudes tangiert. Hinzu kommt, dass der Platzspitzpark gerade in der schönsten Jahreszeit immer häufiger für Veranstaltungen missbraucht wird, die in einem Park nichts zu suchen haben, und als Ort, wo die Nebenbetriebe von Veranstaltungen im Landesmuseumshof mit ihren Baracken, Zelten und Wagen untergebracht werden.
Bauen im Park?
Das Schweizerische Landesmuseum plant seit einigen Jahren, Erweiterungsbauten in den Park zu stellen. Trotz der auf vielseitige Kritik hin erfolgten Reduzierung des ursprünglich vorgesehenen Bauvolumens würde der Platzspitzpark damit zerstört. Es ist unverständlich, dass ausgerechnet das Bundesamt für Kultur auf die Verwirklichung des Vorhabens drängt und sich nicht dafür einsetzt, dass ein anderer Standort für die Museumserweiterung gewählt wird.TEC21, Mo., 2007.08.27
Anmerkung:
[1] Johann Conrad Faesis, Pfarrers der Gemeinde Uetikon an dem Zürich-See und Mitglieds der Eidgenössischen Gesellschaft zu Schinznach, genaue und vollständige Staats- und Erd-Beschreibung der ganzen helvetischen Eidgenossenschaft, derselben gemeiner Herrschaften und zugewandten Orten, Band I. Zürich 1765.
27. August 2007 Eeva Ruoff