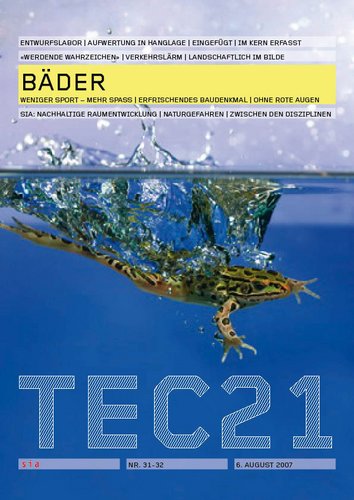Editorial
Wenn heute zahlreiche Gemeinden ihre Freibäder renovieren müssen, da Bauten und Technik ins Alter kommen, gilt es, auf veränderte Bedürfnisse, Gewohnheiten und Nutzungsansprüche einzugehen. Viele Bäder erleben – nach einer Krise in den 80er-Jahren, als manchenorts über Schliessungs- oder Privatisierungsszenarien nachgedacht wurde – seit den 90er-Jahren ein Revival oder gar eine nie dagewesene Blüte der Badekultur. Die Liberalisierung der Gastgewerbeordnungen hat mancher «Badi» einen gastrokulturellen Aufschwung beschert und die Kioskpächter zu innovativen Wirten werden lassen. Die Befriedigung verschiedener körperlicher Bedürfnisse, im 20. Jahrhundert auf strikt getrennte Orte verteilt, rückt wieder näher zusammen; das Bad wird zu einem multifunktionalen Ort mit Gartenrestaurant, Bar, Kino oder Museum – und mancher Bademeister wird ein wenig zum Kulturmanager.
Dafür tritt der sportliche Aspekt in den Hintergrund. Der Schwimmsport erfreut sich zwar wachsender Beliebtheit, doch er findet heute eher im Hallenbad statt, ebenso das Schulschwimmen. Spezielle Sport- und Schulschwimmbecken braucht es deshalb in den Freibädern nicht mehr. Und weil sich nur noch ein kleiner Teil der Badegäste zum Umziehen verstecken möchte, werden Garderobengebäude frei für neue Nutzungen: als gedeckte Spielflächen, als Räume für Kulturveranstaltungen oder ganzjährig nutzbare Lokale für Vereine im Quartier. Die Bäder müssen sich gegen vielfältige Konkurrenz durchsetzen und eine immer mobilere Bevölkerung fesseln. Die Gemeinde als Betreiberin muss dem Bedürfnis nach mehr Fun, Action und Events nachkommen. Sie kann es sich aber nicht leisten, mit allzu vielen Rutschbahnen, künstlichen Wellen und Partys die Stammgäste zu vertreiben. Diese nutzen das Bad v.a. als erholsamen Garten und suchen eher stille Ecken zum Lesen oder für ein ruhiges Gespräch. Gefragt ist also die Quadratur des Zirkels: Das Bad soll allen etwas bieten und gleichzeitig ein klares Profil haben. Zu Letzterem, einem eindeutigen Charakter, verhilft ihm nicht selten seine historische Bausubstanz. Kommunale Bäder wurden oft mit viel Sorgfalt geplant. Wie wertvoll und attraktiv Architektur und Gartengestaltung in manchem Fall sind, wurde in den letzten Jahren bewusster, nicht zuletzt dank einer – leider vergriffenen – Publikation des Schweizer Heimatschutzes.
Dieses Heft berichtet von drei Bädern: Das älteste «künstliche» Freibad der Schweiz, das 1911 von Rittmeyer & Furrer gebaute Bad Geiselweid in Winterthur, ist so marode, dass es tiefgreifend umgebaut werden muss; nun erhält es ein Biobad. Das Freibad Letzigraben in Zürich von 1949 hat mit Max Frisch als Architekten, Gustav Ammann als Gartenbauer und seiner Lage auf einer alten Hinrichtungsstätte und den Überresten einer römischen Villa eine so reiche Geschichte, dass seine Garderoben heute als Museum dienen können. Aber nicht nur hier setzt die Stadt Zürich auf Denkmalpflege. Auch im weniger prominenten Freibad Seebach, 1966 von Adolf Wasserfallen und Willi Neukomm als Teil eines grösseren Ensembles öffentlicher Bauten erstellt, ist es der feinfühlige Umgang mit der bestehenden Bau-(und Gartenbau-)Substanz, der dem Ort Einzigartigkeit und Charme sichert.
Ruedi Weidmann