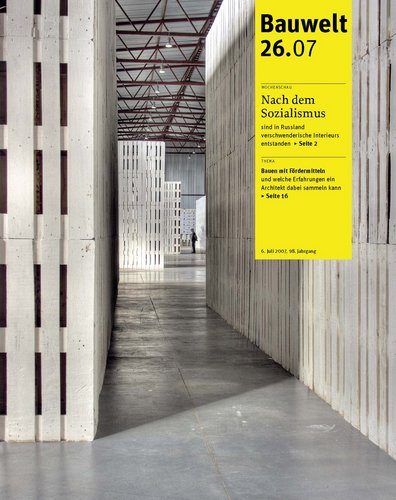Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Lust auf Raum - Neue Innenarchitektur in Russland
03 Besucherzentrum Arche Nebra am Fundort der Himmelsscheibe von Nebra
04 Megastädte in Asien. Symposium der Deutschen Gesellschaft für Asienkunde
04 The Making of Your Magazines. archplus auf der documenta
05 Der Neue Raum. Magdalena Jetelovà bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen
06 Haubitz + Zoche auf den Seven Screens
06 Denkmal!Moderne
BETRIFFT
08 Buildings for Europe
WETTBEWERBE
10 Forschungszentrum :envihab in Köln-Porz
12 Entscheidungen
14 Auslobungen
THEMA
16 Die Förderpolitik der Europäischen Union
22 Von der Chipfabrik zur Solarfabrik
26 Von Silverlake City ins El Dorado. Themenpark in Templin
30 Eurospeedway Lausitz
34 Erfahrungen eines Architekten. Interview mit André Kempe
REZENSIONEN
37 Capitalist Realism. Neue Architektur in Russland (Hg. Bart Goldhoorn und Philipp Meuser)
37 Verlorene Avantgarde. Russische Revolutionsarchitektur 1922-1932 (Hg. Richard Pare)
37 Irgendwo. Fotografien von Michael Schmidt
38 Neue Architektur in Kärnten (Hg. Haus der Architektur Kärnten)
RUBRIKEN
07 wer wo was wann
36 Kalender
40 Anzeigen
48 Die letzte Seite: Tierpark Ueckermünde