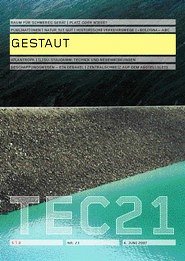Editorial
Editorial
Talsperren gehören zu den grössten und eindrücklichsten Bauwerken der Neuzeit. Ohne die Möglichkeit, Fliessgewässer zum Zweck der Energiegewinnung und der Wasserspeicherung zu stauen und künstliche Seen zu schaffen, wäre sowohl die industrielle als auch die landwirtschaftliche Entwicklung in den heute wohlhabenden Ländern nicht so erfolgreich verlaufen. Staumauern und -dämme gelten seit Beginn der Industrialisierung als Symbole und Garanten des technischen Fortschritts. Ihre Erstellung war, und ist weiterhin, begleitet von Versprechungen und Erwartungen bezüglich Wohlstand für die Bevölkerung, Schutz vor Überschwemmungen oder Dürren und der Versorgung des Landes mit Wasser und Energie.
Talsperren sind anspruchsvolle Ingenieurbauwerke. Auch deshalb wurden und werden sie gerne als Repräsentanten der Leistungsfähigkeit und überlegenen Technologie von Staaten, Völkern oder Gesellschaftsformen instrumentalisiert. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war mit dem Bau von Stauanlagen häufig ein kolonialer Anspruch verbunden, sowohl bei der forcierten Industrialisierung rückständiger Gegenden im Inland als auch zur Begründung von Machtpositionen in weniger entwickelten Ländern. Beispiele dafür sind aus den 1930er-Jahren die damals gigantischen Flusskraftwerke der Sowjetunion, die den kommunistischen Führungsanspruch untermauern sollten, aber auch die – nicht nur in der Schweiz – mit viel Pathos zu nationalen Monumenten stilisierten ersten grossen Betonstaumauern.
Eines der weltweit anspruchsvollsten und radikalsten wasserwirtschaftlichen Projekte jener Zeit war die Idee des deutschen Architekten Herman Sörgel, das Mittelmeer mittels Dämmen abzusenken. Damit sollte Europa mit Energie versorgt und halb Afrika in ein blühendes Paradies (wahrscheinlich für weisse Siedler) verwandelt werden. Der erste Beitrag stellt dieses heute vergessene, in globalen Dimensionen angelegte koloniale Projekt und seinen unbeirrbaren Initianten vor.
Seit der Entkolonialisierung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich die politische Bedeutung von grossen Stauanlagen gewandelt. Jetzt sind es die Entwicklungs- und Schwellenländer, die mit Projekten der Superlative, oft begleitet von nationalistischen Untertönen, ihre Leistungsfähigkeit demonstrieren und sich unter den industrialisierten Ländern etablieren wollen. Diese Entwicklung, die etwa mit dem ägyptischen Assuan-Projekt eingeleitet wurde, erreicht gegenwärtig mit den gigantomanischen chinesischen Stauanlagen einen Höhepunkt. Gemeinsam ist diesen Projekten, dass ökologische Überlegungen keinen hohen Stellenwert haben und auf die unmittelbar betroffene Bevölkerung wenig Rücksicht genommen wird.
Weniger wegen seiner Grösse als vielmehr wegen der sensiblen politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Wechselwirkungen steht der geplante Ilisu-Staudamm in der Türkei seit Jahren in der Kritik. Drei Beiträge beleuchten verschiedene Aspekte des Projekts und gehen aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf seine wechselvolle Vorgeschichte, die technischen Komponenten und Kennwerte und die sozialen, ökologischen, politischen und kulturellen Auswirkungen ein.
Aldo Rota
Inhalt
WETTBEWERBE
Raum für schweres Gerät / Platz oder Wiese?
MAGAZIN
«Bahnhöfe» / «Deep Ocean» / Natur tut gut / Ingenieure: gezielte Nachwuchsförderung / Historische Verkehrswege / «Bologna»-Abc / «Ökoquartier» Lausanne /
ATLANTROPA
Katinka Corts
Zwischen Marokko und Gibraltar plante Herman Sörgel in den 1930er-Jahren einen gigantischen Staudamm zur Energiegewinnung für Europa.
UMSTRITTENES PROJEKT
Claudia Carle
Der Ilisu-Staudamm ist Teil eines grossen Infrastrukturprojektes im Südosten der Türkei. Am Bau sind auch vier Schweizer Firmen beteiligt.
STROM AUS DEM TIGRIS
Aldo Rota
Das geplante Wasserkraftwerk Ilisu soll durch Nutzung des grossen Speichervolumens des Stausees saisonunabhängige Spitzenenergie produzieren.
WASSERKRAFT MIT NEBENWIRKUNGEN
Christine Eberlein
Beim Ilisu-Staudamm hält sich die Türkei nur ungenügend an internationale Standards. Auch von alternativen Vorschlägen zum Projekt hält sie wenig.
SIA
Beschaffungswesen - ein Debakel / Die Zentralschweiz auf dem Abstellgleis
PRODUKTE
IMPRESSUM
VERANSTALTUNGEN
Atlantropa
In den 1930er-Jahren plante Herman Sörgel, ein Architekt aus München, einen gigantischen Staudamm zur Energiegewinnung zwischen Marokko und Gibraltar. Das Mittelmeer sollte zum Verdunstungsbecken werden und der Atlantik zum Speichersee. Die Absenkung des Mittelmeers hätte viel Neuland geschaffen; die Kontinente wären mit einem zweiten Damm zwischen Sizilien und Tunesien verbunden worden. Afrika sollte bis zum Kongobecken für die Landwirtschaft bewässert – und für die Europäer «kultiviert» – werden.
Herman Sörgel (1885–1952) bezeichnete sich selbst als Weltarchitekt. Er hatte zwar viele Schriften zur Architektur verfasst, aber wenig gebaut. 1927 widmete er sich erstmals seinem Grossprojekt, das ihm zu grosser Bekannheit in Europa und weltweit verhelfen sollte. Angeregt hatte ihn unter anderem der englische Schriftsteller Herbert George Wells, der Autor des 1895 erschienenen Romans «The time machine», der in seinem Buch «Outline of History» (1920) die Entstehung des Mittelmeers naturwissenschaftlich beschrieben hatte. Das heutige Meer habe in der glazialen Zeit aus mehreren innerkontinentalen Seen bestanden, die erst beim Rückgang des Eises und durch den ansteigenden Wasserspiegel untereinander und mit dem Atlantik verbunden wurden. Das einströmende Wasser des Atlantiks verhindert seitdem das Absinken des Wasserspiegels im Mittelmeer, dessen Zuflüsse aus Ebro, Rhone, Po, Nil und Schwarzem Meer dafür nicht genügen würden.
Warum sollte also diese Energie des beständig einströmenden Wassers nicht genutzt werden? Sörgel begann, Staudämme und Bauwerke zu entwerfen. Die beiden wichtigsten wurden die Staudämme bei Gibraltar und bei Sizilien (Bilder 1 bis 5). Ursprünglich sollte das Mittelmeer in mehreren Stufen um bis zu 500 m abgesenkt werden, schliesslich reduzierte Sörgel die Gesamtabsenkung auf 200 m und trug damit den Anforderungen der Schifffahrt Rechnung. Sörgel berechnete, dass der 14.2 km lange Damm bei Gibraltar aus 10 Mrd. m3 Gestein aufgeschüttet werden müsste und sich von Gibraltar über die seichtesten Stellen zwischen den Cabezos-Riffen über Tanger bis nach Marokko ziehen sollte. Am Meeresgrund wäre er 1600 m, an der Krone 100 m breit geworden. Eine zweite Staustufe plante Sörgel zwischen Sizilien und Tunesien. Die integrierten Wasserkraftwerke sollten gemeinsam mit den neuen Stauwerken an allen Flussmündungen den Strombedarf Europas decken (etwa 50.000 MW nahm Sörgel für das Kraftwerk in Gibraltar an).
Neue Städte und Häfen
Die Staudammplanungen zogen städtebauliche und organisatorische Probleme nach sich, für die Sörgel Lösungen finden musste. Nach der Senkung des Meeres hatten die Küstenstädte keinen Zugang zum Wasser mehr, der Wasserspiegel am Suez-Kanal war um 200 m gesenkt. Damit die Schifffahrtsrouten über Istanbul und Ägypten erhalten blieben, wurden auf dem Neuland Kanäle und grosse Staustufen angelegt. Ein Kanal führt zum Salzsee Choot el Djerid, der sich von der algerischen Grenze aus quer durch Tunesien nach Osten erstreckte und für das Stauprojekt ein Wassersammelbecken sein sollte. Ein weiterer Kanal stellte die Schiffsverbindung zum Schwarzen Meer sicher: Nach der Absenkung wurden Staustufen und Schiffsschleusen eingebaut, die das Marmarameer mit dem Ägäischen Meer durch einen kurzen Landkanal mit dem Xerxesgolf (heute Golf von Saros) verbanden. Damit die Städte, die bisher an der Küste lagen, weiterhin mit dem Schiff erreichbar waren, mussten sie sich auf dem Neuland in Richtung Meer ausdehnen. Die bestehenden Hafenanlagen mussten an die Absenkung angepasst werden.
Für die Planung der Städte und einzelner zentraler Gebäude gewann Sörgel einige der wichtigsten deutschen Architekten des frühen 20. Jahrhunderts. Dazu gehörten Hans Poelzig, Fritz Höger, Emil Fahrenkamp, Ludwig Mies van der Rohe, Peter Behrens, Hans Döllgast und Erich Mendelssohn. Sie entwarfen für das Neuland neue Städte, Häfen und Wahrzeichen. Ferber Appel Architekten aus München planten das neue Genua (Bild 10), Döllgast und Sörgel den Unterhafen Port Said (Bilder 8 und 9) und Behrens den 400 m hohen Atlantropaturm bei der Nordschleuse des Gibraltarwerkes (Bild 6).
Venedig konservierte Sörgel als Kulturdenkmal. Dank einer Staumauer am südlichen Horizont veränderte sich die Wasserlinie nicht. Sörgel: «Venedig z.B. wird Binnenstadt; die Kanalisationsverhältnisse und die 25 Mio. m3 jährliche Sinkstoffe des Po zwischen Triest und Ravenna machen solche und ähnliche Städte in ihrer heutigen Form ohnehin zu Todeskandidaten.» (Sörgel 1929, S. 32) Und an einer anderen Stelle: «Der Damm, der diesen Stausee begrenzt, liegt 30 Kilometer vom Campanile San Marcos, dessen Loggia – 50 bis 60 Meter hoch – der höchste Aussichtspunkt von Venedig ist. Von der Loggia aus kann man den Damm nicht mehr wahrnehmen, so dass der Stausee wie das offene Meer wirkt.» (Zitat nach Voigt, S. 57)
In etwa 20 Jahren entstand eine enorme Menge an Einzelarbeiten und Bauprojekten, die mit dem Atlantropa-Projekt in Beziehung standen. Viele der Planungen sollten auf dem Neuland umgesetzt werden, das nach der Absenkung entstehen würde. Sörgel schreibt von 660200 km2 Neuland, einer Fläche grösser als Frankreich, Belgien und die Niederlande zusammen. Er war fest davon überzeugt, dass Afrika von den Europäern erschlossen werden musste, um kultiviert zu werden. In seiner weiterentwickelten Vorstellung des Kolonialismus ging es nicht mehr darum, einzelne Länder in Afrika zu beherrschen wie im Wettlauf um Afrika, der bis zum Ersten Weltkrieg zwischen den europäischen Staaten herrschte. Sörgel plante über die Ozeane hinweg und wollte durch die Vereinigung von Europa und Afrika zu Atlantropa einen wirtschaftlich mächtigen Weltteil – mit dem Zentrum im alten Karthago – zwischen Amerika und Asien schaffen.
Wasser für Afrika
Mit dem Wasser, das an den Staustufen Strom erzeugen sollte, hatte Sörgel noch weitere Pläne. Es sollte entsalzt, aufbereitet und in die Sahara geleitet werden, damit dort Plantagen entstehen konnten (Bilder 11 bis 13). Die Ernte aus dieser neuen «Kornkammer Europas» sollte – wie zu Zeiten der römischen Kaiser – in erster Linie Europa ernähren. Die «Goldenen Zwanziger» liessen einen gleichzeitigen Anstieg von Wohlstand und Bevölkerung erahnen. Weiteres aufbereitetes Wasser leitete Sörgel in Kanälen nach Zentralafrika. Hier plante Sörgel ein weiteres Grossprojekt, die Flutung des Kongobeckens. Der künstliche See sollte ganz Afrika mit Trinkwasser versorgen. Durch die natürliche Verdunstung sollten laut Sörgel Wolken entstehen, die sich in der Umgebung abregneten und dadurch den Boden fruchtbarer machten. Nach einiger Zeit, so meinte er, könnte sich das tropische Klima abkühlen und Afrika wieder ein grüner Kontinent werden. Sörgel: «Die Wiederbegrünung dieses gesegneten Weltteiles könnte die Kriegs- und Mordlust der Europäer für Jahrhunderte in Aufbauarbeit umwandeln. [...] Der Wille zur Tat wäre das grösste, aussichtsreiche Kulturwerk der Menschheit des 20. Jahrhunderts.» (Sörgel 1929, S. 36) Eines seiner Hauptaugenmerke galt der Vergrösserung des Lebensraumes für die Europäer – es ging dem technokratisch denkenden Sörgel nicht um ein humanitäres Projekt. Dass sein Projekt auch negative Auswirkungen auf das Klima haben könnte, glaubte Sörgel nicht: «Über den mutmasslichen Klimawechsel, über Vulkanausbrüche oder gar die ‹Verlagerung der Erdachse› – wie manche unken – brauchen wir uns wahrhaftig keine Sorgen zu machen. Die Erdkugel wird keinen Schaden leiden. Der Zustand, der durch Ausführung des Projektes geschaffen werden soll, hat ja schon einmal in grauer Vorzeit bestanden. Ausserdem hat man es in der Hand, bei jedem beliebigen Niveau die weitere Senkung einzustellen.» (Sörgel 1929, S. 32)
Vergessene Vision
Genau 80 Jahre ist es her, dass Sörgel sein Projekt Atlantropa, eines der grössenwahnsinnigsten Bauprojekte der Menschheit, begann. Die Träume und Vorstellungen Sörgels sind längst überholt, was die politische Landkarte und die Technikgläubigkeit betrifft. Mit der Energieproblematik, die sein Projekt lösen wollte, beschäftigen wir uns aber stärker denn je.
Im Grössenvergleich mit den Atlantropa-Dämmen ist die chinesische Drei-Schluchten-Talsperre zwar klein, doch Asien hat noch einige Projekte in der Schublade: so zum Beispiel die Rogun-Talsperre in Tadschikistan (3600 MW) und die chinesischen Projekte Jinping (3600 MW), Xiaowan (4200 MW), Laxiwa (3700 MW) und Xiluodu (12600 MW). Sie entsprechen zusammen immerhin fast der Hälfte der Leistung des Staudamms bei Gibraltar.
Bis zu seinem Tod 1952 beschäftigte sich Sörgel mit Atlantropa. Er fand immer wieder berühmte Mitstreiter, die wie er an die unbegrenzten Möglichkeiten der Technik glaubten. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde das Projekt zwar geduldet, aber nicht unterstützt. Wolfgang Voigt, der im Rahmen einer Forschungsarbeit den Nachlass Sörgels aufarbeitete, schreibt dazu: «Einige Anhänger Atlantropas wünschten sich ebenso wie manche Nationalsozialisten die Adoption des Projekts durch das ‹Dritte Reich› und hofften das Reich werde sich nach einem endgültigen Sieg im Osten dem Mittelmeer-Projekt zuwenden.» (Voigt 1998, S. 107)
Herman Sörgel gründete 1942 in München das Atlantropa-Institut in der Hoffnung auf einen offiziellen Forschungsauftrag. Er hielt Vorträge über seine Arbeit und zeigte sie in Ausstellungen in München, Essen, Dresden, Hamburg und Zürich. Mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion und der Niederlage der Rommel-Truppen in Nordafrika verschwand das Thema Afrika bei den Nazis. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand Sörgel bis 1948 rund 1200 Fördermitglieder für das Atlantropa-Institut, darunter Industriekonzerne wie Krupp, Mannesmann, Hochtief und Stinnes, wodurch das Projekt nochmals kurz aufblühen konnte. Nicht nur die kriegsgeschädigte Bevölkerung, sondern auch die Vereinten Nationen in New York waren von Sörgels Vorschlag für ein friedliches Zusammenleben der Völker beeindruckt. Die Amerikaner interessierten sich zudem für die Rohstoffreserven in Afrika, die mit dem Projekt erschlossen wurden. Auch afrikanische Politiker wie der Parlamentspräsident der Mali-Föderation Léopold Sédar Senghor schlossen sich dem Projekt an. Zu den Werbemassnahmen gehörten eine Atlantropa-Zeitschrift (ab 1946) und ein Werbefilm (1950), der in deutschen und ausländischen Kinos gezeigt wurde.
Als Sörgel 1952 starb, verblasste auch das Projekt. Es gab keine treibende Kraft mehr, die zeitweiligen Mitstreiter hatten meist nur an einzelnen Teilprojekten gearbeitet. Gleichzeitig wurde die Kernkraft zum neuen Hoffnungsträger in der Energiepolitik. Das Atlantropa-Institut wurde 1958 aufgelöst. Die Utopie eines Mittelmeerstaudammes, einer unerschöpflichen Energieversorgung für Europa und einer Klimaveränderung für Afrika schlummert heute in 45 Schachteln im Archiv des Deutschen Museums in München.TEC21, Mo., 2007.06.04
04. Juni 2007 Katinka Corts-Münzner