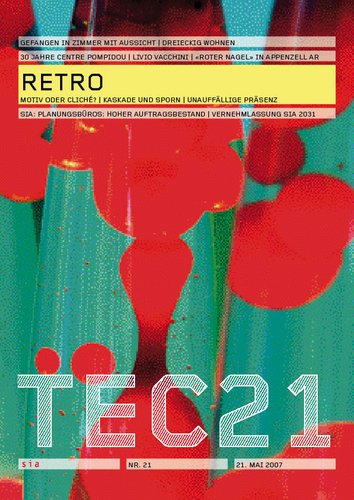Editorial
Editorial
Der Begriff «Retro» ist ein Behelf, um verschiedene Spielarten von Renaissance und Revival zu umschreiben. Dass das mit «Retro» Klassifizierte an sich nichts Neues ist, liegt in der Natur des Wortes, haftet ihm doch die Betonung des Rückbezüglichen an. In der Architektur sind Retro, Revival, Renaissance wiederkehrende Bewegungen. In der Konsumindustrie ist Retro dagegen eher ein jüngeres Phänomen – vielleicht mit Ausnahme der Mode, die alle paar Jahre den Fundus der Klamottenkiste des 20. Jahrhunderts plündert.
Über die Gründe ist schon manches gefachsimpelt worden. Dass das Jahrzehnt vor der Jahrtausendwende besonders anfällig war für retrospektivischen Hang, liess sich salopp mal mit der verbreiteten Weltuntergangsstimmung, mal mit der in Verruf geratenen Fortschrittsgläubigkeit oder auch mit der Besinnung auf die natürlichen Ressourcen erklären. Retro bahnt sich immer dann an, wenn sich eine Epoche abnutzt, wenn ihre Höhenflüge im Ikarus-Absturz enden, wenn das Vokabular sich erschöpft, sich auf Floskeln reduziert und zu Dogmen erstarrt, wenn Motive zu blossem Zierrat werden und neue Ideen in der ständigen Repetition sich banalisieren.
Dann treten die einen die Flucht nach vorne an: Höher, weiter, schneller wird zum Selbstzweck und generiert Ausgeburten wie paramilitärische Geländewagen, aufgeständert wie jene Riesenameisen, die im Film «Formicula» von 1954 unter dem Einfluss der Strahlung eines Atomtestgeländes mutierten. Andere fördern mit Retro-Versionen Vertrautes ins Rampenlicht: vom Austin Mini (1959) zum BMW Mini (2001), vom VW Käfer (1946) zum VW New Beetle (1999). Alfa Romeo hat sich dieses Jahr am Automobilsalon in Genf mit der Retro-Studie «8C Competizione» präsentiert. Und Fiat will Mitte 2007 eine Replik des Cinquecento lancieren. Retro-Fahren ist schick, vorausgesetzt die PS stimmen – auch wenn sich unter der Haube eine Fälschung verbirgt: Nicht nur war der VW-Käfer-Motor ein luftgekühlter Vierzylinder-Boxermotor, der im Heck untergebracht war und nicht wie beim New Beetle als Frontmotor konzipiert, der nunmehr ausserdem wassergekühlt wird, auch lässt sich der Keilriemen heute nicht mehr durch ein Strumpfband ersetzen.
Eine der wenigen aussergewöhnlichen Entwicklungen auf dem Retro-Markt ist das Revival der Röhrenverstärker. Obwohl durchaus auch optisch inszeniert, ist er nicht bloss Design-Gadget – Musikliebhaber schwören auf die gegenüber «traditionellen», digitalen Modellen bessere Qualität: Röhrenverstärker- oder Beetle-Prinzip? Das ist die Frage. Sie wird im ersten Artikel thematisiert. Beantwortet wird sie mit Giraudi & Wettsteins «casa le terrazze» in Lugano und Peter Märklis Bürogebäude am Picassoplatz in Basel. Beide Bauten illustrieren, wie retrospektivische Motive zu eigenständigen Werken komponiert werden.
Christian Holl, Rahel Hartmann Schweizer
Inhalt
Wettbewerbe
Gefangen in Zimmer mit Aussicht | Dreieckig wohnen
Magazin
30 Jahre Centre Pompidou | Livio Vacchini | «Roter Nagel» in Appenzell AR
Motiv oder Cliché?
Christian Holl, Rahel Hartmann Schweizer
Retro: von der typologischen Anleihe bis zur «Kopie» eines Gebäudes, von der erklärten Hommage bis zur versteckten Analogie
Kaskade und Sporn
Rahel Hartmann Schweizer
Sandra Giraudi und Felix Wettstein haben mit einem Einfamilienhaus oberhalb von Lugano Hans Scharoun und Vittoriano Viganò die Reverenz erwiesen.
Unauffällige Präsenz
Lilian Pfaff
Das neue Bürogebäude am Picassoplatz in Basel von Peter Märkli erinnert durch seine elegante Stahlfassade an amerikanische Hochhäuser.
SIA
Planungsbüros: hoher Auftragsbestand | Vernehmlassung SIA 2031 «Energieausweis für Gebäude»
Produkte
Impressum
Veranstaltungen
Motiv oder Cliché?
Retro reicht von der Implementierung ganzer Stadtgestalten bis zur (meist nur äusserlich) lupenreinen «Kopie» eines Gebäudes, von der typologischen Anleihe bis zur Adaption einzelner Elemente, von der plumpen Applikation bis zur Rehabilitation des Ornaments, von der erklärten Hommage an einen Architekten bis zur versteckten Analogie. Die Art der Annäherung entscheidet, ob ein Bauwerk das «Vor-Bild» als Motiv würdigt oder nur als Cliché.
Es gibt das Röhrenverstärker- ebenso wie das Käfer-Beetle-Prinzip (siehe Editorial und Bilder 1, 2): Typologische Anleihen, Hommagen und Transpositionen tendieren zu Ersterem. Sie entwickeln einen schon einmal gedachten Baugedanken inhaltlich weiter und machen den Ursprung in der formalen und / oder konstruktiven Umsetzung kenntlich. Stilzitate neigen zu Letzterem. Sie scheren sich kaum um die ursprüngliche Bedeutung, sondern inszenieren den dekorativen Effekt. Im besten Fall sind sie immerhin ironisch gebrochen.
Epochal und repräsentativ
Das «steinerne Berlin» hat keinen geringeren Ehrgeiz, als durch die Reproduktion seiner Architektur die Attribute einer ganzen Epoche neu zu implementieren, die lebendige Stadt des 19. Jahrhunderts wiederherzustellen. Doch so einfach ist das nicht. Angelus Eisinger konstatiert, da werde Stadtgestalt mit Stadtwirklichkeit verwechselt: «Die durchmischte Stadt des Flaneurs, die dieser nostalgisch-kultivierten Stadtvorstellung Pate gestanden hat, ereignet sich in diesen Räumen nicht.»[1]
Absichten und Ziel müssen ja nicht immer derart hehr und hochgesteckt sein. Gerade bei Prestigebauten spielte bei Fürsten früher und spielt bei Bürgermeistern heute das kindliche Verlangen mit, das haben zu wollen, was der andere hat. So hat man sich im süddeutschen Sigmaringen die Rathauserweiterung von Rafael Moneo, die dieser im spanischen Murcia 1999 errichtete, zum Vorbild für die eigene Erweiterung genommen (Architektengruppe Überlingen, Marion Roland-König). Fast rührt es einen an. Die Grösse stimmt nicht, Proportionen und Material auch nicht, das Verhältnis Öffnung zu Wand, mit dem Moneo ein raffiniertes Spiel trieb, wirkt hier dann doch etwas plump. Da der Meister nicht fürchten muss, dass hier sein geistiges Eigentum geraubt worden sei, sieht man in einem solchen Fall über die Parallelitäten hinweg und belässt es bei einem Achselzucken. (Bilder 3, 4)
Selbstreferenziell
Denn das ist ja das Heikle an der Sache: Wer zu unverfroren nachmacht, gilt als Dieb des geistigen Eigentums. Am einfachsten ist es daher, die eigenen Entwürfe zu recyclen. Das erspart die Probleme mit dem Urheberschutz, birgt aber die Gefahr, den Spott der Kritiker auf sich zu ziehen. So meinte Jörg Hentzschel in der «Süddeutschen Zeitung» einmal über Frank Gehry, er sei wie der Mann, der immer denselben Witz erzählt, nur weil sich die Leute beim ersten Mal geschüttelt hätten. Und doch zitiert Gehry nicht einmal nur sich selber: Oder sind seine Prager «Ginger und Fred» (1994–1996) etwa nicht eine – wenn auch nur floskelhafte – Replik auf Scharouns Stuttgarter «Romeo und Julia» (1954–1959)?
Eher ungeschoren kommt davon, wer sich unrealisierte Projekte oder Skizzen vornimmt – wenn auch, wie im Fall von Theo Hotz’ Projekt von 2005 für den 90 Meter hohen Turm beim Tramdepot am Escher-Wyss-Platz in Zürich (siehe TEC21, Nr. 13, 2006, S. 26) das Mies’sche Vorbild – der Entwurf für ein Hochhaus aus Glas von 1992 – stark im kollektiven Architekturgedächtnis verankert ist. Das gilt ebenso für Zaha Hadids 2005 präsentierten «Zhivopisnaya Tower» am Ufer der Moskwa, einen mehrflügeligen, mit Aluminiumbändern durchwirkten Turm, der «verdächtig» an Mies van der Rohes «Entwurf für das Hochhaus an der Friedrichsstrasse» von 1921 erinnert (Bilder 5, 6).
Verborgen
Reizvoller sind diejenigen Referenzen, deren «Vorbilder» in den verschütteten Gegenden des Architekturgedächtnisses schlummern: Herzog & de Meurons Bibliothek in Cottbus (1998–2004) ist oft in Beziehung gesetzt worden zum «Castel del Monte», das Friedrich II. Mitte des 13. Jahrhunderts in Apulien errichtete (1240–1250). Das macht Sinn für einen Hort des Wissens, war doch der Hohenstaufer-Kaiser einer der gebildetsten Herrscher jener Zeit. Doch die Basler Architekten haben sich immer auf die Grundrissform der Amöbe berufen, und hier wird man bei Wallace K. Harrison und seiner «Hall of Science» fündig, die er 1964 anlässlich der Weltausstellung in New York baute. Nicht nur hat sie einen Grundriss, den man mit der Form einer Amöbe assoziieren könnte. Auch Harrison verlieh dem Bau eine sakrale Wirkung. Er griff auf das Motiv bunter Kirchenglasfenster zurück, wie er sie in der First Presbyterian Church in Stamford 1958 eingesetzt hatte, und adaptierte sie: Die ondulierenden Aussenwände bestehen aus rechteckigen Kassetten, in die kobaltblaue Glasscherben eingesetzt sind. Harrisons Halle erscheint wie der archaische Ursprung der technologischen Fassung von Herzog & de Meuron – mit kryptischen Schriftzeichen bedrucktes Glas – in Cottbus. (Bilder 7, 8)
Typologisch
Die unverdächtigsten Anleihen sind die typologischen. Ein Gebäude nach oben hin abzutreppen, um jedem Stockwerk eine besonnte Terrasse zur Verfügung zu stellen, ist ein solches Motiv. Wie beim Arag-Verwaltungsgebäude von Paul Schneider-Eisleben in Düsseldorf von 1966 wird beim 2005 fertig gestellten Bürogebäude «Dockland» in Hamburg von Bothe Richter Teherani jedes Stockwerk mit Terrasse versehen, und diese werden untereinander über eine Treppe verbunden.
In Hamburg sind die Terrassen und das Dach sogar öffentlich zugänglich, und die Architekten haben es mit einem Kunstgriff verstanden, die Lage am Wasser so zu nutzen, dass genauso viel Raum wie in einem Quader zur Verfügung steht: Geformt wie ein Trapez wird vorne einfach angehängt, was hinten durch die Terrassierung verloren gegangen ist (Bilder 11, 12).
Respektvoll
Ähnlichkeiten müssen aber nicht unbedingt als Raub gelten. Sie können sogar beides sein: Kampfansage und Ehrfurchtsbekundung in einem. Zu ihnen gehörte die Tessiner Tendenza mit einem ihrer unlängst verstorbenen Protagonisten, Livio Vacchini, der 1997 mit der Mehrzweckhalle in Losone – in der Tradition von Schinkel und Mies van der Rohe – den griechischen Tempel neu interpretierte (siehe Seite 20).
Kürzlich gelegt wurde der Grundstein für die Elbphilharmonie in Hamburg (Herzog & de Meuron). Nicht nur der Name, auch die geschwungene Dachform verweist auf die Philharmonie von Scharoun in Berlin, und mit der Beschreibung der Fassade als «schillerndem Glaskörper» werden Scharouns Ideen einer kristallenen Architektur der 1920er-Jahre ebenfalls gewürdigt. Scharoun hat mit der Philharmonie eine Form des Konzerthauses erfunden, die noch so oft kopiert werden kann und trotzdem unvergleichlich bleibt. Und auch wenn Herzog & de Meuron auf sie anspielen, so wird die Philharmonie in Hamburg immer etwas anderes als die in Berlin sein, wird sie sich doch hier am Wasser auf dem Kaispeicher von Werner Kallmorgen (1966) erheben und ausserdem Hotel, Restaurants und Wohnungen aufnehmen (Bilder 9, 10). (Dass der Speicher nebenbei zur Prothese gemacht wird, ist eine andere Geschichte.)
Missverstanden
Unter dem Eindruck einer am Vorbild der europäischen Stadt des 19. Jahrhunderts orientierten Planung der letzten drei Dekaden gerieten die Alternativen zum standardisierten Wohnen in monofunktionalistischen Siedlungen der 1960er-Jahre in Vergessenheit. Die Collage von Wilfried Dechau aus den späten 1970er-Jahren – wieder aufgegriffen von Xavier Gonzales (Bild 13) – überlagert den Wunsch der Menschen nach Individualität à la Gartenhäuschen, mit der Architektur des Mietwohnungsbaus. Weniger radikal, nur mit der gleichen Technik der Collage, stellt sich der Wohnungsbau «Silodam» im Amsterdamer Hafen von MVRDV dar – wenn auch hier die Individualität nur noch aus einem bestehenden Angebot gewählt werden kann (Bild 14). Ähnlich ist es mit dem hochgradig ästhetisierten Konzept des auf der Möbelmesse in Köln vorgestellten «Ideal House» von Zaha Hadid. Raum und Möbel werden zu einem Kontinuum von höhlenartigen Konfigurationen komponiert. Es mag auf dem gleichen Misstrauen gegenüber funktionalistischen Standardformen gründen, die Friedrich Kiesler zu seinem «Endless House» führten. Dessen Innenräumen ähnelt Hadids Entwurf auffällig. Kiesler konnte sein Projekt nie verwirklichen, es war aber als Gegenteil einer Lösung gedacht, das dem Benutzer die Auseinandersetzung mit sich selbst abnimmt. Zaha Hadid hingegen liefert die vollendet inszenierte Lösung (Bilder 15, 16).
Auch in der Architektur stellt sich die Frage: Hat der Röhrenverstärker oder der New Beetle Pate gestanden? Orientiert sich der retrospektive Bau am Topos bzw. am Motiv des «Vor-Bilds» und verleiht ihm eine neue Bedeutungsebene, oder reduziert die Retro-Variante es auf die Phrase bzw. das Cliché?TEC21, Mo., 2007.05.21
Anmerkung
[1] Eisinger, Angelus: Die Stadt der Architekten. Anatomie einer Selbstdemontage. Gütersloh / Berlin und Basel / Boston / Berlin, 2006, S. 149.
21. Mai 2007 Christian Holl, Rahel Hartmann Schweizer
Kaskade und Sporn
Sandra Giraudi und Felix Wettstein haben mit einem Einfamilienhaus in Viganello, oberhalb von Lugano, am Hang des Monte Bré, dem einen offen, dem andern versteckt die Reverenz erwiesen: Hans Scharoun und Vittoriano Viganò.
Die «casa Vergani» gibt sich von der steilen, schmalen Stichstrasse her wie eine hoch aufragende Burg, weil man sie hier zunächst nur aus der Froschperspektive in Augenschein nehmen kann. Eine markante Strebemauer, ein Sporn, weist wie ein Wehrturm talseits (Bilder 4, 5).
Der Sporn ist der Anker des kaskadenartig über den Hang abfallenden Baus oder der Dreh- und Angelpunkt des sich über fünf Geschosse (!) in die Höhe schraubenden Hauses. Es ist diese Dichotomie, in der das Haus balanciert…
Obwohl das Haus aus dem Hang wächst (Bild 2), fügt sich die «casa Vergani» nicht in die Landschaft. Sie nimmt vielmehr einen spannungsvollen Dialog mit ihr auf, der sich aus verschiedenen Beziehungen zum Terrain entwickelt: Die Höhe des Baus leitet sich aus der steilen Topografie und den Bedingungen des Baureglements ab, das die Architekten in ebenso kreativer wie origineller Weise interpretierten. Da sich das Haus in Bauzone 2 befindet, sind eigentlich nur zwei Geschosse und eine Attika erlaubt – es sei denn, man arbeitet mit Rücksprüngen. Dann ist es möglich, 8 m hoch zu bauen, einen Rücksprung von 12 m zu konzipieren und darauf erneut ein 8 m hohes Bauvolumen zu setzen. Giraudi & Wettstein brauchten das Reglement noch nicht einmal auszureizen: Sie brachten zwei Geschosse unterirdisch unter. Blieben also noch die zwei erlaubten und die Attika, wobei das oberste und das Attikageschoss tatsächlich zurückspringen.
Der Grundriss eines gleichseitigen Dreiecks entspringt der Form der Parzelle, die er exakt nachzeichnet, die Ausrichtung des Baus aus den landschaftlichen und kontextuellen Gegebenheiten: dem auf dem Nachbargrundstück auf der Nordseite entstehenden Bau, der den Grenzabstand arg strapaziert, dem romantischen Tobel auf der Südostseite, dem Ausblick auf die in der Ebene liegende Stadt Lugano gen Westen und den San Salvatore Richtung
Süden.
Dramatisierung der Landschaft
Giraudi & Wettstein haben damit einen der beiden Schwerpunkte umgesetzt, welche die Bauherren – ein Bankier und eine Kunsthistorikerin mit ihren beiden schulpflichtigen Kindern – setzten: Sie wollten ein Haus ohne Garten, eine Stadtvilla. Und sie wünschten sich, dass die Architekten eine Dramatisierung der Landschaft erzielen würden, die das Haus auszeichnet, das sie in Portese besitzen: Vittoriano Viganòs (1919–1998) «casa scala» (Bilder 14–16, 18, 20), die dieser 1956 hoch über dem Gardasee für den Künstler und damaligen Direktor der Zeitschrift «Architecture d’Aujourd’hui», André Bloc, errichtete. Den Ausdruck der Stadtvilla generieren die Architekten mit dem erwähnten ebenso eleganten wie trutzigen Sporn. Aber auch die Eingangssituation, die eher dem Zugang zu einem Stollen gleicht (auch eine adäquate Reaktion auf die Topografie) als einer einladenden, sich öffnenden Geste eines Landhauses, entspricht der Vorgabe; ebenso der Grünraum, der das Haus touchiert, sich aber nicht in den Innenraum ergiesst, sondern nur zum Tal hin ein kleines Plateau bildet und zum südostlich angrenzenden Tobel steil abfällt.
Um die Landschaft ähnlich spektakulär in Szene zu setzen wie in Vittoriano Viganòs «casa scala», wenn diese nicht als Garten gestaltet werden soll, haben sich die Architekten das Thema der Terrasse vorgenommen, das auch in Portese eine tragende Rolle spielt. Die markante Schichtung des Baukörpers – Boden-, Deckenplatte und Geländer– bei Vittoriano Viganò (Bilder 15, 18) findet seine Analogie in der Übereinanderlagerung der Terrassen bei Giraudi & Wettstein (Bilder 1, 19).
«Rotierende» Terrassen, verankernder SPORN
Allerdings brechen Giraudi & Wettstein sowohl mit deren Linearität als auch mit deren eher statischer Ausformulierung. Sie haben sie dem Bau nicht einfach vorgelagert, sondern den ganzen Baukörper aus der Idee der Terrassierung entwickelt (nicht zu verwechseln mit der an Hanglagen beliebten, oft stereotypen Abtreppung).
Man könnte in dieser ausgeprägten Terrassierung sogar eine Reverenz an die landwirtschaftliche Nutzbarmachung des Bodens früherer Generationen erkennen. Und obwohl sie nicht den Höhenkurven folgt, gewinnt man diesen Eindruck ihrer je nach Niveau unterschiedlich konzipierten Ausgestaltung wegen (Bilder 8–13). Vor allem aber offenbart sich hier die zweite Inspirationsquelle: Hans Scharouns (1893–1972) 1930–1933 errichtetes «Haus Schminke» in Löbau (Bilder 6, 7).
In der Art, wie die Terrassen der drei oberen Stockwerke, die auf dem «Sockel» der beiden unteren Geschosse lagern, gegeneinander verschwenkt sind und um den Sporn zu rotieren scheinen, der optisch als Gelenk wirkt, verweisen sie auf das Löbauer Vorbild. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass die geschlossenen Volumen der drei Geschosse unterschiedlich ausgebildet sind, die Aussenfläche also von Stockwerk zu Stockwerk variiert.
Gegenüber Viganò haben Giraudi & Wettstein noch mit einer anderen Analogie reagiert. Die 30 m lange Treppe, die bei Viganòs «casa scala» nicht nur Erschliessung vom See her und Promenade architecturale ist, sondern auch als Anker figuriert, findet sein Pendant in dem Sporn, der die «casa Vergani» fixiert (Bilder 14, 16). Doch der Sporn birgt nicht die Erschliessung.
Promenade architecturale
Und es gibt auch keine externe Verbindung wie beim «Haus Schminke». Giraudi & Wettstein verlegen die Treppenanlage ins Innere, entwickeln sie aus dem Baukörper, tragen dem markanten Höhenunterschied Rechnung und kontrastieren die horizontale Lagerung der Terrassen. Die Promenade architecturale, die sowohl bei Viganò als auch bei Scharoun den Landschaftsraum durchmisst, entwickelt sich bei der «casa Vergani» aus der innenräumlichen Komposition, die den Aussenraum aus wechselnden Perspektiven in den Fokus nimmt, changierende Raumeindrücke generiert und einen zuweilen in fast labyrinthisches Wandeln versetzt. Das bewerkstelligen die Architekten nicht nur mit der wechselnden Orientierung der Terrassen, sondern auch mit der Lichtführung: Zu den vollflächigen Verglasungen der Terrassenseiten gesellen sich Oblichtbänder, welche die dunkleren Zonen des Hauses erhellen und ihnen Tiefe und Körperlichkeit verleihen, sowie Fenster, die unvermutete Ausblicke gewähren (Bild 11).
Passend zur Eingangssituation steigt man von der «Schleuse» der Garderobe den «Stollen» hinan, erreicht das 1. Geschoss, das Keller, Waschküche und – im Spickel des Sporns – Einlegerwohnung für das Au-pair-Mädchen aufnimmt. Hangseitig führt die Treppe nun auf das Niveau der Elternschlaf- und Kinderzimmer, die auf der Rückseite mit zwei Badezimmern alimentiert sind und in der Nordwestecke Raum für ein Spielzimmer lassen. Die Terrasse ist hier nur ein schmales Band. Die aussenräumliche Grosszügigkeit liegt auf den
Niveaus 4 und 5 (Wohn-und Essraum sowie Arbeitszimmer).
Während der Wohnraum sich auf die Terrasse ergiesst, zieht sich der Essbereich in die intime Nische des in den Hang dringenden Spickels auf der Rückseite zurück. Über dem Essbereich öffnet sich der Raum zu doppelter Höhe, sodass sich das Arbeitszimmer, das von hier aus über eine schmale Treppe erklommen werden kann, wie ein Hochstand ausnimmt – ein wahres Refugium.
Obwohl die beiden unteren Geschosse als Sockel fungieren – mithin eine andere Qualität haben als die lichte Kaskade der Terrassen –, unterschieden Giraudi & Wettstein nicht in der Materialwahl. Eine Abkehr vom Beton, der das Fundament des Hauses bildet, schien ihnen wenig sinnvoll. (Obwohl man sich ja eine – als Kontrast zum «wehrhaften» Sporn – lichtere Konstruktion der Terrassen durchaus vorstellen könnte.) Ausserdem sollten sie etwas vom «Brutalismus» des Viganò-Hauses vermitteln. Im Innern dagegen gibt es einen Materialwechsel: Wohn- und Schlafräume sind mit geöltem Eichenparkett bedeckt, Erschliessung (ausser in den oberen beiden Geschossen), Sanitärzellen und Terrassen mit in zahlreichen Farben schillerndem Schiefer. Dass Treppen und Terrassen dieselbe Materialisierung aufweisen, verdeutlicht den architekturhistorischen Bezug (Scharoun und Viganò) zwischen diesen Elementen und verwischt die Grenzen zwischen innen und aussen.
Dichotomische Interpretation
Giraudi & Wettstein haben das «Haus Schminke» und die «casa scala» in einen dichotomischen Dialog eingesponnen, einen Wechselgesang komponiert: Die Horizontalität und Linearität Viganòs wird mit der vertikalen Entwicklung und der rotierenden Stapelung der Terrassen à la Schminke verknüpft. Die optische Leichtigkeit der Konstruktion des Schminke-Hauses wird mit dem Brutalismus Viganòs gekoppelt. Die strenge Geometrie Viganòs wird mit der verspielten Scharouns zur Expressivität des Dreiecks «verschmolzen». Die Promenade architecturale entfaltet sich aus der Synthese der komplexen räumlichen Komposition: der Beziehung zwischen innerer linearer Wegführung und äusserer bewegter Terrassierung. Und: Die «casa scala» wird zur «casa le terrazze».TEC21, Mo., 2007.05.21
21. Mai 2007 Rahel Hartmann Schweizer
verknüpfte Bauwerke
Casa le terrazze