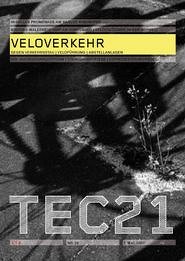Editorial
Editorial
Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen, die Tage werden länger, und die klassischen Radwanderwege sind von Velo Fahrenden bevölkert. Gut ausgebaute, breite, möglichst flache und vor allem sichere und verkehrsarme Routen sind offenbar der Traum aller Velofahrer.
Neben den Freizeitradlern benutzen aber vor allem Pendler und Schüler ihr Fahrrad zur Fortbewegung. Sie stellen ganz andere Anforderungen an die Linienführung durch die Städte und die Agglomerationen. Direkt und ohne Hindernisse heisst ihre
Devise. Wer mit 30 km / h auf dem Weg zur Arbeit ist, kann keinen Veloweg brauchen, der im 90°-Winkel abbiegt. Nicht abgesenkte Bordsteine, Tramschienen, Engstellen und Pfosten stören die Velofahrenden. Fehlendes Problembewusstsein und mangelnde Kenntnis im Umgang mit dem Veloverkehr können zu unerfreulichen Situationen führen. Hinweise, worauf bei der Gestaltung von Veloverbindungen zu achten ist, gibt der Autor des Artikels «Veloführung».
Am Ziel angekommen, stellt sich so mancher Radfahrer die Frage nach einem geeigneten Parkplatz und erlebt teilweise böse Überraschungen. Die Abstellanlagen sind permanent überfüllt. Der Artikel «Abstellanlagen» beschreibt die Anforderungen an eine Anlage, damit sie auch benutzt wird. Doch nicht nur die Planer und Ersteller von Velorouten und Abstellanlagen sind verantwortlich dafür, die Bevölkerung zum Umsteigen und Aufsteigen auf das Velo zu bewegen. Die gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsbeteiligten hat einen grossen Anteil daran. Um das Zusammenleben von Velo Fahrenden und Fussgängern zu verbessern, lanciert die Stadtpolizei Zürich derzeit eine Kampagne. Sie ist Teil der generellen Bemühungen von Polizei und Interessenverbänden um eine Verbesserung des Verkehrsklimas.
Wie es aus gesellschaftlicher und politischer Sicht um den Veloverkehr steht, beschreibt der Artikel «Gegen Verkehrsstau». Im Vordergrund steht die Agglomerationspolitik des Bundes. Zurzeit steht bei den meisten Agglomerationsprogrammen der Strassenbau im Vordergrund. Eines der Ziele ist aber auch, den Fuss- und Veloverkehr zu fördern. Ob die guten Vorsätze tatsächlich eingehalten werden und der Veloverkehr aus dem Schatten der Verkehrspolitik tritt, wird sich zeigen, sobald die geplanten Massnahmen umgesetzt werden. Daniela Dietsche
Inhalt
WETTBEWERBE
Neue Ausschreibungen / Vasellas Promenade am Basler Rheinufer
MAGAZIN
Binding-Waldpreis 2007 an Sumiswald / Velostationen in der Schweiz / Neat: teilweise Verzögerung / Beschaffungsverfahren im Brückenbau / Umbau Bahnhof Rapperswil / Stadion Aarau: neuer Anlauf / Kurzmeldungen
GEGEN VERKEHRSSTAU
René Hornung
Die Benutzung des Velos im alltäglichen Verkehr zu steigern ist eines der Ziele der Agglomerationsprogramme.
VELOFÜHRUNG
Christof Bähler
Veloverkehr auf öffentlichen und privaten Strassen führt häufig zu Konflikten. Diese lassen sich reduzieren, wenn Planer die Bedürfnisse der Velofahrenden kennen und berücksichtigen.
ABSTELLANLAGEN
Daniel Sigrist
Mit dem Velo von Tür zu Tür: Welche Anforderungen muss ein Veloparkplatz erfüllen?
SIA
Austauschplattform des SIA / Qualifikation für Stahlbaubetriebe / SIA 263: Alternative Kippwiderstandsregel
PRODUKTE
IMPRESSUM
VERANSTALTUNGEN
Veloführung
Veloverkehr ist volkswirtschaftlich hocheffizient und birgt ein hohes Wachstums- und Umsteigepotenzial. Er ist idealer Zubringer zum öffentlichen Verkehr und benötigt ein feinmaschiges, komfortables und sicheres Netz mit Einbindung der Haltestellen. Um die Anteile des Veloverkehrs zu erhöhen, sind insbesondere für die Pendler- und die Schulwege Anpassungen der Infrastruktur erforderlich.
Mit dem Bau isolierter Velowege lassen sich weder die Mobilitätsansprüche noch die gesellschaftliche Integration der Velofahrenden erfüllen. Im Gegensatz zu Velowegen oder markierten Radrouten beginnt und endet eine Velofahrt immer vor einer (Haus-)Tür. Ein Verkehrssystem, das Velo Fahrenden ein Inseldasein auf eng begrenzten Velowegen abverlangt, ist deshalb zum Scheitern verurteilt. Veloverkehr gehört in erster Linie auf die Strasse. Die erforderliche Netzdichte für den Veloverkehr und damit die flächendeckende Erschliessung vorhandener Quell- und Zielorte (Wohngebiete, Schulen, Arbeitsplätze, ÖV-Haltestellen, Einkaufsbereiche, Freizeitanlagen, Verwaltungen, Spitäler, Naherholungsgebiete) ist auf das bestehende Strassennetz angewiesen. Ein entscheidender Faktor für ein sicheres Verhalten im Verkehr ist die gegenseitige Wahrnehmung und Rücksichtnahme auf gemeinsamen Verkehrsflächen. Wird der motorisierte Verkehr hingegen abgetrennt, blenden die motorisierten Verkehrsteilnehmer die Velo Fahrenden aus. Dabei entstehen bei den Nahtstellen zwischen Radweg und Strasse (z. B. seitlichen Einmündungen, Rückführung auf die Fahrbahn) neue Gefahrenpunkte. Im Siedlungsbereich lassen die Bedingungen eine sinnvolle Verkehrstrennung gar nicht zu. Die Rahmenbedingungen für den Veloverkehr zu verbessern ist eine klassische Querschnittsaufgabe. Die möglichst umfassende Integration des Veloverkehrs in alle Sach- und Fachbereiche, die mit der Mobilität der Menschen zu tun haben, ist die Voraussetzung für ein gutes «Veloklima».[1]
Veloeigenschaften
Damit die Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Veloverkehrs durch die Benutzer angenommen werden, müssen sie in den Mischverkehr in Kenntnis der Eigenschaften des Velos und der Bedürfnisse der Velofahrenden integriert werden:2 Ein Velo benötigt einen Bewegungsraum von mindestens 1.20 m Breite. In Kurven steigt die beanspruchte Breite aufgrund der Schräglage auf mindestens 1.80 m. Die geometrische Ausbildung von Richtungswechseln ist abhängig von der Geschwindigkeit. Der minimale Radius (keine zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen erforderlich) beträgt 15 m bei 20 km/h resp. 30 m bei 30 km/h. Zwischen zwei Radien muss immer eine Zwischengerade eingeplant werden (ca. 3 Sekunden Fahrzeit).
Steigungen sind trotz moderner Fahrradtechnik ein Hindernis. 20 m Höhendifferenz entsprechen bezüglich Zeitaufwand und Energieeinsatz rund einem Kilometer zusätzlicher Weglänge. Unnötige Steigungen in der Anlage von Strassen sind zu vermeiden. Beispielsweise können Velos auf einem höheren Niveau durch Unterführungen geleitet werden. An Steigungen nimmt die Geschwindigkeit ab, der benötigte Bewegungsraum hingegen steigt. Radstreifen sollten deshalb 1.50 m Breite aufweisen, bei Steigungen 1.80 m.
Der Anhalteweg von Velos ist abhängig von der Geschwindigkeit, der Längsneigung und der Beschaffenheit der Fahrbahn (Rauigkeit, Nässe). Bei einer Geschwindigkeit von 20 km/h beträgt der Anhalteweg zwischen 12 und 16 m.
Verhalten und Bedürfnisse der Velo Fahrenden
Das Verhalten und die Bedürfnisse der Velofahrenden werden bestimmt durch ihre körperliche Konstitution, ihre Erfahrung und ihre Grundhaltung. Man unterscheidet zwischen Alltags- und Freizeitfahrern. Bei den Alltagsfahrern gibt es die Gruppe der Fahrradfahrer, die sicher und schnell unterwegs sind. Sie zeichnen sich durch eine selbstbewusste Fahrweise aus und bevorzugen direkte (Hauptverkehrs-) Verbindungen, möglichst ohne Hindernisse oder Haltepunkte. Der weniger verkehrsgewandte Fahrer bevorzugt gesicherte Übergänge und ruhige Nebenachsen ohne hohes Verkehrsaufkommen.
Für sportliche Fahrer, die in ihrer Freizeit oft in Gruppen unterwegs sind, gelten weitgehend die gleichen Ansprüche wie für den selbstsicheren Alltagsradler. Ganz im Gegensatz zu Velofahrenden, die das Fahrrad zur Erholung nutzen. Sie legen Wert auf erhöhte Sicherheit und erlebnisreiche, attraktive Routen mit guter Wegweisung.
Hauptverkehrsachsen
Die Hauptverkehrsstrassen sind in der Regel auch die Hauptachsen des Veloverkehrs. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Velofahrenden führen dazu, dass auf Verkehrshauptachsen gelegentlich verschiedene Angebote für die Velofahrenden sinnvoll sind. In Knotenbereichen mit einer Lichtsignalanlage ist zum Beispiel sowohl ein direktes (Handzeichen, Einspuren) als auch ein indirektes (Zwischenhalt am rechten Strassenrand) Linksabbiegen möglich. Zur Erhöhung der Sicherheit (Wahrnehmung) sind vorgezogene oder separate Warteräume vor den Motorfahrzeugen möglich. Bei kombinierten Geradeaus- und Rechtsabbiegespuren ist die Montage von Spiegeln sinnvoll, die auch für LKW-Fahrer Einsicht in den «toten Winkel» ermöglichen. Für die Haupt- und Abbiegebeziehungen des Veloverkehrs sind Radstreifen einzurichten.
In den Streckenabschnitten zwischen den Knoten wird die Sicherheit und Attraktivität des Veloverkehrs wesentlich durch den Querschnitt der Strasse, die Möglichkeiten zum Queren und zum Linksabbiegen bestimmt. Genügend breite Fahrspuren (Überholen durch Personen- und Lastwagen möglich) und tiefe oder überfahrbare Randabschlüsse erhöhen die subjektive und die effektive Sicherheit. Auf Engpässe ohne Überholmöglichkeit muss ein rund 120–150 m langer Abschnitt folgen, der es dem nachfolgenden Verkehr ermöglicht, die Velos zu überholen.
Breite, ausgeräumte Strassenräume verleiten die Fahrzeuglenker zu schnellem Fahren. Hier gilt es, die Anliegen des Veloverkehrs bei der Querschnittsbemessung zu berücksichtigen und im Interesse der Verkehrsicherheit so zu wählen, dass den Fahrzeuglenkern eine korrekte Einschätzung möglich ist, ob sie das Velo in genügendem Abstand überholen können.
Nebenachsen und Erschliessungsanlagen
Auf Nebenachsen des Veloverkehrs gilt vielerorts Tempo 30, verbunden mit Rechtsvortritt. Es ist darauf zu achten, dass durch Elemente der Verkehrsberuhigung keine neuen Gefahrenstellen für die Velofahrenden entstehen (Wahrnehmung Hindernisse / horizontale und vertikale Ausgestaltung). Das Öffnen von Einbahnstrassen für den Velogegenverkehr ermöglicht zusätzliche, direkte Verbindungen.
Auf den Erschliessungsstrassen gelten bei tiefer Geschwindigkeit dieselben Anforderungen wie auf den Hauptverkehrsachsen. Auch hier müssen die Begegnungsfälle Personenwagen/Lastwagen / Velo oder Fussgänger / Velo sicher ermöglicht werden und Geometrie und Sichtweiten der Anlagen dem Veloverkehr angepasst sein.
Integration in der Planung
Der öffentliche Strassenraum wird insbesondere im städtischen Umfeld von vielen Nutzungen beansprucht: Fussverkehr, Behinderte, motorisierter Individualverkehr, öffentlicher Verkehr, Parken, Car- / Taxi-Standplätze, Anlieferung, Notfallzufahrt, Aussenbestuhlung der Gastgewerbe, Informationssäulen, Plakatständer, öffentliche Telefone oder Entsorgungsstellen. Daneben muss er hohe städtebauliche Kriterien, zum Beispiel das Aufwerten von Aussenräumen, das Erhalten von Strassenzügen, das Schaffen von Freiräumen und Begrünung, erfüllen. Die Planung und die Umsetzung von Verbesserungen für den Veloverkehr sind deshalb anspruchsvolle Aufgaben.
Die frühzeitige Koordination ist Voraussetzung, dass den verschiedenen, teilweise gegenläufigen Interessen Rechnung getragen werden kann. Damit lassen sich Einsprachen wie auch schwierige, oft nicht mehr mögliche Nachbesserungen vermeiden. Hilfreich ist ein klar definiertes Verfahren, um Differenzen zu bereinigen, nötigenfalls ist eine Interessensabwägung vorzunehmen.
Die Handlungsfelder im Veloverkehrsnetz sind periodisch zu erheben und daraus Schwachstellen und Lücken abzuleiten. Der ausgewiesene Handlungsbedarf aus Sicht des Veloverkehrs soll in Kombination mit Grundsätzen zur Umsetzung in einem behördenverbindlichen Richtplan festgehalten werden.
Ausbildung und Kommunikation
Wesentliche Elemente einer Strategie zur Förderung des Veloverkehrs liegen neben den Ausbauten der Infrastruktur in der Verkehrserziehung und der Bildung, der Beratung und der Kommunikation. Kinder sollen im Schulalter das Velofahren und sicheres Verkehrsverhalten erlernen. Die Beratung der Planer und der Bevölkerung kann verstärkt werden, indem auf der Stufe von Gemeinden und Kantonen weitere Fachstellen geschaffen werden. Die Fachstellen helfen mit, dass die öffentliche Hand ihrer Vorbildfunktion in der Veloförderung gerecht werden kann. Das Wissen um eine fachgerechte Integration des Veloverkehrs muss in die Ausbildung und die Weiterbildung einfliessen. Mit der Kommunikation realisierter Verbesserungen ist die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, das Velo zu benutzen.
[ Christof Bähler, Bauingenieur FH/NDS Umwelttechnik, Fachstelle Fussgänger- und Veloverkehr Tiefbauamt Kanton Bern ]TEC21, Fr., 2007.05.18
18. Mai 2007 Christof Bähler