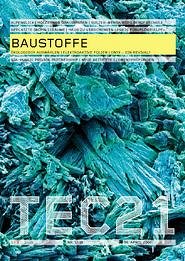Editorial
Editorial
Nach welchen Kriterien wählen ArchitektInnen, Planende oder Bauherrschaften die Materialien für ein Bauprojekt aus? Es sind die gleichen, die auch bei Kaufentscheidungen in vielen anderen Lebensbereichen eine Rolle spielen: Ästhetik, Funktionalität und Preis. Oft ist es die Ästhetik eines Materials, die uns zuerst ins Auge fällt und uns gefühlsmässig für ein Produkt einnimmt. Onyx, dessen Verwendung in der Architektur einer der Fachartikel in diesem Heft nachzeichnet, ist ein Baustoff, der vor allem durch seine Ästhetik besticht. Seine honigfarbene oder rostrote Färbung kommt besonders dann zur Geltung, wenn er in dünnen, lichtdurchlässigen Platten verwendet wird. Entsprechend wurde er schon Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts von Architekten eingesetzt, um Räumen ein besonders edles und würdiges Ambiente zu verleihen. In den letzten Jahren erlebt Onyx ein Revival. So wurden unter anderem der Gebetsraum im neuen FIFA-Hauptsitz und der Eingangsbereich im Erweiterungsbau des Museums Rietberg in Zürich mit Onyx gestaltet.
Der funktionale Aspekt steht dagegen bei der Neuentwicklung eines Materials an der Empa im Vordergrund, dem ein weiterer Fachartikel gewidmet ist. Elektroaktive Polymere können durch die direkte Umwandlung von elektrischer Energie in mechanische Arbeit einem Muskelgewebe vergleichbare Funktionen ausüben. Mit diesen Materialien realisieren Forscher an der Empa jetzt ein dem Flossenschlag der Fische nachempfundenes Antriebskonzept für Luftschiffe. Noch funktioniert dies erst am vereinfachten Modell. Bevor in ein paar Jahren tatsächlich Luftschiffe mit dem lautlosen und sehr effizienten Antrieb für mehr Ruhe über unseren Köpfen sorgen, müssen noch einige technische Probleme gelöst werden.
Ein Kriterium, das bei der Auswahl von (Bau-)Produkten oft unter den Tisch fällt, ist die Umweltbelastung. Ein weiterer Fachartikel stellt daher mit dem Deklarationsraster ein Werkzeug vor, das der SIA bereits vor 15 Jahren geschaffen hat, um Architekten und Planern die ökologische Beurteilung von Baustoffen zu erleichtern. Mit diesem Raster, der die wichtigsten ökologisch relevanten Daten für alle Lebensphasen eines Produktes dokumentiert, wurde in der Schweiz Pionierarbeit geleistet. Mittlerweile wurden in einigen Ländern ähnliche Instrumente entwickelt; eine europäische Norm ist in Arbeit. Trotz seiner langen Vorgeschichte wird der Deklarationsraster aber bisher von den wenigsten Planern benutzt. Woran liegt das? Differenzierte ökologische Entscheide sind komplex und brauchen daher Zeit, um sich damit zu befassen. Die gewaltigen Materialströme, welche die Bauindustrie generiert, und das entsprechend grosse Potenzial, durch die Auswahl von Baustoffen Ressourcen und Energie zu sparen, sollten uns diesen Aufwand aber wert sein. Der Deklarationsraster kommt uns auf halbem Weg entgegen, indem er komplexe Informationen aus der Bauchemie oder dem Energiebereich in eine übersichtliche Form bringt, die auch dem Laien nach kurzer Einarbeitung fundierte Entscheide ermöglicht.
Claudia Carle
Inhalt
WETTBEWERBE
Neue Ausschreibungen / Alpenblick aus der Agglomeration / Hölzernes Graubünden / Von der Sulzer-Mensa zur Berufsschule
MAGAZIN
Geplatzte (Wohn-)Träume / Quartiermagnet / Haus zu verschenken / Paris-Stipendien für Architekten / «Flore-Alpe» in Champex aus- gezeichnet
SIA
PPP an der Präsidentenkonferenz / Beitritte zum SIA im 1. Quartal 2007 / Zementprüfungen
ÖKOLOGISCH AUSWÄHLEN
Hans D. Halter, Roland Ganz, Rolf Frischknecht
Der Deklarationsraster des SIA hilft Bauherrschaften und Planenden bei der Auswahl von Bauprodukten, welche die Umwelt möglichst wenig belasten.
LAUTLOS FLIEGEN DANK ELEKTROAKTIVEN FOLIEN
Aldo Rota
An der Empa wird das Fortbewegungsprinzip der Forelle mit Hilfe «künstlicher Muskeln» als innovatives, geräuscharmes Antriebskonzept für Prallluftschiffe adaptiert.
ONYX - EIN REVIVAL?
Bret Kraus
Bereits zu Beginn des 20. Jh. haben Architekten Onyx in ihren Bauten verwendet. Es scheint, als erlebe das transluzente Material ein Revival: In zwei eben fertig gestellten Zürcher Bauten wurde der Stein eingesetzt.
PRODUKTE
IMPRESSUM
VERANSTALTUNGEN
Ökologisch auswählen
Bauprodukte belasten während ihrer gesamten Lebensdauer die Umwelt. Bauherrschaften und Planende können durch ihre Materialwahl aber wesentlich zur Verminderung dieser Belastungen beitragen. Die nötigen Informationen dafür liefert der Deklarationsraster des SIA.
Nur wenige ArchitektInnen und Planende sind so umfassend ausgebildet, dass sie sich im Dschungel der Bauchemie ohne Hilfe zurechtfinden. Und doch müsste sich jeder am Bau Verantwortliche auch von diesem Aspekt des Bauens ein Bild machen, um Produkte auswählen zu können, welche die Umwelt möglichst wenig belasten. Um dies zu erleichtern, hat der SIA die Norm 493 «Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten» geschaffen. Im Deklarationsraster dokumentieren die Hersteller die wichtigsten ökologisch relevanten Daten für alle Lebensphasen eines Produktes von der Herstellung und Verarbeitung über die Nutzung bis hin zur späteren Entsorgung. Der Raster ist Grundlage für eine klare, standardisierte Verständigung zwischen Herstellern und Anwendern. Herstellern ermöglicht der Raster eine einheitliche, übersichtliche Deklaration von ökologisch relevanten Merkmalen ihrer Produkte. Den Anwendern erleichtert er das Abfragen dieser Merkmale und hilft damit, in einem wenig bekannten Fachgebiet professionell zu entscheiden und die ökologische Qualität der Baukonstruktionen zu verbessern.
Mittelweg zwischen Volldeklaration und Label
Natürlich erhält man noch mehr Informationen, wenn man das Datenblatt eines Produktes studiert, allerdings ist die Volldeklaration für Laien oft unverständlich. Im Raster werden dagegen gezielt nur die ökologisch relevantesten Eigenschaften erfasst und so dargestellt, dass sie für die Anwender leichter interpretierbar sind.
Der Deklarationsraster beschränkt sich dabei auf eindeutige und objektiv überprüfbare Merkmale. Zwar gehören beispielsweise auch das Alterungsverhalten oder allenfalls der Wartungsaufwand zu den wesentlichen Angaben für eine ökologische Beurteilung von Baustoffen, aber da diese Daten nicht eindeutig definierbar sind, fehlen sie im Deklarationsraster. Es macht wenig Sinn, sie vom Hersteller deklarieren zu lassen, da jeder Angaben nach seiner eigenen Auffassung machen würde.
Trotzdem enthält der Raster aber so viele Daten, dass sie bei den meisten Fragestellungen für eine Entscheidung ausreichen. Anders als beispielsweise ein Label, das nur anzeigt, ob ein Produkt als ökologisch gut oder schlecht eingeschätzt wurde, ermöglicht der Raster differenziertere Entscheidungen. Es gibt nicht nur gute oder schlechte Produkte, sondern für eine bestimmte Anwendung geeignete oder weniger geeignete.
Interpretation liegt beim Anwender
Das heisst, die Anwender müssen die Daten im Deklarationsraster selbst interpretieren. Dafür gibt es eine Interpretationshilfe (siehe Kasten Seite 28). Nach der Lektüre ist man noch lange kein Bauchemiker, doch wichtige tägliche Entscheide kann man selbst fällen.
Bauherrschaften verlangen giftstofffreie Baustoffe. Wesentlich ist beim Begriff «Gift» jedoch die Menge. Eine Meldung, dass im Mehl Arsen gefunden worden sei, muss nicht zwangsläufig zur Meidung aller aus Mehl hergestellten Nahrungsmittel führen. Rasteranwender werden zuerst nach dem Anteil des Arsens an der Gesamtmenge fragen und dann entscheiden. In den letzten Jahren wurden etliche Baumaterialien mit Hinweisen auf Spuren von Schadstoffen disqualifiziert, obwohl diese Spuren zum Teil weit unter einer humantoxikologischen Relevanz lagen. Andererseits gibt es Stoffe, die schon in sehr kleinen Mengen schädlich sein können. Diese Grenzen sind von Stoff zu Stoff verschieden. Die Interpretationshilfe zeigt Planenden, wo wie viel von einem Schadstoff relevant ist.
Die Gefährdung kann je nach Beobachtungsbereich unterschiedlich sein. Bei der Herstellung treten oft ganz andere Gefährdungen auf als bei der Anwendung, der Nutzung oder der Entsorgung. Alle Gefährdungen müssen bei einer Stoffbewertung mit berücksichtigt werden. Die Resultate sind nicht immer eindeutig.
Wenn es um die Bewertung von Konstruktionen geht, müssen neben ökologischen Merkmalen auch noch andere Aspekte wie die Leistungsfähigkeit (Tragkraft, Dämmeigenschaften usw.), der Preis, aber auch ästhetische Belange mit einbezogen werden. Daraus versteht sich von selbst, dass der Deklarationsraster nur Hilfe, aber nie Hauptbewertung sein kann.
Der Raster zeigt dem Anwender auch die Grenzen seiner Fachkompetenz. Für spezielle Fragen wird der Planer nicht auf eine Zusammenarbeit mit Fachleuten verzichten können.
Gegenseitige Kontrolle
Die Rasterblätter, in welche die Produktehersteller ihre Daten eintragen, wurden früher in Papierform verschickt. Später konnte eine ganze Anzahl der Raster auf der Internetseite des SIA abgefragt werden. Ab Ende Juni 2007 ist die Rasterabgabe in Papierform durch die Hersteller nicht mehr konform. Raster sollen nur noch vom Netz heruntergeladen werden können (www.sia.ch/deklaration). Weshalb hat die Normenkommission diesen Weg empfohlen? Vom SIA können die Deklarationen nicht auf ihre Richtigkeit geprüft werden. Es wird auf die gegenseitige Überwachung durch Mitbewerber gebaut. Ins Netz gestellt, sind die Daten jederzeit von der Konkurrenz einsehbar.
Anwendungsbereiche
Der Raster kann heute von den Planenden in drei Arbeitsbereichen eingesetzt werden:
– bei der aktiven Ausgrenzung von Produkten (z.B. solche mit FCKW und HFCKW)
– bei der Information über unbekannte Produkte im Fall von Variantenofferten bei Submissionen
– bei der ökologischen Optimierung von Bauteilen und Konstruktionen
Wie die Anwendung des Deklarationsrasters in der Praxis aussehen kann, sollen zwei Beispiele illustrieren. Im ersten Fall, bei der Sanierung des Polizeigebäudes in Schwyz, wurden mit Hilfe der Rasterinformationen Baumaterialien ausgewählt, die ein gesundes Innenraumklima garantieren.Das um 1900 erstellte Gebäude wurde 2005/2006 saniert. Da die Bauherrschaft ein gesundes Innenraumklima verlangte, wurde der Umbau mit der Planungsleistung Innenraumklima begleitet. Ziel dieser Leistung ist die Auswahl bestmöglicher Baumaterialien zur Einhaltung tiefer Schadstoffkonzentrationen nach Bezug der Baute. Dies wird durch gezielte Überprüfung und Optimierung der Materialentscheide in den verschiedenen Planungsphasen und durch Kontrolle auf der Baustelle erreicht. Für den Innenraumspezialisten stellen Deklarationen das zentrale Werkzeug dar. Anhand der darin enthaltenen Informationen werden die Baumaterialien bezüglich des Emissionspotenzials beurteilt und wenn nötig Verbesserungsvorschläge unterbreitet. Zusätzlich werden in einer Zielvereinbarung einzuhaltende Schadstoffwerte vereinbart, die durch den Auftragnehmer (Bauunternehmer) verpflichtend einzuhalten sind. Werden die in der Zielvereinbarung definierten Grenzen überschritten, ist der dafür verantwortliche Unternehmer zur Herstellung des vereinbarten Zustandes verpflichtet. Im konkreten Beispiel wurden 55 Baumaterialien beurteilt. Für rund ein Fünftel der untersuchten Produkte wurden ein hohes Emissionspotenzial ermittelt, und es wurden Optimierungsvarianten vorgeschlagen. Betroffen davon waren die Arbeitsbereiche Inneneinrichtung, Bodenbeläge und Malerarbeiten. So wurden beispielsweise Spanplatten im Wandbereich durch Gipskartonplatten ersetzt, um Formaldehydemissionen zu vermeiden.
Aber auch bei einer bereits eingetretenen Schadstoffbelastung im Innenraum können die Deklarationen die Suche nach der Schadstoffquelle erleichtern. Ein typisches Beispiel ist eine Wohnung in Zürich, in der die Eigentümer noch ein Jahr nach dem Kauf über eine nach Fisch riechende Geruchsbelästigung klagten. Die Verkäuferin entschied, das Problem fachgerecht abklären zu lassen. Dabei wurde, wie bei Geruchsproblemen üblich, schrittweise vorgegangen. Zuerst wurde in der Raumluft nach chemischen Auffälligkeiten gesucht, jedoch wurden keine solchen gefunden. In einem zweiten Schritt listete man daher alle im Raum verwendeten Baumaterialien auf und suchte aufgrund von Deklarationen und Geruchsprüfungen nach der Geruchsquelle. Bei den Deklarationen stützte man sich auf Sicherheitsdatenblätter, VSLF- (Farben und Lacke) und SIA-Deklarationen. Auf der Basis grundlegender Kenntnisse in Materialkunde, Chemie und Innenraumproblematik wurden aus diesen Daten Materialien identifiziert, die als Geruchsquelle in Frage kamen. Durch Geruchsprüfungen an Materialproben der verdächtigen Baustoffe konnte der verwendete Trittschallschutz im Unterlagsboden als Quelle des Fischgeruchs identifiziert werden. Als Grund wurde ein zu hoher Ammoniakgehalt im Baustoff vermutet. Ammoniak wird standardmässig im Herstellungsprozess von Trittschallschutzmatten gebraucht. Aufgrund der hohen Flüchtigkeit entweicht der Stoff in der Regel schnell. Werden Platten mit einem hohen Ammoniakrestgehalt jedoch zu schnell eingebaut und durch den Bodenbelag eingeschlossen, können lang andauernde Immissionen entstehen. Zur Abführung des restlichen Ammoniaks wurde der Unterlagsboden mittels Dämmschichttrocknung saniert. Seither sind die Käufer vom Fischgeruch befreit.
Intuition und Information
Der Deklarationsraster trägt zu einer Versachlichung der Diskussion über das ökologische Bauen bei. Er sensibilisiert Hersteller und Benützer und bietet gleichzeitig eine Orientierungshilfe an. Die Hilfe ist so gestaltet, dass sie nicht fertige Entscheide liefert (wie z.B. ein Ökolabel), sondern dass für Entscheide nachprüfbare Fakten geliefert werden. Nicht bei jeder Materialwahl, sicher aber dann, wenn ökologisch relevante Merkmale diskutiert werden müssen, ist der Deklarationsraster ein unerlässliches Hilfsmittel.
Es gibt Planende die sich nicht um «derart technische Dinge» wie Inhaltstoffe und Bauproduktdeklarationen kümmern. Sie entscheiden nach Gefühl und wollen sich bei einer solchen Wahl auf ihre Intuition und Erfahrung verlassen. Die Intuition ist ohne Zweifel ein wichtiges Element in der Planung. Eine Sichtweise jedoch, die sich ausschliesslich auf die Intuition verlässt, ist wenig professionell und oft auch falsch.
---
Kasten 1:
Blick über die Grenze
Das Quantifizieren der Umweltauswirkungen von Bauprodukten beschäftigt nicht nur die Schweiz. Auch international befassen sich immer mehr Architektinnen und Planer, Forschungsinstitute und Industrieverbände mit Fragen rund um die Belastung der Umwelt durch das Errichten, Nutzen und Rückbauen von Gebäuden. Der SIA hat mit dem Deklarationsraster auf diesem Gebiet Pionierarbeit geleistet. In den letzten Jahren wurden in einigen Ländern Umweltproduktdeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration) für Produkte aus den verschiedensten Bereichen entwickelt (z.B. Nahrungsmittel, Chemikalien, Strom, Bauprodukte).
Eine Umweltproduktdeklaration von Baustoffen enthält wie der Deklarationsraster auf wenigen Seiten umweltrelevante Informationen zum gesamten Lebensweg eines Produktes. Neben bauphysikalischen Informationen werden Angaben gemacht zu den Grundstoffen und deren Herkunft, der Herstellungsprozess wird beschrieben, und Hinweise zur Verarbeitung werden gegeben. Die Umweltproduktdeklaration kann Angaben enthalten zur Nachnutzungsphase. Auch Nachweise (zum Beispiel bezüglich Brennbarkeit) und Prüfungen sind dokumentiert. Kernelement der Umweltproduktdeklaration ist eine Ökobilanz nach klar vorgegebenen Regeln. Für jedes Produkt müssen Ökobilanzdaten zur Verfügung gestellt werden, von der Rohstoffnutzung bis zum Fabriktor, optional auch inklusive der Nutzungs- und Nachnutzungsphase. Insofern gehen EPD deutlich mehr in die Tiefe als der Deklarationsraster. Neben EPD auf Bauproduktebene können auch EPD von Bauelementen und ganzen Gebäuden (inklusive Rückbau) nach einer einheitlich vorgegebenen Methodik bereitgestellt werden.
EPD im Baubereich gibt es mittlerweile beispielsweise in Frankreich, Grossbritannien oder den Niederlanden. In den letzten Jahren wurde auch eine internationale Norm für Umweltproduktdeklarationen im Baubereich entwickelt, die ISO-Norm 21930. Zurzeit wird im Rahmen des CEN-Mandats 350 an einer europäischen Norm gearbeitet, welche die internationale Norm umsetzt und in ausgewählten Bereichen weiter präzisiert. In der Schweiz wird man diese Entwicklung abwarten und dann entscheiden, ob und inwiefern der Deklarationsraster angepasst wird.
Rolf Frischknecht, Dr. sc. techn., ESU-services Ltd.,
Uster, frischknecht(at)esu-services.ch
Weitere Informationen: www.environdec.com
---
Kasten 2:
Dokumente zum Deklarationsraster
Norm 493
Die eigentliche Norm ist lediglich für Hersteller und Materiallieferanten interessant. Sie beschreibt, wie deklariert werden muss.
rasterblätter
Die Rasterblätter, in welche die Daten von den HerstellerInnen eingetragen werden, stehen pro Materialgruppe mit materialspezifischen Fragen zur Verfügung. Für folgende Materialgruppen sind bis heute Raster vorhanden:
– 01 Beton, Mauersteine und andere Massivbaustoffe
– 02 Mörtel und Putze
– 03 Flachglas
– 04 Metallbaustoffe
– 05 Holzwerkstoffe
– 06 Klebstoffe
– 07 Fugendichtungsmassen
– 08 Dichtungsbahnen und Schutzfolien
– 09 Wärmedämmstoffe
– 10 Tapeten
– 11 Bodenbeläge
– 12 Türen
– 13 Rohre
– 14 Beschichtungen und Verbundmaterialien
– 15 Neutraler Raster für andere Materialien
Herstelleranleitung
Für die Hersteller stehen Anleitungen zum Ausfüllen der Raster zur Verfügung. Sie machen über die Norm hinaus noch detailliertere Angaben zu branchenspezifischen Problemen.
Interpretationshilfe
Quasi als Handbuch zur Norm wurde eine Interpretationshilfe geschaffen (SIA D 093
«Deklaration ökologischer Merkmale von Baustoffen nach SIA 493 / Erläuterungen
und Interpretationen»). Sie soll den Anwendern helfen, den Raster zu verstehen. Hinweise
auf Bewertungsmethoden zeigen einige mögliche Anwendungen. Ein grosses Literaturverzeichnis
erleichtert auch Anfängern den Einstieg in die Materie.
Bezugsquelle: Schwabe AG, 4132 Muttenz, distrubution(at)sia.chTEC21, Mo., 2007.05.07
07. Mai 2007 Hans D. Halter, Roland Ganz
Lautlos Fliegen dank elektroaktiven Folien
Unter den aktuellen Werkstoffentwicklungen gehören die elektroaktiven Polymere (EAP) zu den innovativsten Ansätzen. Durch direkte Umwandlung von elektrischer Energie in mechanische Arbeit können sie dem Muskelgewebe vergleichbare Funktionen ausüben. Mit diesen Materialien realisieren Forscher an der Empa jezt ein der Natur bzw. den Fischen abgeschautes, lautloses Antriebskonzept für Luftschiffe.
Für moderne Transport- und Trägersysteme werden seit einigen Jahren wieder Konzepte «leichter als Luft»[1] in Betracht gezogen. Während Starrluftschiffe (Zeppeline) zwischen 1900 und dem 2. Weltkrieg erfolgreich eingesetzt wurden, sind in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die halbstarren Luftschiffe (Cargolifter, Zeppelin NT) oder reine Prallluftschiffe in den Vordergrund gerückt. Die starren und halbstarren Luftschiffe beanspruchen einen enormen Platz für die Lagerung. Demgegenüber sind die Prallluftschiffe im Prinzip entleerbar und können so auf einem viel kleineren Raum gelagert werden. [2]
Der Antrieb von Luftschiffen wird über Propeller oder Impeller erzeugt. Drehmotoren bringen dabei ihre Leistung über eine rotierende Welle auf einen mit 1000 – 3000 Umdrehungen pro Minute drehenden Propeller/Impeller mit einem typischen Duchmesser von ca. 2 m, was naturgemäss mit einer beträchtlichen Lärmentwicklung verbunden ist. Im stationären Horizontalflug sind der Vortrieb des Propellerstrahls und der Luftwiderstand des Luftschiffkörpers im Gleichgewicht. Infolge der grossen Geschwindigkeitsdifferenz zwischen der Luft hinter dem Luftschiffkörper (Nachlauf) und der Luft hinter dem Propeller hat dieses Antriebskonzept bei Luftschiffen einen schlechten Wirkungsgrad.[3]
Schwanzflossenschlag als Vortrieb
Fische müssen ebenfalls einen Vortrieb erzeugen, um im Wasser die hydrodynamische Widerstandskraft kompensieren zu können. Die Forelle erzeugt den Vortrieb durch eine oszillierende Biegung des Rumpfes und eine entgegengesetzt gerichtete Biegung der Schwanzflosse (Bild 1).
Das Vortriebskonzept der Forelle durch Wechselwirkung zwischen den beiden gekoppelten Biegeschwingungen, als oszillatorischer Antrieb bezeichnet, hinterlässt hinter dem Fischkörper stehende Wirbel (Bild 2). Die technische Vereinfachung, die die beiden Körperbiegungen auf die Drehung dreier starrer Körper gegeneinander reduziert, wird als «Biege-Dreh-Schwanzschlag» bezeichnet. Mit hydrodynamischen Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass damit ebenfalls ein Vortrieb erreicht werden kann und dass diese Vortriebsart wesentlich effizienter ist als heute bekannte technische Lösungen. Dies liegt im Wesentlichen darin begründet, dass der Ort, an dem der Antrieb erzeugt wird, mit dem Ort zusammenfällt, an dem der Widerstand erzeugt wird. Damit gibt es hinter dem Fisch weder einen Nachlauf noch einen durch seitliche Propeller erzeugten Wasserstrahl, es bleiben nur an Ort stehende Wirbel zurück, die wenig Energie beinhalten.
Dieses Antriebskonzept ermöglicht es auch, eine seitliche Kraft auf den Körper auszuüben. Erfolgt die Biegebewegung nicht symmetrisch nach links und rechts, kann eine Richtungsänderung erreicht werden. Eine überlagerte Biegung des Rumpfes nach oben oder unten kann entsprechend auch eine Richtungsänderung in der Vertikalen ergeben (beispielsweise bei Walen).
EAP-Technologie an der EMPA
Seit einigen Jahren ist in Robotik und biomedizinischer Technik ein neues Aktorprinzip, die elektroaktiven Polymere (EAP), erforscht worden.4 Dieses ist geradezu prädestiniert für einen dem Flossenschlag der Fische nachempfundenen Luftschiffantrieb. Die häufigste Bauart sind die so genannten Dielektrischen EAP, die nach dem Prinzip eines verformbaren elektrostatischen Kondensators elektrische Energie direkt in mechanische Arbeit umwandeln.
Ein Elastomerfilm (Acryl oder Silikon) liegt zwischen zwei sehr nachgiebigen Elektroden (beispielsweise Grafitpulver-Schichten). Wird eine elektrische Spannung von ca. 5 kV an die Elektroden angelegt, werden elektrostatische Anziehungskräfte zwischen den beiden Elektroden erzeugt. Dadurch wird der Elastomerfilm senkrecht zur Ebene gequetscht. Da ein Elastomer praktisch inkompressibel ist, muss die Stauchung durch eine Flächenvergrösserung kompensiert werden. Diese Verformung kann genutzt werden, um mechanische Arbeit an der Umgebung zu leisten. Der entstehende Elektrodendruck ist abhängig von der elektrischen Spannung, der Schichtdicke des Elastomerfilmes und systemspezifischen Material- respektive Naturkonstanten.
An verschiedenen Prototypen (z. B. planare Aktoren, einschichtige und mehrschichtige, gerollte und faserartige Aktoren) wurde das Wirkprinzip erprobt. Anwendungen sind denkbar als Pumpen, Lautsprechermembranen oder als Stellglieder für die Automation. Bis heute ist noch keine kommerzielle Umsetzung erfolgt.
Die weitere Entwicklung umfasst die Optimierung der Beschichtung, die Verringerung der Schichtdicken und die Bereitstellung von effizienten Herstellprozessen. Eines der anvisierten Anwendungsgebiete ist die biomedizinische Technik, denn künstliche EAP-Muskeln sind bei vergleichbarer Leistungsfähigkeit etwa gleich gross und gleich schwer wie natürliche Muskeln. Dank ihrer hohen Elastizität können sie sich ebenfalls unzählige Male ausdehnen und wieder zusammenziehen. Bereits im März 2005 fand am California Institute of Technology in San Diego eine publikumswirkame «Weltmeisterschaft im Armdrücken mit Robotern» statt. Der aus über 250 zylinderförmigen EAP-Muskelsträngen aufgebaute Empa-Kraftarm verlor dabei aber ebenso kläglich wie seine amerikanischen Konkurrenten gegen eine 17-jährige Studentin, was weniger auf die theoretisch verfügbare Kraft als auf die ungenaue Aktivierung zurückzuführen war. Seither sind bezüglich der Steuerung von EAP aber schon grosse Fortschritte erzielt worden.
Beim Empa-Luftschiff fungieren die «EAP-Muskeln» als Teil der Hülle, im Vergleich zum konventionellen propellergetriebenen Luftschiff verschmilzt gewissermassen der «Motor samt Getriebe» mit dem Körper des Luftschiffs (Bild 3). Bis anhin ist an der Empa die Anwendbarkeit von EAP im Luftschiffbau allerdings erst für die konventionelle Steuerung von Prallluftschiffen mittels Rudern an vereinfachten Modellen nachgewiesen worden (Bild 4).
Machbarkeit des Oszillatorischen Antriebs
Ein Fisch im Wasser und ein Luftschiff in der Luft sind beides Körper, die sich in einem Fluid bewegen. Daher sind die fluiddynamischen Gesetzmässigkeiten gültig. Die Ähnlichkeitstheorie besagt, dass Resultate einer geometrisch ähnlichen Modellanordnung vollständig auf das Original übertragbar sind, falls die charakteristischen hydrodynamischen Kenngrössen gleich sind.[5]
Beim Fisch und seinem Schwanzschlag sind nebst den Druckkräften die Trägheitskräfte, die Reibungskräfte und die Kräfte infolge des instationären Strömungsanteils relevant. Eine Modellrechnung hat ergeben, dass ein 6 m langes Luftschiff, das mit 1 m / s durch die Luft gleitet, mit den Verhältnissen bei einer Forelle vergleichbar ist, die 0.3 m lang ist und mit 1.2 m / s durch Wasser schwimmt, wenn das Luftschiff geometrisch ähnliche Bewegungen mit einer Frequenz von ca. 0.2 Hz ausführen kann (Amplitude des Schwanzschlages = 1.2 m). Der oszillatorische Antrieb für Prallluftschiffe ist demnach aerodynamisch machbar.
Ein Prallluftschiff muss sein Eigengewicht und die Nutzlast mittels des aerostatischen Auftriebs kompensieren können. Zudem müssen Auftriebsverteilung und Gewichtsverteilung derart sein, dass das Luftschiff in seiner horizontalen Lage stabil ist. Die erste Bedingung liefert bei vorgegebenem Eigengewicht pro Hüllenfläche die minimale Grösse, damit ein Schwebezustand erreichbar ist. Die aerodynamisch günstigste Form kann wiederum aus den Formen der Fische abgeleitet werden, denn die Ähnlichkeitstheorie ist auch hier gültig. Fische weisen ein Verhältnis Breite zu Länge von 0.18 bis 0.24 auf und liegen damit nahe beim optimalen Grössenverhältnis, das zu minimalem Widerstand führt. Als einfache technische Form für das Prallluftschiff im passiven Zustand wurde ein Ellipsoid von 6 m Länge und mit einem Dickenverhältnis von 0.25 gewählt. Im aktivierten Zustand wird dieser Form durch EAP-Folien eine doppelte Krümmung überlagert.
Die Analyse der Bewegung der Forelle zeigt, dass im Wesentlichen zwei gegenläufig schwingende Biegungen des Körpers notwendig sind, um Vortrieb zu erreichen (einfachster Fall ist der Biege-Dreh-Schlag). Die erste Biegung ist eine Rumpfbiegung, die zweite Biegung ist im Übergangsbereich von Rumpf zu Schwanz. Beide Biegungen erreichen beim Start der Forelle einen Krümmungsradius von ca. der doppelten Breite des Rumpfes an dieser Stelle (R / d = 2). Im nicht beschleunigten Schnellschwimmen sind die Krümmungsradien grösser (R / d = 0.5). Mittels einfacher Geometrie kann gezeigt werden, dass für die Haut der Forelle (Hülle des Prallluftschiffes) Dehnungen von bis zu 50 % notwendig sind, um diese Biegungen erzeugen zu können.
Aktive Hülle
Die Hülle des Prallluftschiffes wird aus den zwei funktionellen Lagen, der Stützhülle und der EAP-Beschichtung, aufgebaut. Die Stützhülle ist eine formstabile, flexible, möglichst leichte, gasdichte Membran. Idealerweise weist sie eine hohe Zugfestigkeit bei einer geringen Zugnachgiebigkeit und einer sehr hohen Nachgiebigkeit im Druckbereich auf (Faltenbildung möglich). Metallisch bedampfte Ballonhüllen sind relativ reissfest, da sie aus zähem Kunststoff bestehen. Sie sind dank der metallischen Bedampfung sehr gasdicht und lassen sich zudem gut falten.
Die EAP-Beschichtung besteht aus mindestens einer Lage eines Sandwichaufbaus (leitende Schicht, dielektrische Folie, leitende Schicht). Falls diese EAP-Beschichtung im aktivierten Zustand mit der gestrafften Stützhülle (Zustand ohne Falten) vereint wird, weist die Gesamthülle spezifische Eigenschaften auf: Im allseits aktivierten Zustand kann unter kontrolliertem leichtem Überdruck die Hülle in die Grundform gebracht werden. Der Innendruck führt zu einer Zugvorspannung der Gesamthülle, wodurch diese ihre Grundform einnimmt. Werden nun Teilbereiche der Hülle deaktiviert, erfolgt in diesen Zonen eine Schrumpfung der EAP-Schicht. Da der Widerstand der Stützhülle gegen Stauchung klein ist, wird diese lokal gefaltet. Damit ist eine Schrumpfung der Hüllenfläche in diesen Zonen erreicht. Da EAP-Aktoren bis über 200 % Dehnung im aktivierten Zustand erreichen, sollte eine lokale Schrumpfung von 50 % im deaktivierten Zustand erreichbar sein. Die geforderte Bewegung des Luftschiffkörpers durch lokale Dehnungen der Hülle kann somit mittels EAP-Beschichtung erzeugt werden.
Anwendungen
Ein dem Fischflossenschlag nachempfundener Antrieb für Luftschiffe ist sehr effizient, weil er aus aerodynamischer Sicht einen hohen Wirkungsgrad erzielt. Wird die doppelte Biegeschwingung mittels EAP realisiert, ist auch diese Umsetzung relativ effizient, denn die EAP-Aktoren setzen elektrische Energie mit einem hohen Wirkungsgrad bis zu 70 % direkt in mechanische Arbeit um (ein Verbrennungsmotor erreicht – bezogen auf den Antrieb – einen Wikungsgrad von 25 % bis 30 %). Denkbar ist, dass die elektrische Energie von flexiblen Solarzellen auf der Oberseite der Luftschiffhülle, die genügend Sonneneinstrahlung empfängt, erzeugt wird (z. B. Projekt Lotte der Universität Stuttgart[6]). Da mit diesem Antriebskonzept keine grossen Geschwindigkeitsdifferenzen erzeugt werden, ist es äusserst leise, was für den bevorzugten Einsatz zur Umweltbeobachtung günstig ist.[2] Ein grosses Potenzial besteht für EAP-angetriebene Luftschiffe mit Ersatz für teure Satelliten oder laute Helikopter im Telekommunikationsbereich, insbesondere als Kommunikationsplattform, gewissermassen als schwebende Antennen, für die Mobiltelefonie oder als Träger für Fernsehausrüstung bei Veranstaltungen.TEC21, Mo., 2007.05.07
Anmerkungen
[1] Bock, J. B., Knauer, B.: Leichter als Luft – Transport- und
Trägersysteme – Ballone Luftschiffe Plattformen. Verlag Frankenschwelle KG, Hildburghausen, 2003.
[2] www.gefa-flug.de/gefa/news12082003.htm
[3] Hertel, H.: Struktur Form Bewegung. Krausskopf-Verlag, Mainz, 1963.
[4] Bar-Cohen, J. (Ed.): Electro-active Polymer (EAP) Actuators as Artificial Muscles. Reality, Potential and Challenges. SPIE Press, Bellingham, Washington, USA, 2001.
[5] Thomann, H. H., Merkli, P.: Strömungslehre I. AMIVVerlag,
Zürich, 1975.
[6] www.isd.uni-stuttgart.de/lotte/lotte/index.htm
07. Mai 2007 Aldo Rota