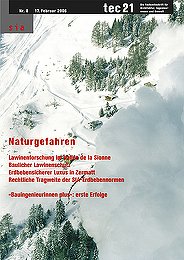Editorial
Erdbeben – ein vernachlässigtes Thema
Das Basler Beben vom 18. Oktober 1356 jährt sich heuer zum 650. Mal. Es handelte sich um eines der stärksten Beben in historischer Zeit nördlich der Alpen – mit je nach Quelle 100 bis 2000 Todesopfern. Was wäre, wenn sich dieses verheerende Beben wiederholen würde? Als Schaden werden verschieden hohe Milliardenbeträge genannt. Auch wenn nicht alle Details verstanden und oft auch nicht ganz einfach zu kommunizieren sind, so ist doch die Möglichkeit, dass sich ein solches Beben wiederholt, sehr ernst zu nehmen.
Es besteht Handlungsbedarf.
Dazu werden vier Überlegungen angestellt.
– Gesundes Bewusstsein schaffen: Wir müssen mit dem Dilemma leben, dass nur wenige grössere Erdbeben verspürt werden, aber die Wissenschafter immer wieder darauf hinweisen, dass eine Erdbebengefährdung besteht. Wie lässt sich der Bevölkerung und den politischen Instanzen ein realistisches Bewusstsein und ein massnahmenorientierter Umgang mit der Erdbebengefährdung vermitteln?
Zu denken ist weniger an den Katastrophenfall als vielmehr an die Durchsetzung von Vorsorgemassnahmen in Bezug auf erdbebensicheres Bauen. Die Frage nach erdbebensicherem Bauen ist nicht Praxis: Haben Sie beim Bau Ihres Hauses den Architekten gefragt, ob es erdbebensicher ist? Haben Sie zu diesem Thema eine kompetente Antwort erhalten?
– Verstehen: Erdbebenforschung ist eine anspruchsvolle wissenschaftliche Disziplin, die das Wissen von Geologen, Geophysikern, Bauingenieuren und Historikern zusammenbringt. Was bedeutet es, wenn Wissenschafter sagen, dass einzelne Regionen in der Schweiz gefährdeter sind als andere? Wie sind die Aussagen in Bezug auf die Stärke oder die Lokalisierung des Bebens von Basel zu verstehen? Was bedeutet es, wenn die Wissenschafter von Eintretenswahrscheinlichkeit, von Beschleunigung oder von Mikrozonierung reden?
Forschung und Lehre an den Hochschulen sind daher sehr wichtig, gerade auch am Standort Basel. Die Kenntnisse der lokalen Geologie und das regional begründete Interesse an der Forschung sind in der Ausbildung junger Wissenschafter und Ingenieure von grosser Bedeutung, um die Diskussion zu versachlichen und komplexe Zusammenhänge richtig anzuwenden und zu kommunizieren.
– Umsetzen im Alltag: Mit der Inkraftsetzung der neuen Erdbebenbestimmungen in den SIA-Tragwerksnormen (260–267) und mit dem SIA-Merkblatt 2018 «Überprüfung bestehender Gebäude bezüglich Erdbeben» wurde ein grosser Meilenstein erreicht. Jetzt gilt es, diese Normen konsequent in die Ausbildung der Architekten und Bauingenieure einzubringen und ihre Einhaltung in den Baubewilligungsverfahren mit Nachdruck einzufordern. Auch die staatlichen Stellen müssen sich ein fundiertes Wissen aneignen, um kompetent zu beurteilen und zu beraten.
– Vorsorge für den Katastrophenfall: Selbstverständlich müssen alle realistischen Massnahmen für die Bewältigung einer möglichen Katastrophe getroffen werden. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage des Versicherungsschutzes zu klären!
Es besteht Handlungsbedarf: Erdbeben müssen zu einem wichtigen Thema werden.
Thomas Noack, thomas.noack@bl.ch
Dr., dipl. Geologe, Amt für Raumplanung Basel-Landschaft
Inhalt
Standpunkt / Inhalt
Lawinenforschung im Vallée de la Sionne (VS) | François Dufour et al.
Mit den Resultaten grossmassstäblicher Experimente lassen sich
Berechnungsmodelle überprüfen und die zugrunde liegenden physikalischen Prozesse besser verstehen.
Baulicher Lawinenschutz | Stefan Margreth, Katharina Platzer
Neue SIA-Tragwerksnormen und Forschungsergebnisse verlangen eine Überarbeitung von massgeblichen Richtlinien zur Konstruktion von Schutzbauten.
Rechtliche Tragweite der SIA-Erdbebennormen | Rainer Schumacher
Die rechtliche Verbindlichkeit der neuen Tragwerksnormen SIA 260267 (Ausgabe 2003) ist von grundlegender Bedeutung für die Erdbebenvorsorge in der Schweiz.
Erdbebensicherer Luxus in Zermatt | Urs Sommer, Aldo Rota
Aus der Überprüfung der Erdbebensicherheit eines bestehenden Hotelbaus anhand des SIA-Merkblatts 2018 werden Sicherheits- und Rettungskosten abgeleitet.
«Bauingenieurinnen plus»: erste Erfolge | Beatrice Cipriano
Das Pilotprojekt der Hochschule für Technik Rapperswil (HSR) vermag junge Frauen für ein Bauingenieurstudium zu begeistern.
Nicht mehr exotisch: Frau auf dem Bau | Katharina Möschinger
Zwei Bauingenieurinnen berichten über ihre Erfahrungen.
Blickpunkt Wettbewerb
Neue Ausschreibungen und Preise / Zürichs grösstes Projekt: Erweiterung des Stadtspitals Triemli / Seltener Wettbewerb für eine Planung: Rössler-Bodenacker in Dulliken
Blickpunkt Wettbewerb
Neue Ausschreibungen und Preise / Zürichs grösstes Projekt: Erweiterung des Stadtspitals Triemli / Seltener Wettbewerb für eine Planung: Rössler-Bodenacker in Dulliken
Magazin
Ausstellung: Jo Colombo / Uni Luzern: Abbruch war rechtens /
Militärbibliothek unter einem Dach / Agglomerationsprogramm «Regio Frauenfeld» / Neue BZO für Luzern / Schatzalp-Turm: Einsprachen abgewiesen / Bau privater Schutzräume /
Aus dem SIA
Studienreise A&K zum Nadelör Öresund / Neuer Nationaler Anhang NB zur Betonnorm SN EN 206-1
Produkte
Impressum
Veranstaltungen
Erdbebensicherer Luxus in Zermatt
Zur Anwendung der neuen SIA-Erdbebenschutznormen für die Überprüfung bestehender Gebäude liegen noch wenig Erfahrungen vor. Ein aktuelles Beispiel ist ein Hotelkomplex im Wallis, dessen Erdbebensicherheit im vergangenen Jahr, vor einem Umbau, überprüft werden musste. Dabei zeigte sich, dass eine normengerechte Sicherheit nicht überall mit verhältnismässigen Kosten zu realisieren war, sodass man sich teilweise auf die Erfüllung der Anforderungen bezüglich Windsicherheit beschränken musste.
Im Schatten des Matterhorns, auf 1650mü.M. am Fuss des Wisshorns, überblickt der markante Gebäudekomplex des jetzigen Hotels «The Omnia» vom steilen westlichen Talhang aus das Ortszentrum von Zermatt (Bild 1). Die Lage in den Walliser Alpen und die grosszügige Gestaltung des Hauses bieten ein erhebendes Panorama, sind aus bautechnischer Sicht aber auch problematische Aspekte. Zermatt liegt nämlich gemäss der neuen Gefährdungskarte des Bundesamtes für Wasser und Geologie (BWG) am Rand des Gebiets mit der höchsten Erdbebengefährdung in der Schweiz, das sich über den Grossteil der Fläche des Kantons Wallis (und den Kanton Basel-Stadt) erstreckt, und ist in die Erdbebenzone Z3b gemäss den Normen SIA 260/261 eingeteilt. Schadenbeben, also Erdbeben, die Bauwerke zumindest ernsthaft beschädigen können, sind in dieser Zone statistisch eine reale Gefährdung, weshalb aufgrund der 2004 aktualisierten gesetzlichen Grundlagen im Kanton Wallis insbesondere grössere Gebäude eine erhöhte Sicherheit gegen Erdbeben aufweisen müssen. Bedingt durch seine Entstehungsgeschichte, weist das Hotelgebäude jedoch ungünstige bauliche Voraussetzungen für das Erreichen eines maximalen Sicherheitsstandards auf, sodass die für die Erdbebenertüchtigung ausgeführten Massnahmen sich weniger an den wünschbaren als an den realistischerweise noch möglichen Zielwerten orientieren mussten.
Ein Designhotel wird gebaut
Die ältesten Teile des heutigen Hotels «The Omnia» gehen auf das Jahr 1968 zurück, als an bester Aussichtslage oberhalb von Zermatt das Hotel «Rothorn» in Stahlbeton und Mauerwerk erstellt wurde. Während fast dreier Jahrzehnte wurde es als klassisches Hotel betrieben, bis 1996 der Investor Alexander Schärer und der Künstler Heinz Julen die Umnutzung in ein exklusives Designhotel projektierten. 1997 begann man mit der Umwandlung in ein Luxushotel mit etwa 40 Gästezimmern und sprengte einen Zugangsstollen und einen Liftschacht in den Fels, um einen bequemen Zugang vom Ortszentrum aus zu ermöglichen. Das bestehende Hotelgebäude wurde umfassend umgebaut, ein zusätzliches Untergeschoss, das heutige Erdgeschoss des Gesamtkomplexes, in den Fels gesprengt, und die alten Bruchsteinmauern wurden unterfangen. Nach der vollständigen Entfernung der Innenwände und der Ost- und der Westfassade im 1. und 2. OG sowie der dazwischengelegenen Decke trägt jetzt eine dreigeschossige Abfangkonstruktion aus Stahl im Gebäudeinneren die vertikalen Lasten. Eine Vorstellung der räumlichen Gliederung und der für das Verhalten bei erdbebenrelevanten strukturellen Eigenschaften vermitteln die 3D-Darstellungen für die rechnerische Überprüfung der Erdbebensicherheit in den Bildern 5 bis 7.
Südöstlich und nördlich der als Altbau bezeichneten Rumpfstrukur des ehemaligen Hotels «Rothorn» wurden in geringem Abstand die neuen Süd- und Nordtrakte in Stahlbeton (Decken und einzelne Wände) und Mauerwerk (Wände) erstellt (Bild 2). Ein Korridor gliedert den Nordtrakt in einen westlichen und einen östlichen Baukörper, die pro Geschossdecke mit einer durchlaufenden Betonplatte und einer Aussteifung aus Stahlprofilen verbunden sind. Der Südtrakt steht über der zweigeschossigen Hotelhalle auf Stützen und ist pro Geschoss an zwei Punkten durch Aussteifungen aus Stahlprofilen mit dem Nordtrakt verbunden. Zum Altbau besteht hingegen keine tragende Verbindung.
Dazu kam noch ein westlicher, in den steil ansteigenden Hang hineingebauter Anbau an das rechteckige Hotelgebäude, der den Komplex gegen das felsige Nachbargrundstück abgrenzt. Im Endausbau resultiert ein der Hangneigung treppenförmig angepasster, bis 6-geschossiger Baukörper mit Giebeldach und dem Grundriss eines gedrungenen rechten Winkels, der unter einer einheitlichen Gebäudehülle die drei Strukturen Altbau mit neuem westlichem Anbau, Südtrakt und Nordtrakt umfasst (Bilder 3 und 4).
Der zentrale, im Grundriss quadratische Haupttreppenbereich im Berührungspunkt der drei Strukturen und die jeweils ca. 2 m breiten Zwischenräume zwischen Altbau und Südtrakt bzw. zwischen Süd- und Nordtrakt sowie der zentrale Korridor im Nordtrakt selbst dienen als interne Verkehrswege. Sie sind mit unabhängigen, «hineingestellten» Stahl- und Glaskonstruktionen für die Korridorböden erschlossen, die keine stabilisierende und verbindende Wirkung zwischen den einzelnen Baukörpern aufweisen. Im Hinblick auf die Gesamtstabilität trennen sie den Gebäudekomplex in drei unabhängig voneinander wirkende Bauteile auf.
Neubeginn von Amtes wegen
Der aktuelle Zustand des Bauwerks ist das Ergebnis einer wechselvollen Vorgeschichte, die seit der abgebrochenen Betriebsaufnahme des Komplexes im Jahr 2000 verschiedene bauliche Interventionen umfasste (siehe Kasten). Im Zusammenhang mit den jüngeren, seit Juni 2004 ausgeführten Ausbau- bzw. Umnutzungsprojekten verlangt der Kanton Wallis, gestützt auf das neue kantonale Baugesetz, nun rückwirkend die Überprüfung der Erdbebensicherheit des gesamten Gebäudes unter Anwendung des SIA-Merkblattes 2018 «Überprüfung bestehender Gebäude in Bezug auf Erdbeben». Diese Überprüfung der zwischen 1968 und 1999 erstellten und von 2000 bis 2003 sanierten Baukörper erfolgte während des vergangenen Jahres und hat interessante Erkenntnisse zur Beurteilung der Erdbebensicherheit der Gebäude hervorgebracht.
Sicherheit nach Norm
Fortschrittliche Erdbebenbestimmungen für Neubauten finden sich im Normenwerk des SIA erst ab 1989 (Norm SIA 160, Ausgabe 1989). Seit 2003 sind Tragwerksnormen in Kraft (SIA 260 bis 267), welche Erdbebenbestimmungen enthalten, die den Ansprüchen der Eurocodes gerecht werden. Mit dieser Normengeneration haben sich die Anforderungen an Gebäude nochmals erhöht. Bei Bauwerken, die vor 1989 erstellt worden sind, erfolgte die Projektierung, ohne dass der Gefährdung durch Erdbeben gebührend Rechnung getragen wurde. Die Erdbebensicherheit dieser Gebäude ist daher unbekannt.
Seit Bestehen der Norm SIA 160, Ausgabe 1989, wurde die Beurteilung der Erdbebensicherheit bestehender Gebäude kontrovers gehandhabt. Die Ansichten reichten von der Beurteilung anhand der Massstäbe für Neubauten bis hin zum Ignorieren der Erdbebengefahr. Mit dem SIA-Merkblatt 2018, Ausgabe 2004, stehen erstmals einheitliche Regeln zur Verfügung.
Im Rahmen der auf die Betriebsschliessung im Jahr 2000 folgenden Bauwerksanierung wurde die Tragkonstruktion des Hotels anhand der Norm SIA 160, Ausgabe 1989, mit Aufnahmen und Sondierungen am Bau sowie Nachrechnung kritischer Bauteile überprüft. Die Erdbebeneinwirkung wurde dabei mit dem Ersatzkraftverfahren als aussergewöhnliche Einwirkung berücksichtigt.
Daraus sind die weiter oben erwähnten Instandsetzungsmassnahmen, insbesondere bezüglich Stabilität, abgeleitet und bis März 2003 ausgeführt worden, auf die in diesem Zusammenhang nicht weiter eingegangen wird. Bezüglich der Erdbebensicherheit ergaben sich die folgenden Befunde:
Die (neu erstellten) Nord- und Südtrakte erfüllen die Anforderungen an die Erdbebensicherheit der Tragwerksnormen SIA 160 bis 162 (Ausgabe 1989). Der Altbau (Hotel «Rothorn») war hingegen bereits vor dem Umbau/Anbau 1998/99 nicht erdbebensicher. Durch den Umbau von Heinz Julen 1999 wurde die Gesamtstabilität noch herabgesetzt, sodass auch die tiefere Anforderung der Stabilität gegen Windeinwirkungen nicht mehr erfüllt wurde. Mit den 2002 realisierten baulichen Massnahmen, insbesondere der Verstärkung der Nord- und Südfassade mit geklebten Lamellenbewehrungen (Bilder 8 und 9) sowie dem Einbau zusätzlicher Scheiben aus Beton und Fachwerk aus Stahl, konnte dieser Gebäudeteil soweit verstärkt werden, dass er die Anforderungen der Tragwerksnormen SIA 160 bis 162 (Ausgabe 1989) bezüglich Windsicherheit erfüllt. Auch bezüglich Erdbebensicherheit erfüllen jetzt das ertüchtigte Erdgeschoss sowie grösstenteils auch das 1. Obergeschoss die Anforderungen der Tragwerksnormen SIA 160 bis 162 (Ausgabe 1989). Für Teile des 2. Obergeschosses und die darüber liegenden Geschosse des Altbaus wurde hingegen lediglich das Sicherheitsniveau, das vor dem Umbau/Anbau vorhanden war, wieder erreicht oder leicht erhöht.
Risiko-orientierte Beurteilung
Die 2004 durchgeführte Beurteilung der Erdbebensicherheit gemäss SIA-Merkblatt 2018 erfolgte risikobasiert. Das zentrale Element der rechnerischen Beurteilung ist der Erfüllungsfaktor aeff. Er ergibt sich als Quotient aus den normengemässen Auswirkungen und dem normengemässen Widerstand und liegt für die Tragsicherheit bei einer Wand im Nord-/Südtrakt und bei sechs Wänden im Altbau bei aeff<0.25. Für weitere sieben Wände resultieren mit den Reduktionsfaktoren aus Tabelle 2 des SIA-Merkblattes 2018 von amin=0.25 und aadm=0.76 Erfüllungsfaktoren von amin
Die Personenrisiken sind der zentrale Aspekt bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit. Zunächst ist sicherzustellen, dass das Individualrisiko akzeptierbar ist. Dies ist der Fall, wenn die Todesfallwahrscheinlichkeit für einen einzelnen Menschen in einem bestimmten Gebäude kleiner als 10–5 pro Jahr ist, was bei einem aeff>0.25 gegeben ist.
Die quantitative Beurteilung der Verhältnismässigkeit erfolgt mit Hilfe der Rettungskosten RKM, die als Quotient aus den auf ein Jahr bezogenen Sicherheitskosten einer bestimmten Massnahme SKM und der auf ein Jahr bezogenen Reduktion des Personenrisikos DRM definiert sind. Die Rettungskosten werden folglich realistisch, wenn auch etwas zynisch, angegeben in Franken pro gerettetes bzw. erhaltenes Menschenleben.
Was Sicherheit kostet
Die Erdbebensicherheit gemäss den neuen Tragwerksnormen SIA 260 bis 267 kann für alle untersuchten Baukörper nur mit aufwändigen baulichen Massnahmen wie Einbau vertikaler Zuganker im untersten Geschoss, Verstärken vertikaler Zugelemente mittels Klebbewehrung über die gesamte Gebäudehöhe und Errichtung zusätzlicher Beton- oder Stahlscheiben zur Horizontalkraftabtragung erreicht werden. Die sicherheitsbezogenen Investitionskosten SKIM für die Verstärkung der sieben Wände in den Obergeschossen mit ungenügender Tragsicherheit (aeff
Die Risikoreduktion errechnet sich aus der Differenz des kollektiven Personenrisikos zwischen Ausgangszustand und gedachter Umsetzung von Erdbebensicherungsmassnahmen. Für eine mittlere Belegung von 20 Personen/Jahr (8 Altbau/12 Nord- und Südtrakt) ergibt sich eine Rettungseffizienz der zusätzlichen Erdbebensicherungsmassnahmen von über 10 Mio. Fr. pro gerettetes Menschenleben für alle Gebäudeteile.
Als verhältnismässig gelten Erdbebensicherungsmassnahmen, die zu Rettungskosten unter 10 Mio. Fr. pro gerettetes Menschenleben führen. Massnahmen, die Rettungskosten unter 100 Mio. Fr. pro gerettetes Menschenleben verursachen, werden noch als zumutbar betrachtet. Für das aktuelle Objekt «The Omnia» sind zusätzliche Massnahmen zur Erreichung der normgemässen Erdbebensicherheit somit aufgrund ihrer Rettungseffizienz nicht verhältnismässig.TEC21, Fr., 2006.02.17
Zusatz:
Bewegte Entstehungsgeschichte
Im Februar 2000 wurde das neu konzipierte Hotel als «Into the Hotel» eröffnet. Nach sechs Wochen musste der Betrieb wegen zutage getretener gravierender statischer, konstruktiver und bauphysikalischer Mängel im April 2000 geschlossen werden. In der Folge wurde von Mai 2000 bis März 2003 unter der Leitung des Architekten Walter Schweizer eine Bestandesaufnahme vorgenommen, die unter anderem eine ungenügende Gesamtstabilität des Altbaus ergab, und die Baumängel wurden schrittweise saniert. Als wichtigste bauliche Massnahmen erforderte dies den Einbau aussteifender Betonscheiben und Stahlfachwerke in den drei untersten Geschossen des Altbaus, die Neuerstellung des Daches und die Neukonzeption der Fassaden. Die neuen, hinterlüfteten Fassaden sind, in Anlehnung an traditionelle lokale Bauformen, als horizontale Lärchenholzschalung über einem Granitsockel ausgeführt (Bild 1). Der Baukörper fügt sich damit besser in die Umgebung ein als mit den ersten, in Glas und Stahl ausgeführten Fassaden.
Gleichzeitig mit den unabdingbaren Sanierungsmassnahmen an der Bausubstanz wurde ein neues Nutzungskonzept als Suitenhotel mit 28 Gästezimmern, Suiten und Wellnessbereich realisiert. Im März 2003 wurden die Umbauarbeiten unterbrochen, bis zwischen Juni und Dezember 2004 eine erneute Neukonzeption des Innenausbaus als Designhotel «The Matter» mit «Bed and Breakfast»-Angebot durch die Basler Innenarchitekten J.+S. Lassoudry erfolgte. Auch dieses Betriebskonzept wurde anschliessend nicht in die Praxis umgesetzt. Seit Januar 2005 ist unter der Leitung des New Yorker Innenarchitekten Ali Tayar ein weiterer Umbau des Innenausbaus im Gange. Nach der voraussichtlichen Fertigstellung im kommenden März soll wieder ein Designhotel der gehobenen Kategorie, diesmal unter dem Namen «The Omnia», eine internationale, exklusive Klientel nach Zermatt locken.
17. Februar 2006 Aldo Rota, Urs Sommer