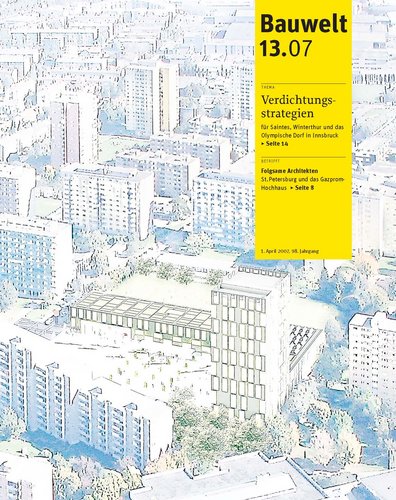Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Haus am Dom in Frankfurt am Main | Ursula Kleefisch-Jobst
03 Lessons from Rudofsky in Wien | Friederike Meyer
03 Was ist los beim Marinski-II-Theater in St. Petersburg? Cordula Rau
04 Geschichtspark „Ehemaliges Zellengefängnis Moabit“ | Anne Kockelkorn
05 MIPIM 2007 in Cannes | Christian Brensing
06 Max-Frisch-Ausstellung in München | Jochen Paul
BETRIFFT
08 Folgsame Architekten | Bart Goldhoorn
WETTBEWERBE
10 Goethe-Institut und DAAD in Kairo | Friederike Meyer
12 Entscheidungen
13 Auslobungen
THEMA
14 Provokante Ähnlichkeit | Bernd Vlay
20 Alt, neu, altneu | Axel Simon
26 Organisches Fortschreiben | Delphine Costedoat
REZENSIONEN
33 Planet der Slums
RUBRIKEN
06 wer wo was wann
32 Kalender
34 Anzeigen