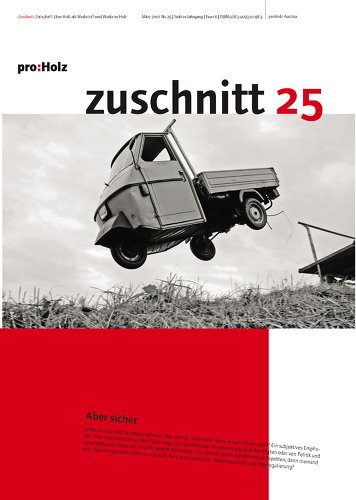Editorial
Zum Thema
Im Einleitungstext zu diesem Heft schreibt Helmut Stingl: »Dass Sicherheit nicht absolut denkbar ist, weil es zu jeder noch so guten Sicherheit eine noch bessere geben kann, ist jedem (...) klar.« Eine Aussage, die noch erweiterbar wäre durch die Feststellung, dass absolute Sicherheit wohl auch nicht wünschenswert wäre, weil Unsicherheit und Risiko unverzichtbare Größen sind, die ebenso ihren Anteil an der Vielfalt des Lebens haben, wie der Wunsch nach einer Existenz ohne Gefahr und damit ohne Angst. Größtmögliche technische und konstruktive Sicherheit im Rahmen wirtschaftlicher Voraussetzungen zu gewährleisten und zugleich ansprechende, vielschichtige und anregende Architektur zu schaffen, sind Aspekte im Bauwesen, die abzudecken eine immense Herausforderung ist. Ein Bündel an Parametern und Interessen nimmt Einfluss auf den Bauprozess – von der Planung über die Ausführung bis zur Nutzung – und nicht immer gelingt es, alle diese Anforderungen befriedigend umzusetzen.
Mit dem vorliegenden Zuschnitt wollen wir die große Breite des Begriffs Sicherheit darstellen. Vom spielerischen Umgang mit Emotionen über Sicherheitsaspekte, die ebenso unbekannt wie naheliegend sind, bis hin zur Analyse des Halleneinsturzes in Bad Reichenhall im vergangenen Winter. Und alle diese Inhalte haben die Einsicht gemeinsam, dass verantwortliches Handeln beim Bauen im Vordergrund stehen muss. Eva Guttmann
Inhalt
Zum Thema
Editorial | Eva Guttmann
Gastkommentar | Erich Wiesner
Zur Sicherheit | Helmut Stingl
Themenschwerpunkt
Vertigo oder 640 m über Aurland | Eva Guttmann
Unter Strom – Holzbau für die neue Passerelle des Bahnhofs Bern | Christian Holl
Ein Abenteuer – Zweiter Traversinersteg in Sils/Zillis | Roland Brunner
Nutzungsvereinbarung – Protokoll eines Dialogs | Konrad Merz
Hand in Hand – Eis- und Minigolfhalle in Salzburg-Bergheim | Norbert Mayr
Der Einsturz der Eissporthalle in Bad Reichenhall und was man daraus lernen muss! | Stefan Winter
Zur Situation in Österreich | Gespräch mit Bernhard Egert, Andreas Neumüller, Karl Schafferer, Reinhold Steinmaurer und Helmut Stingl
Mehr Hausverstand | Arno Ritter
Statements von Hansjörg Mölk, Wolfgang Pöschl, Alfred Brunnsteiner, Armin Kathan und Hans Efferl
Schaufeln hilft | Gespräch mit Alfred Brunnsteiner
Unter Strom
(SUBTITLE) Holzbau für die neue Passerelle des Bahnhofs Bern
Mit dem neuen Taktfahrplan, der im Dezember 2004 im Rahmen des Projekts »Bahn 2000« in der Schweiz eingeführt wurde, musste mit einer Verdoppelung der Fahrgäste für den Bahnhof Bern gerechnet werden. Längere Züge im rascheren Wechsel erforderten die Verlängerung der Bahnsteige, weshalb auch der zweite Zugang zu den Gleisen westlich des Hauptbahnhofs, dort, wo die Gleise unter der Bebauung und der Schanzenbrücke ans Tageslicht kommen, nicht mehr das bleiben konnte, was er bislang war: ein schmaler, unattraktiver Notzugang, ungemütlich beleuchtet, mit dem Charme einer Unterführung. Mit der neuen Passerelle gelang es den Architekten, ihn zu einem großzügigen, hellen, übersichtlichen und eleganten Raum zu nobilitieren.
Die Welle
Den vor dem Bahnhof abgebremsten Verkehrsfluss in einer sich aufwölbenden Welle symbolisierend, verbindet nun ein Dach aus geschwungenen Holzträgern mit Aluminiumeindeckung die verlängerten Bahnsteige mit einer neuen, quergelagerten Brücke, von der aus die Bahnsteige erschlossen werden. Insgesamt wurden sechs Bahnsteige unterschiedlicher Länge und variierender Breite überdacht, jeweils gegliedert in einen Bereich der Welle, also des tatsächlich geschwungenen Trägers über der Passerelle, und einen flachen Abschnitt auf dem Bahnsteig. Die Konstruktion der Dächer und deren Abstützungen sind weitgehend durch die Geometrie der Gleisanlage bestimmt. Jeder Bahnsteig hat eine andere Form, außerdem sind die verschiedenen Höhen auf der Schanzenbrücke dafür verantwortlich, dass auch im Schnitt kein Dach dem anderen gleicht. Um die Klarheit der Form beizubehalten, vollständigen Witterungsschutz zu gewährleisten und gleichzeitig den durch die Holzuntersicht atmosphärisch angenehmen Raum offen und übersichtlich zu gestalten, wurden die Zwischenräume auf der Brücke mit Glas überdacht.
Montage unter Spannung
Aufgrund der zur Verfügung stehenden Bauzeit von lediglich neun Monaten wurde während des laufenden Bahnbetriebs umgebaut. Die meisten Bauteile wurden vorgefertigt und in kurzer Zeit, oft während der Nacht und teilweise zwischen fahrenden Zügen und stromführenden Leitungen, montiert. Unter diesen Umständen musste das Risiko für einen Unfall durch Stromschlag aus Sicherheitsgründen minimiert werden, weshalb man sich für eine Konstruktion aus Holz entschied.zuschnitt, So., 2007.03.25
25. März 2007 Christian Holl
verknüpfte Bauwerke
Passerelle West Bahnhof Bern
Ein Abenteuer
(SUBTITLE) Zweiter Traversinersteg in Sils/Zillis
Der 1996 erbaute Traversinersteg in der Viamala fiel im März 1999 einem Felssturz zum Opfer. Der Zweite Traversinersteg überquert die Schlucht etwa siebzig Meter weiter rheinwärts an einem geschützteren Ort. Die Spannweite ist im Vergleich zur alten Brücke beträchtlich größer. Um die Baukosten dennoch in einem vertretbaren Rahmen zu halten, ist die Brücke als vorgespanntes Seilfachwerk mit natürlichen Pylonen und einem schrägen Gehweg angelegt, einer hängenden Treppe mit einer horizontalen Spannweite von 56 m und einer Höhendifferenz von 22 m.
Durch die Neueröffnung des Stegs wurde das die Region durchziehende Wanderwegenetz wieder geschlossen. Das Wohlbefinden der Wandersleute, ihr subjektives Sicherheitsgefühl bezüglich Tiefblick und Schwingungen auf der 70 m über dem Bachbett hängenden Treppe war eine entscheidende Planungsaufgabe. Außenliegende Träger verhindern den vertikalen Blick ins Tobel und liegend angeordnete Geländerbretter unterstützen den Sichtschutz. Die Föhrenholztritte des nach unten mit einem Radius von 150 m gebogenen Gehwegs gewährleisten durch ihre sägerauen Oberflächen Rutschfestigkeit. Ein Rautenfachwerk mit doppeltem Strebenzug, die hohe Steifigkeit der Brettschichtholzträger aus Lärchenholz und die Vorspannung der Hauptseile begrenzen das Schwingen und Schaukeln des Gehwegs auf ein vertretbares Maß. Die Begehung im Winter ist jedoch unmöglich, da die Zugangswege nicht passierbar und deswegen gesperrt sind.
Die Tragkonstruktion des Stegs besteht aus einem vorgespannten Seilfachwerk, das in zwei vertikalen Ebenen angeordnet ist. Seine Form führt unter maximaler (Schnee)Belastung zu einer konstanten Kraft in den Hauptseilen. Die Diagonalen des Fachwerks, der Windverband, die Geländerpfosten und die zehn parallel geführten Lärchenbrettschichtholzträger sind an Stahlquerträgern angeschlossen. Ein im Trittprofil ausgeschnittenes Lärchenbrettschichtholz ist auf den mittleren zwei Trägern aufgeschraubt. Darauf sind die Tritte aus Föhrenkernholz befestigt. Die sägerauen Geländer (ebenfalls Föhre), sind zwischen Stützen aus Flachblech eingesetzt und werden durch zwei Stahlstäbe in die Kreisbahn gezwungen. Ein konsequent umgesetzter konstruktiver Holzschutz, die Feuerverzinkung der Stahloberflächen sowie der Einsatz witterungsbeständiger Hölzer wie Lärche und Föhre gewährleisten die hohe Lebensdauer des 2005 eröffneten Stegs, aber trotzdem: ganz ohne flaues Gefühl in der Magengegend vertraut sich wohl niemand dem visuell so fragilen Bauwerk an und die Querung der Viamala-Schlucht ist und bleibt ein Abenteuer.zuschnitt, So., 2007.03.25
25. März 2007 Roland Brunner
verknüpfte Bauwerke
Neuer Traversina-Steg
Hand in Hand
Vor wenigen Jahren entstand am Rande Bergheims – einer Speckgürtel-Gemeinde nördlich der Stadt Salzburg – das gestalterisch dürftige Freibad »Bergxi«. Direkt am Ufer der Fischach diente eine rund 20 mal 40 Meter große Asphaltfläche in warmen Jahreszeiten als Minigolfanlage. Die zusätzliche Verwendung als Eislaufplatz im Winter war ohne Sonnen- und Witterungsschutz nur eingeschränkt und betriebskostenintensiv möglich.
Die sinnvolle Überdachung der Eisfläche realisierte 2005 das Grazer Architektenbüro mfgarchitekten nach mehrmonatiger Planung in drei Monaten Bauzeit. Die beiden Architekten Friedrich Moßhammer und Michael Grobbauer entwickelten gemeinsam mit Tragwerksplaner Johann Riebenbauer eine einfache Holzkonstruktion mit teilweise ausgekreuzten Pendelstützenfeldern, Leimholzdachträgern und einer aussteifenden Dachplatte aus Brettsperrholz.
Die Eislaufplatz-Nutzung war entscheidend für die Wahl des wärmeträgen Materials Holz. Die Kondensatbildung wird durch die natürliche Durchlüftung der Konstruktionsteile bzw. des offenen Hallenraums verringert. Besonnung und abends Kunstlicht im Dachraum tragen dazu bei, dass die offene Holzkonstruktion möglichst trocken und schimmelfrei bleibt. Die sägeraue Behandlung der Deckenelemente aus Fichtenholz erhöht deren Sorptionsfähigkeit.
Die tatsächliche Höhe des Dachtragwerks bei der Querspannweite von 20 Metern ist hinter der rund eineinhalb Meter auskragenden Dachplatte kaum wahrnehmbar. Ein Holzlattenrost lässt ihre Untersicht homogen erscheinen. Die schwebende Wirkung des Daches fördern die statisch freigespielten Ecken und die Reduktion der Stützen auf 24 mal 24 Zentimeter. Diese Holz-Pendelstützen treten als tragende Elemente in den Hintergrund und wirken in die Wandstruktur integriert. Die drei der vier Außenwände mit Sonnenschutz-Elementen präsentieren sich im Duktus offener und geschlossener Flächen, wenn alle raumhohen Schieberahmen – wie manuell leicht möglich – geöffnet sind. Von innen erscheint die mit blaugrauem Polyestergewebe bespannte Hülle durchlässig, manchmal annähernd transparent, zum changierenden Raumeindruck trägt das zentrale Oberlichtfeld bei. Blendungen werden durch den Holzlattenrost als Deckenuntersicht vermieden. Die künstliche Belichtung erfolgt durch Strahler indirekt im Dachraum und direkt auf die Nutzfläche. Die reflektierenden Holzflächen tragen zur warmen Lichttemperatur bei.
Erhöhte Sicherheit durch Eliminierung potenzieller Fehlerquellen
Wenige Monate nach der Eröffnung – am 2. Jänner 2006 – ereignete sich in der Eislaufhalle in Bad Reichenhall im benachbarten Bayern eine Tragödie. Beim Einsturz des Hallendachs starben 15 Menschen. Das Unglück setzte eine Diskussion hinsichtlich der Gewährleistung der Sicherheit von Hochbauten in Gang, die Bevölkerung war sensibilisiert. Die Schneefälle mit entsprechenden Lasten auf den Dächern führten Anfang Februar 2006 auch zu besorgten Anrufen in der Gemeinde Bergheim. Die Dachränder der Halle wurden abgeschaufelt – »nicht wegen Einsturzgefahr«, wie der Amtsleiter der Gemeinde Anton Zitz betont, »sondern vorbeugend«.
Nachdem beobachtet worden war, dass sich die 20 Meter überspannenden Träger um ca. 5 cm durchbogen, kontaktierte man Johann Riebenbauer:
»Die veränderlichen Lasten wurden nach den damals gültigen ÖNORMEN berechnet und mit insgesamt ca. 1,6kN/m² angesetzt. Damals war in den veränderlichen Lasten noch eine »Instandsetzungslast« enthalten, unter der sich das Tragwerk ca. 5 cm verformen darf. Die geltenden neuen ÖNORMEN ergeben eine Schneelast von ca. 1,8kN/m², eine Nutzlast für Instandsetzungsarbeiten ist nun mit der Schneelast nicht mehr zu überlagern. Das bedeutet gegenüber der Volllast eine nur ca. 9-prozentige Erhöhung.« Diese Überschreitung der zulässigen Lasten ist laut Riebenbauer für diese Tragstruktur bezogen auf das im Holzbau laut Norm vorhandene Sicherheitsniveau unbedeutend.
Generell gilt im Bauwesen ein Sicherheitsniveau von ca. 100 bis 150%, also mindestens das Doppelte der zulässigen Grenzwerte. Dieses Sicherheitsniveau deckt nicht genau bestimmbare Randbedingungen wie Unsicherheiten bei den Lastannahmen, Ausführungsungenauigkeiten, Materialfehler u.a.m. ab. Bei einer weitgehenden Reduktion dieser Fehlerquellen könnte im Extremfall fast die doppelte Schneemenge am Dach sein, ohne dass – so Riebenbauer – das Tragwerk einstürzen dürfte. Daher stellt ein nach den alten Lastnormen richtig bemessenes und auch richtig ausgeführtes Tragwerk bei nunmehr höheren Schneelasten (bis ca. 50% Überlast) kein Problem dar. Ein Tragwerk könnte sich nur etwas mehr als sonst üblich verformen und möglicherweise zu Rissen bei Gipskartonanschlüssen etc., nicht aber zum Einsturz des Tragsystems führen.
System, Herstellung und Montage
Übereinander gestapelte Bauelemente sind wesentlich fehlerresistenter als komplexe Tragstrukturen mit aufwändigen Knotenausbildungen und Anschlussdetails. Das Tragsystem der Halle in Bergheim verringert Fehlerquellen und Unsicherheiten: Die Dachplatte wurde auf die Träger gelegt, diese wiederum auf die Stützen aufgesetzt. Beim Aufeinanderlegen kann man bezüglich der Ausführung eigentlich keine Fehler machen. Bei richtiger Trägerdimensionierung ist – so Riebenbauer – das Bauwerk »mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch für höhere Schneelasten ausreichend sicher«.
Beim Hallendach in Bergheim würde z.B. das Versagen eines einzelnen Hauptträgers nicht zum Einsturz der Halle führen, da die darüber liegenden Brettsperrholz-Dachplatten als Durchlaufträger ausgebildet worden sind. Im Falle des Versagens eines Trägers oder einer Stütze würden sich die Dachlasten auf die Nachbarträger umverteilen. Der »gebrochene« Träger würde an den Dachplatten hängen bleiben und nur kleine Teile würden von der Decke fallen. Ein Gesamteinsturz der Halle ist damit sehr unwahrscheinlich. Somit erhöht auch die Wahl des Tragsystems die »Gesamtsicherheit«.
In manchen Ländern wie z.B. England ist bei mehrgeschossigen oder öffentlich genutzten Gebäuden beim Versagen von Einzelbauteilen eine Begrenzung des Einsturzbereichs vorgeschrieben. Auch in Bergheim wurde dieses Prinzip umgesetzt. Johann Riebenbauer verwendet es abhängig von der Wichtigkeit der Gebäude und den Realisierungsbedingungen: »Die Ausführungsqualität ist in Österreich leider sehr unterschiedlich. In Ausschreibungen oft geforderte Werk- und Montagepläne gibt es meist nicht oder werden aus Termin- und Kostengründen eingespart. Wie die Struktur aber vor Ort ausgeführt werden soll, ist den Monteuren dann nicht wirklich klar und sie arbeiten eher nach Gefühl bzw. wie sie es eben „schon immer gemacht“ haben. Hier kann mit der Wahl der Bauelemente und des Tragsystems gegengesteuert werden. Auch bei Statikerleistungen werden häufig nur grobe Vorbemessungen bezahlt, um Honorar zu sparen. Die Verantwortung wird hier oft an Firmen übertragen (versteckt in den Vorbemerkungen von Ausschreibungstexten), die sich der Problematik und Verantwortung gar nicht richtig bewusst sind. Die Zimmermeisterausbildung ist viel zu kurz, um hier alle baupraktisch vorkommenden Fälle abdecken zu können, und wie oft ist der Zimmermeister selbst auch schon vor Ort, um die Ausführung zu kontrollieren?« Die Leichtigkeit der Tragstruktur lässt Fehler während der Ausführung nicht zutage treten, die Personen- oder Schneelasten sind aber oft ein Vielfaches des Eigengewichts. So zeigen sich manche Ausführungsfehler auch erst nach Jahren und bei gegenüber den Normen geringeren Lasten.
»In Bergheim ging die Zusammenarbeit aller Beteiligten bis ins Detail Hand in Hand und man konnte sich mit dem Statiker auf gute Lösungen einigen, ohne das architektonische Konzept zu verlassen«, betonen die Architekten, und Riebenbauer ergänzt: »Bei einem ordentlichen Planungsablauf mit richtig verteilten Verantwortungen können gravierende Fehler mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vermieden werden.« Daher sollten bei großen Tragwerken von der ausführenden Firma nicht gleichzeitig die statischen Berechnungen durchgeführt werden, auch wenn dies für den Auftraggeber finanziell am günstigsten zu sein scheint, weil die nötige fachkundige Kontrollinstanz fehlt. Es ist sogar sinnvoll, bei komplexeren Tragstrukturen einen dritten Fachmann beizuziehen, denn es gilt einen Aspekt zu minimieren: »Absolut sicher ist im Bauwesen leider nichts!«zuschnitt, So., 2007.03.25
25. März 2007 Norbert Mayr
verknüpfte Bauwerke
Überdachung Eislaufplatz Bergheim