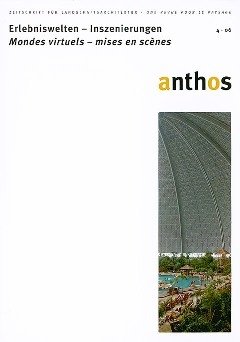Editorial
«Weitgehend ohne Protest und ohne dass die Öffentlichkeit auch nur Notiz davon genommen hätte, haben sich Politik, Religion, Nachrichten, Sport, Erziehungswesen und Wirtschaft in kongeniale Anhängsel des Showbusiness verwandelt», schreibt Neil Postman in seinem kulturkritischen Buch «Wir amüsieren uns zu Tode» schon in den späten Jahren des 20. Jahrhunderts. Das Leben ist «eine endlose Reihe von Unterhaltungsveranstaltungen, ein gigantischer Amüsierbetrieb». Die Suche nach Zerstreuung, Abwechslung, Sinneslust, Selbstverwirklichung und Individualität ist zum zeitgeistigen Imperativ geworden.
Und wie, so fragt man sich, bewegt sich die Landschaftsarchitektur, die ja seit jeher mit den Mitteln der Illusion und Inszenierung schafft, heute in diesem Mainstream?
Wenn in einem Vergnügungspark die Weltmeisterschaften im Hot-Dog-Essen veranstaltet werden, bei denen der Sieger (Takeru Kobayashi) vor 25 000 begeisterten Zuschauern in 12 Minuten 54 Hot-Dogs verschlingt (so am 4. Juli 2006 in Coney Island), ist das sicher nicht die Schuld der Landschaftsarchitektur. – Was aber trägt sie bei zum «Erlebnis-Setting»? 180 Millionen Europäer besuchen jährlich die Scheinwelten der Freizeit- und Erlebnisparks. Auch Einkaufszentren überbieten sich seit langem, der Lust am Kaufen etwas nachzuhelfen. So entsteht im Rontal zwischen Zug und Luzern mit «Ebisquare» ein «Urban Entertainment Center», wo man in «destillierten Landschaften» auch auf Berge klettern und in Grotten tauchen kann.
Neben diesen real künstlichen gibt es noch die virtuellen, von den Entwicklern der Computerspiele kreierten Landschaften, denn auch Spiele kommen ohne «Landschaft» selten aus. Werden hier vielleicht ganz neue Wahrnehmungen geschaffen und damit auch neue Realitäten? Unterhöhlen diese gar unsere Gestaltungsspielräume und beschleunigen die Entwicklung zu einer globalisierten Landschaft?
Auch Tourismusregionen kreieren zunehmend Angebote, die das Erlebnis der – echten – Landschaft steigern sollen. Was aber weckt beim Gast die Lust auf die reale Landschaft? Und wie lässt sich diese sinnvoll «inszenieren», ohne dass man den Respekt vor ihr verliert, sie gar zerstört?
Ein neuer – gesetzlich verankerter – Parktyp trägt das Erleben schon in seinem Namen, der «Naturerlebnispark». Die neue Biber- und Fischotteranlage im Sihltal, als Teil eines zukünftigen Naturerlebnisparks, gewährt den Besuchern überraschende Einblicke in das Leben dieser Tiere. Auch die Zoologischen Gärten gehen neue Wege, um das Erleben der Tiere in einer ihrem natürlichen Lebensraum möglichst angepassten und tiergerechten Umgebung zu gewährleisten, wie im gerade eröffneten Löwengehege des Zürcher Zoos.
Und es gibt sie schliesslich auch noch, die (inszenierten) «Inseln der Seeligen», die «verwunschenen Paradiese», wo sich Kunst zum Anfassen mit idyllischer Landschaft vereint, wie in Hombroich – und auch die kleinen innovativen Massnahmen mit grosser Wirkung, wie im historischen Park Mon Repos in Lausanne, die neue soziale und kulturelle Aktivitäten zur Folge haben und dem Park ein neues Leben schenken. Bernd Schubert
Inhalt
- Editorial
Hannes Krauss
- Freizeit- und Erlebnisparks
Sonja Gerdes, Dominik Siegrist
- Erlebnisangebote im naturnahen Tourismus
Franz Hohler
- Mons rigidus
Stefanie Krebs
- Wirklich künstlich! Landschaften im Computerspiel
Walter Vetsch
- Indien in Zürich – das neue Löwengehege
Balz Hofmann
- Botschafter des Flusses – die neue Biber- und Fischotteranlage
Axel Simon
- Hombroich – Insel der Seeligen
Claudia Moll
- Destillierte Landschaft in der Shopping-Mall
Karsten Feucht
- Wahrnehmung verändert Landschaft
Jürg Altherr, Jacqueline Parish
- Die Organisation der Leere – ein Workshop am San Gottardo
Klaus Holzhausen, Julien Burri
- Die Folie Voltaire – ein Teesalon im Grünen
Börries von Detten, Antje Havemann
- Inszenierung weiterdenken
- Gartenjahr 2006
- Schlaglichter
- Wettbewerbe und Preise
- Literatur
- Agenda
- Mitteilungen der Hochschulen
- Markt
- Produkte und Dienstleistungen
- Impressum
Wirklich künstlich!
(SUBTITLE) Landschaften im Computerspiel
Ein klärendes Licht auf das Verhältnis zwischen Realität und Virtualität zu werfen, ist zweifelsohne Aufgabe der Philosophen. [1] Zu schnell begeben wir uns auf Glatteis und verfangen uns in Widersprüchen. Will man die Wirklichkeitsnähe einer Sache betonen, sucht man gerne sprachlich-metaphorische Unterstützung in der Begriffswelt der Landschaft, spricht von bodenständig oder felsenfest.
Konträr dazu ist die Auffassung, Landschaft werde durch unsere Wahrnehmung überhaupt erst konstruiert, sei also höchst subjektiv. Landschaft ist dann das Bild des von mir wahrgenommenen Raumes, die Realität wird mittels der Wahrnehmung in eine Imagination überführt. Dieser Argumentation folgend, verwischt auch der Unterschied zwischen der realen Landschaft, in der ich stehe, und der virtuellen Landschaft eines Computerspiels, deren verblüffend realistische Grafik mir das Gefühl vermittelt, mich in ihr zu bewegen. Ob reale oder virtuelle Landschaft – beide werden erblickt, beide werden aber auch hergestellt.
Virtuelle Landschaften zu kreieren, ist Aufgabe einer vergleichsweise jungen Profession, der Spieleentwickler. Diese konstruieren Landschaften als virtuelle Räume, welche technische Möglichkeiten und Vorgaben mit den Erwartungen der zukünftigen Nutzer verbinden.
Landschaft als Setting
In den Werkstätten der Game Studios erfährt man einiges über Regeln und Bedingungen virtueller Landschaftsproduktionen. Zwar wird ein hoher Detailgrad in der Landschaftsdarstellung angestrebt, jedoch geht es nicht in erster Linie um fotorealistische Wiedergaben. Die Arbeit mit dem Medium Computerspiel stellt spezifische Anforderungen. Man will nicht nur die Wirklichkeit vermitteln, sondern, so ein Entwickler von Strategiespielen, auch das, was die Menschen sich vom Setting vorstellen. Man müsse versuchen, die Erwartungshaltung der «User» zu treffen. Dazu gehöre die Landschaft genauso wie die Ritterrüstung.[2] Diese Erwartungen seien zu bedienen und nicht das korrekte Abbild zu erschaffen.
Um dreidimensionale Landschaftsbilder zu erstellen, greifen die Konstrukteure selber auf vorhandenes Bildmaterial zurück. Als Quelle wird vor allem das Internet genutzt: Fotos, Gemälde – gerne Rembrandt – Satellitenbilder, alte Pläne. Nur selten wählt man die aufwändige Recherche vor Ort, um «Locations mit der Digicam zu scouten», wie es im Fachjargon heisst. Und wenn gar nichts anderes mehr geht, greift man auf ein Spezialwerkzeug zurück: die so genannten fraktalen Landschaftsgeneratoren, die nach bestimmten Vorgaben, etwa Berglandschaft mit Tannenwald, unendlich viele Variationen dieses Landschaftstyps liefern.
Stilisierte Landschaften
Abgestimmt auf die Ansprüche der potentiellen Nutzer, wird digitales Bildmaterial zu neuen Landschaftsbildern transformiert, von Abbild zu Abbild. Doch gibt es auch die Rückkopplung vom mehrfach modifizierten Abbild zurück zu der Landschaft, die zu gestalten Aufgabe der Landschaftsarchitekten ist? John Stilgoe, Professor für Landschaftsgeschichte an der Universität Harvard, formuliert diese Frage unter dem Vorzeichen globalisierter Märkte. «Wie gestalten wir Landschaften für Computerspiele, wenn die Spiele weltweit vermarktet werden sollen? Die Japaner können das sehr gut: stilisierte Wälder, stilisierte Felder, alles ist stilisiert. Immer unter der Fragestellung, wie kann ich es verkaufen? Man darf nie vergessen, dass diese Spiele entwickelt wurden, um Profit zu machen.»[3]
Von Seiten der Macher solch stilisierter Landschaften wird diese Einschätzung wiederum relativiert. Man könne auch als Europäer seinen eigenen Stil haben, man müsse nicht alles machen wie die Japaner. Allerdings müsse man sich schon ein bisschen angleichen und einen Stil finden, der auch im europäischen Ausland funktioniere und am besten auch in den Vereinigten Staaten. Schliesslich mache man ja Konsumgüter und wolle damit Geld verdienen. Womit doch wieder Stilgoes These stilisierter Landschaften bestätigt wäre. Dabei richtet Stilgoe sein Augenmerk auf den Zusammenhang zwischen Globalisierung und persönlicher Landschaftserfahrung des Einzelnen, die nach seiner Auffassung bereits in der Kindheit geprägt wird. Wenn, so Stilgoe, beispielsweise in Deutschland ein Kind den Schwarzwald als ersten Wald seines Lebens sieht, dann meint das Wort Wald für dieses Kind «Schwarzwald». Ganz anders in Mexiko, dort sieht ein Kind einen vollkommen anderen Typ von Wald.
Die prägende Bedeutung von Landschaftserfahrungen in der Kindheit beschreibt auch die tschechische Schriftstellerin Libuˇse Moníková. Mit zunehmendem Alter, stellt sie fest, werde Landschaft immer wichtiger, zu etwas Einmaligem, das sich nicht ersetzen lässt. So habe Claude Lévi-Strauss am Ende seiner Reisen in den «Traurigen Tropen» resümiert, welche Landschaft ihn am meisten beeindruckt habe. Er habe Dschungel und Hochplateaus gesehen, Hochgebirge, Küste, Meer – Landschaften in extremen Zuständen. Er sei aber zu dem Schluss gekommen, dass für ihn am beeindruckensten die urvertraute Landschaft seiner Kindheit sei – «das europäische Mittelgebirge mit Mischwald».[4]
Standards virtueller Realitäten
Doch welche Folgen hat es, wenn es für Kinder in Zukunft nur noch «den» Wald geben wird, eben jenen stilisierten Wald, der ihnen durch ihre Computerspiele vertrauter ist als der Wald vor der eigenen Haustür, in dem ihre Eltern sie vielleicht gar nicht mehr spielen lassen?
Wenn Kinder ihre Umgebung tatsächlich immer stärker nach den Standards virtueller Realitäten beurteilen – und das bezieht sich nicht nur auf die Art, sondern auch auf das wachsende Ausmass gestalteter Räume –, so wird sich das langfristig auch auf die Arbeit der Landschaftsarchitekten auswirken. Deren Kreativität und Gestaltungsspielraum würden unterhöhlt und kanalisiert, so die pessimistischen Stimmen in der Debatte. Das Gegenteil sei der Fall, sagen die Optimisten – tendenziell die finanziellen Gewinner. Die wachsenden technischen Möglichkeiten setzten ein ungeahntes kreatives Potential für die unterschiedlichsten Bereiche frei. Und gerade der Boom der Spielebranche böte auch kleineren Independentproduktionen ihre Nischen. Divergierende Einschätzungen gegenüber einer noch jungen Entwicklung, die kritisch zu beobachten in Zukunft unabdingbar sein wird.anthos, So., 2006.10.01
[1] Siehe dazu auch: Wirklichkeit! Wege in die Realität. Sonderheft Merkur 677/678, Heft 9/10-200
[2] Auszüge aus einem Interview der Autorin mit Tobias Severin, Spieleentwickler 4head studios, November 2005 in Hannover
[3] John Stilgoe, Professor für Landschaftsgeschichte an der Universität Harvard, äusserte seine Positionen in einem Interview mit der Autorin im Oktober 2005 in Harvard
[4] Libuˇse Moníková: Prager Fenster. Carl Hanser Verlag, München, Wien 1994
01. Oktober 2006 Stefanie Krebs