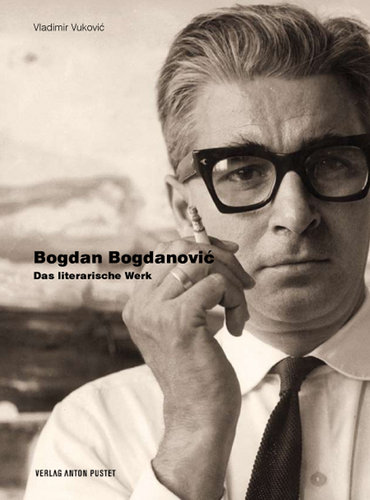Was tun mit dem Erbe des Diktators?
Es scheint, als ob die Wahrnehmung von Bau- und Kulturdenkmälern immer noch problematisch ist – besonders wenn sie aus einer undemokratischen oder diktatorischen Epoche stammen. In Belgrad übersteigt die Dimension des Regierungspalasts bei Weitem die Bedürfnisse des heutigen Serbiens.
Es scheint, als ob die Wahrnehmung von Bau- und Kulturdenkmälern immer noch problematisch ist – besonders wenn sie aus einer undemokratischen oder diktatorischen Epoche stammen. In Belgrad übersteigt die Dimension des Regierungspalasts bei Weitem die Bedürfnisse des heutigen Serbiens.
Die Nachkriegsmoderne des sozialistischen Jugoslawiens hat in Belgrad imposante Spuren hinterlassen, die weder der westlichen Moderne noch der typischen Architektur Osteuropas zuzuschreiben sind. Die Suche nach einem eigenen Baustil brachte besondere Bauten hervor, die mittlerweile reges Interesse der internationalen Fachwelt hervorrufen. Neu-Belgrad hätte nach dem Zweiten Weltkrieg ein Vorzeigebeispiel einer modernen Stadt für eine neue (sozialistische) Gesellschaft werden sollen, dem Palast der Föderation wurde dabei die Hauptrolle zugedacht. Der ursprüngliche Entwurf für dieses Regierungsgebäude ging als Siegerprojekt aus dem Architekturwettbewerb 1947 hervor, der landesweit ausgeschrieben war. Das erstplatzierte Team war ein kroatisches Planungsbüro unter der Führung von Vladimir Potočnjak. Ähnlich wie in den Planungen für Chandigarh oder Brasilia sollte der Palast der Föderation als Kopfgebäude am Anfang einer städtebaulichen Hauptachse stehen.
Die Bauarbeiten starteten bereits 1948, allerdings kam es in diesem Jahr zum Konflikt zwischen Tito und Stalin, der eine Krise in Jugoslawien auslöste. Die neue jugoslawische Regierung unter Präsident Tito weigerte sich, unter den Einfluss der Sowjetunion zu kommen. Die Beziehungen zu allen osteuropäischen Staaten wurden abgebrochen, Jugoslawien wurde von der Sowjetunion militärisch bedroht. Die Krise bedeutete aber eine Emanzipation Jugoslawiens und den Anfang der Suche nach einem eigenen Weg zwischen West und Ost in Politik, Kunst und Kultur.
Weniger Monumentalität, mehr Leichtigkeit
Der Konflikt mit der Sowjetunion führte vorerst zum Baustopp in ganz Neu-Belgrad. Ein Jahr später war noch nicht einmal der ganze Rohbau des Palasts der Föderation fertiggestellt. Erst nach Stalins Tod normalisierten sich die Beziehungen zwischen Jugoslawien und der Sowjetunion. Mit den Bauarbeiten in Neu-Belgrad ging es 1955 weiter, nach dem Tod von Vladimir Potočnjak wurde die weitere Planung vom Belgrader Architekten Mihailo Janković übernommen. Janković überarbeitete das Projekt von Potočnjak, indem er dem ursprünglichen Konzept weniger Monumentalität und mehr Leichtigkeit verlieh – teilweise eine Abkehr vom sowjetischen Modell und eine Zuwendung zum westlichen Vorbild der Moderne. Das Gebäude wurde fertig, rechtzeitig zu einem weiteren politischen Großereignis in Jugoslawien: zur Gründungskonferenz der Blockfreien Staaten, die in Belgrad stattfand.
Mit einer Gesamtnutzfläche von 65.000 m² ist der Palast nach wie vor einer der größten Bauten Serbiens. Hier befinden sich über 1000 Büroräume, sechs repräsentative Salons und ein zentraler Festsaal für 2000 Gäste, über dem eine große Glaskuppel thront. Die sechs Salons wurden den sechs Teilrepubliken Jugoslawiens gewidmet, die jeweils den Innenraum mit eigenen Künstlern und Designern gestalteten, großteils durch traditionelle Manufakturen. Die namhaftesten Künstler:innen Jugoslawiens waren an der Ausstattung der Innenräume beteiligt: Patar Lubarda, Anton Augustinčić, Đorđe Andrejević Kun, Predrag Peđa Milosavljević, Milan Konjović, Jovan Rakidžić.
Und auch für die Außenhülle wurde ein besonderes Material gewählt: der berühmte weiße Marmor von der kroatischen Insel Brač. Der edle Stein erlangte seinen Ruhm bereits im Mittelalter und ziert prominente Bauten weltweit: von der Kathedrale in Šibenik bis zum Weißen Haus in Washington.
Nach dem Zerfall Jugoslawiens wurde der Palast der Föderation in Palast Serbiens umbenannt. Die Dimension des Gebäudes übersteigt bei Weitem die Bedürfnisse des heutigen Serbiens. Als Sitz von drei Ministerien und als Ort für feierliche Staatsempfänge ist der Palast jedoch nach wie vor als Regierungsgebäude in Betrieb. Aus diesem Grund sind der Zugang und die Besichtigung der Räumlichkeiten erschwert, und so bleibt das Innere selbst Einheimischen weitgehend unbekannt.
An den moralischen Pranger gestellt
Das Beispiel vom Palast der Föderation spricht ein aktuelles Thema an. Vor Kurzem waren wir Zeugen des Machtwechsels in Syrien. Über den Palast des gestürzten Diktators Bashar al-Assad in Damaskus berichtete die westliche Presse mit auffällig viel Ablehnung und Hohn. Sogar Kenzo Tange als ursprünglicher Planer des Gebäudes wurde an den moralischen Pranger gestellt. Eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Gebäude, mit der Zeit und mit den Umständen, in denen diese Architektur entstand, war nicht zu finden. Es scheint, als ob die Wahrnehmung von Bau- und Kulturdenkmälern aus der Vergangenheit immer noch problematisch ist, besonders wenn diese eine undemokratische oder diktatorische Epoche war, die allgegenwärtig in Erinnerung ist.
Titos Regime war zwar nicht mit Assads Schreckensherrschaft gleichzusetzen, aber auch in Jugoslawien gab es die Verfolgung von politischen Gegnern, für die noch sinnbildlich die berüchtigte Strafinsel Goli otok in der kroatischen Adria steht. Allerdings war Jugoslawien im Vergleich zu den Ländern unter sowjetischem Einfluss eine menschlichere Variante des Realsozialismus oder, nach Henry Lefebvre, eine Art „dionysischer Kommunismus“.
Kulturschaffende waren Titos Vertraute
Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Tito in den Kreisen politisch linksorientierter Intellektueller verkehrt, die enge Kontakte mit avantgardistischen Kunstströmungen in Westeuropa pflegten, wie der Dada-Bewegung oder dem Surrealismus. Ihr Einfluss war deutlich spürbar im Jugoslawien der Zwischenkriegszeit, aber auch danach. Einige der Akteure dieser Kulturszene, Marko Ristić, Koča Popović, Oskar Davičo oder Dušan Matić, waren die engsten Vertrauten Titos und bekleideten nach dem Krieg wichtige staatliche Posten. Es wird vermutet, dass Titos Abkehr vom sowjetischen Modell und seine spätere liberale Kulturpolitik nicht zuletzt ihrem Einfluss zuzuschreiben waren.
In Serbien wuchern aktuell megalomanische Projekte ausländischer Investoren, wie die Belgrade Waterfront, die von zweifelhafter architektonischer, städtebaulicher und soziologischer Qualität sind. Misswirtschaft und schlechte Bauausführung führen mitunter sogar zum Tod von Menschen – wie beim Dacheinsturz des Bahnhofs in Novi Sad im November 2024. Es ist zu hoffen, dass die Bauproduktion in Serbien an die gute Tradition aus der Vergangenheit anknüpfen kann und die internationale Wahrnehmung von Architektur und Kunst ohne ideologische Grenzen und Vorurteile bleibt.
Spectrum, Di., 2025.01.21