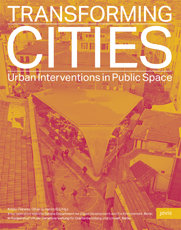Lew-Tolstoi-Schule in Berlin
Zweckmäßig und (trotzdem) formschön: Im Zusammenspiel von einem Plattenbauriegel und einem »angedockten« Erweiterungsbau mit räumlich wirksamen Zwischentönen erweist sich ein kunstvolles Miteinander von Konstruktion, Materialien und Ornamentik.
Zweckmäßig und (trotzdem) formschön: Im Zusammenspiel von einem Plattenbauriegel und einem »angedockten« Erweiterungsbau mit räumlich wirksamen Zwischentönen erweist sich ein kunstvolles Miteinander von Konstruktion, Materialien und Ornamentik.
In der Bundeshauptstadt wird an 34 Standorten der Staatlichen Europa-Schule Berlin jeweils bilingualer Unterricht in Deutsch und in einer von insgesamt neun Sprachen erteilt (Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch). Eine von insgesamt drei russischsprachigen Schulen ist die Lew-Tolstoi-Schule, eine Grundschule im Lichtenberger Ortsteil Karlshorst. Seit fast einem Vierteljahrhundert ist die Schule im Rheinischen Viertel verwurzelt, ganz in der Nähe des Museums Berlin-Karlshorst (zuvor Deutsch-Russisches Museum; nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 umbenannt) in einer früheren Heerespionierschule der Wehrmacht, dem Ort der deutschen Kapitulation im Mai 1945.
Einfamilienhäuser, vereinzelt auch mehrgeschossige Plattenbauten, ein versperrter Hochbunker und der Friedhof Karlshorst prägen das unmittelbare Umfeld der Schule. Etwas weiter südlich, nahe dem bereits erwähnten Museum, ist das Bundesamt für Strahlenschutz untergebracht, außerdem weisen sechs stark baufällige, aber denkmalgeschützte und teilweise gewerblich genutzte ehemalige Flugzeughallen darauf hin, dass hier einmal die Fliegerstation Berlin-Friedrichsfelde angesiedelt war. In dieser heterogenen Umgebung entstand bereits 1967, auf vormaligen Ackerparzellen und einem Abschnitt des östlichen Römerwegs, ein Schulgebäude des in der damaligen Hauptstadt der DDR häufig errichteten Plattenbautyps Berlin SK mit einer Ein-Feld-Halle in Sonderbauweise, die als 15. Polytechnische Oberschule eröffnet und ab 1970 nach der sowjetischen Kosmonautin Valentina Tereschkowa – der ersten Frau im Weltraum – benannt wurde. Seit 1991 wird das Gebäude als Grundschule genutzt, die seit 1992 Unterricht auch in Russisch anbietet. Ihren heutigen Namen Lew-Tolstoi-Schule trägt sie seit 1995.
Der viergeschossige Plattenbau mit zusätzlichem Tiefparterre (ursprünglich Mensa, heute als Bibliothek genutzt) und einbündiger Korridorerschließung sowie quer durchgesteckter Eingangshalle mit angrenzendem Annex (Haupttreppenhaus und Sanitärbereiche) wurde bereits 1998 energetisch erneuert. Im April 2019 begannen die Arbeiten an einem Schulerweiterungsbau und an einer neuen Zwei-Felder-Sporthalle (am östlichen Ende des Grundstücks mit separatem Zugang für Vereinssportler von der Zwieselerstraße) nach Plänen des Berliner Büros AFF Architekten, das 2016 einen entsprechenden Wettbewerb gewonnen hatte. Dessen Konzept sah vor, zwar unmittelbar an den Bestandsbau »anzudocken«, jedoch Räume für eine andere Pädagogik zu schaffen, die sich auch in der Architektur ausdrücken sollte. Im Unterschied zu den separierten, aneinandergereihten Klassenräumen des Plattenbaus sollten in einem plastisch geformten Erweiterungstrakt differenzierte Clusterräume entstehen. Zwischen dem vergrößerten und neu erschlossenen Schulgebäude und den beiden Sporthallen (Alt- und Neubau) sollten sich Sport-, Spiel- und Pausenflächen zu einer Folge differenzierter Außenräume ergänzen.
Kreation moderner Lernlandschaften
AFF Architekten sind bereits seit langer Zeit im Schulbau tätig; die Lew-Tolstoi-Schule ist ein weiterer Etappenschritt bei der Suche nach neuen typologischen und formalen Lösungen für zeitgemäße Nutzungsanforderungen. Bereits beim Neubau für Grundstufenklassen der Gemeinschaftsschule Anna Seghers in Berlin-Adlershof (2010) sind die – dort einbündigen, u-förmigen und mit grellgelber Farbe überzogenen – Erschließungsflächen teilweise aufgeweitet, zudem prägt eine Ornamentfassade mit unregelmäßigem Punktraster das äußere Erscheinungsbild. Bei der gleichfalls u-förmigen Ludwig-Hoffmann-Grundschule in Berlin-Friedrichshain (2012) ging es erstmals explizit um die Aufwertung von Erschließungsflächen zu multifunktional – auch für einen informellen Unterricht – nutzbaren Räumen. Im Falle der Dolgenseeschule in Berlin-Lichtenberg (2013) beschränkte sich der Auftrag der Architekten, die es hier erstmals mit einem Typenbau SK Berlin zu tun hatten, auf Sanierungsmaßnahmen im Gebäudeinneren und auf eine energetische Ertüchtigung der Bestandsfassaden, die gleichwohl eine neue, QR-Codes entlehnte ornamentale Neugestaltung erhielten. Abhängig vom jeweiligen pädagogischen Konzept der Schulen und ihrem Auftragsvolumen, setzten AFF Architekten auch bei den Erweiterungen des Arndt-Gymnasiums in Berlin-Dahlem (2016) und der Kaiserin-Theophanu-Schule in Köln (2020) sowie beim Neubau der Albert-Schweitzer-Schule in Wiesbaden (2021) kontinuierlich ihre Forschen-durch-Bauen-Tätigkeit mit dem Ziel, moderne Lernlandschaften zu kreieren, fort.
Verbindung von Alt und Neu
Beim Erweiterungsbau der Lew-Tolstoi-Schule war das Haupttreppenhaus des Altbaus Ausgangspunkt der konzeptionellen Überlegungen: Es sollte auch zur Erschließung der neuen Lernebenen in den OGs sowie der – aufgrund des Höhensprungs (das über eine Außentreppe erschlossene EG des Altbaus liegt um ein halbes Geschoss höher) – besonders hohen Räume im EG (Verwaltungs- und Lehrerzimmer sowie die zum Außenbereich zu öffnende Mensa) des neuen Bautraktes mitgenutzt werden. In den OGs sind Alt- und Neubautrakt niveaugleich miteinander verbunden. Im Erweiterungsbau ergänzen sich jeweils zwei Klassenräume und ein dazwischen liegender Gruppenraum, der auch für die Nachmittagsbetreuung genutzt wird, zu einem Cluster. Die zentralen Erschließungs- bzw. Begegnungsräume sind so großzügig dimensioniert, dass sie auch zum Spielen, für informellen Unterricht oder zum Chillen genutzt werden können; durch Vor- und Rücksprünge abwechslungsreich gestaltet, laden ihre Sitzbereiche zum Verweilen und zu Ausblicken auf die Schulhöfe ein. Natürlich belichtet werden sie über wenige große Fassadenöffnungen und zusätzlich über die Profilglaswände der Gruppenräume, das zweite OG ist zusätzlich mit runden Oberlichtern ausgestattet. Für Kunstlicht sorgen große runde Leuchten an den Sichtbetondecken.
Ebenso wie die neue »Schulstraße« mit den angrenzenden Räumen im EG und das zusätzliche Treppenhaus an der Südostecke werden auch die Begegnungs-, Klassen- und Gruppenräume von wenigen Materialien und Farben geprägt: Fließestrich- bzw. Linoleumböden, Sichtbeton- oder grün gestrichene Wände, orangefarbene Türzargen und Handläufe. (Mehr) Farbe und Leben sollen in erster Linie die Schülerinnen und Schüler selbst in die Räume einbringen.
Bei der äußeren Erscheinung des Erweiterungsbaus entschieden sich AFF Architekten, auch mit Blick auf den grauen Farbton des Plattenbaus, für eine monochrome Fassade mit glasierten und profilierten Fliesen im Wechsel zu matten Putzflächen, jeweils in Perlbeige. Großformatige formplastische Sichtbetonelemente mit runden Öffnungen vor den offenen Begegnungsräumen und Fensterbandabschnitte mit perlbeigen Metallrahmen strukturieren im steten Wechsel die OGs, bodentiefe Verglasungen mit umlaufenden Betongewändern (Entree, Lehrerzimmer, Mensa) setzen besondere Akzente. Die im Werk vorgefertigten Sichtbetonelemente und auch die glasierten Fassadenelemente sind moderne Neuinterpretationen von typischen Bauelementen entlang der Karl-Marx-Allee in Berlin mit ihren ornamental hervorgehobenen Solitärbauten, wie dem Kino International und dem Café Moskau.
An der Nahtstelle zwischen Alt- und Erweiterungsbau entstand ein kleiner Vorplatz – als neue »Adresse« der Schule – mit einer Aluminiumgussplastik von Sven Kalden, die an die Kosmonautin und frühere Namensgeberin der Schule im Raumanzug erinnert. Nordöstlich an das Bauensemble schließen der von Pola Landschaftsarchitekten neu gestaltete große Pausenhof mit Freisportflächen zwischen den beiden Sporthallen an.
db, Fr., 2024.03.01
verknüpfte Zeitschriften
db 2024|03 Zwischentöne