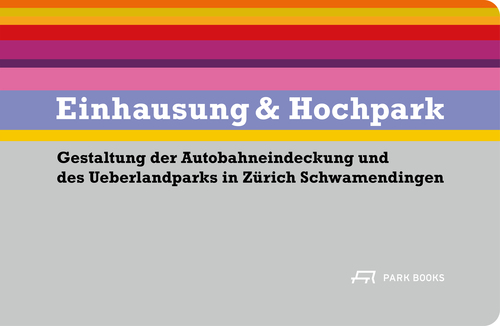Die Zürcher und ihr Fussballstadion, das ist ein Trauerspiel in zwei Halbzeiten mit Nachspielzeit. Rückblick auf eine zwanzigjährige Geschichte des Scheiterns.
Die Zürcher und ihr Fussballstadion, das ist ein Trauerspiel in zwei Halbzeiten mit Nachspielzeit. Rückblick auf eine zwanzigjährige Geschichte des Scheiterns.
Elmar Ledergerbers gemusterte Krawatte war das Fröhlichste an diesem tristen Septembertag im Jahr 2004. Im schmuckvollen Musiksaal des Zürcher Stadthauses hat der anpackende SP-Stadtpräsident vor versammelter Presse eingestehen müssen: Wir schaffen es nicht.
Das sportliche Ziel, für die Fussball-Europameisterschaft 2008 in Zürich-West ein stattliches Stadion für 30 000 Zuschauer zu realisieren, erwies sich als illusorisch. Zu gross war der Widerstand aus dem Quartier; zu komplex die juristischen Streitigkeiten. Stattdessen sollte das Letzigrundstadion für die drei EM-Spiele auf Zürcher Boden vorgezogen werden.
Der Immobilienchef der Credit Suisse, der das Projekt auf dem Hardturm damals als Grundeigentümer und Investor verantwortete, sass neben Ledergerber und nickte bei dessen Ausführungen traurig im Takt. In seinem schwarzen Anzug und mit der schwarzen Krawatte sah er aus, als sei er Gast an seiner eigenen Beerdigung. «Aus der Traum», titelte die NZZ tags darauf.
Tatsächlich war die Pressekonferenz vor 14 Jahren so etwas wie eine vorgezogene Trauerfeier für die hochfliegenden Stadionpläne der Ära Ledergerber. 2009 liess die CS das sogenannte Pentagon-Stadion dann endgültig fallen. Den epischen Rechtsstreit zuvor verfolgte die Restschweiz wahlweise mit Kopfschütteln oder mit einer ordentlichen Portion Schadenfreude. Bis heute warten die Fussballklubs GC und FCZ auf ein richtiges Stadion.
Am Sonntag stimmen die Zürcherinnen und Zürcher darüber ab, ob ein erneuter Anlauf auf dem Hardturm – der mittlerweile dritte – von Erfolg gekrönt sein wird. Warum tut sich die Stadt so schwer damit, eine Stätte für die beliebteste Sportart der Welt zu errichten? Warum scheiterten die vergangenen Versuche kläglich? Um Antworten zu finden, treffen wir Protagonisten, die auf dem Hardturm in den letzten beiden Jahrzehnten ihre Spuren hinterlassen haben.
Ganz nahe dran am Geschehen – damals wie heute – war Urs Spinner. Anfang 2003 trat er seine Stelle als Kommunikationsleiter im städtischen Hochbaudepartement an. Einer seiner ersten Aufträge damals lautete, die Abstimmung über den Gestaltungsplan des Pentagon-Stadions in die Wege zu leiten. «Ich war ganz neu», erinnert er sich. «Zuerst musste ich mich informieren, was ein Gestaltungsplan eigentlich genau ist.» Spinner, zuvor Sprecher von WWF Schweiz und «Blick»-Journalist, wurde ins kalte Wasser geworfen – und er hat das Bassin bis heute nie ganz verlassen. «Das Stadion verfolgt mich», sagt er. «Es ist fast wie ein Fluch.»
Dank der «Euro-Euphorie»
Wir treffen Spinner im obersten Stock des Stadthauses. In der Cafeteria für Verwaltungsangestellte klopft ihm ein Arbeitskollege auf die Schultern: «Na, kommt das Stadion endlich?», fragt er. «Ja», antwortet Spinner, «aber den ersten Anpfiff gibt es erst nach meiner Pensionierung.» Beide lachen. Heute ist Spinner Departementssekretär und 59 Jahre alt.
Zur bevorstehenden Abstimmung äussert er sich so kurz vor der Entscheidung nicht. Aber zur Vergangenheit hat er viel zu erzählen. An die folgenschwere Pressekonferenz von 2004 erinnert er sich zum Beispiel, als wäre es gestern gewesen. Zum Bersten voll sei der Musiksaal damals gewesen, überall Kameras, Mikrofone, Notizblöcke.
Unter den Verantwortlichen habe «Waterloo-Stimmung» geherrscht, sagt Spinner. Als Kommunikationschef versuchte er einen kühlen Kopf zu bewahren – was nicht so einfach gewesen sei. Praktisch zeitgleich, als Ledergerber und die Hochbauvorsteherin Kathrin Martelli (fdp.) den Letzigrund als alternativen Standort für die EM anpriesen, verschickte der Schweizerische Fussballverband ein Communiqué: Wegen der jüngsten Entwicklungen habe man entschieden, die «Zürcher» EM-Spiele in Bern, Basel oder Genf durchzuführen.
«Wir waren völlig perplex», sagt Spinner. «Der Verband fuhr uns in die Parade.» Es brauchte ein Machtwort des europäischen Fussballverbands Uefa, der damit drohte, die EM nachträglich nach Irland zu vergeben, um die Schweizer Kollegen wieder in die Spur zu bringen.
Der Letzigrund konnte im Anschluss in Rekordtempo realisiert werden. Einen drohenden Rekurs von Anwohnern verhinderte die Stadt mit Verhandlungsgeschick. «Wir haben Lärmschutzfenster versprochen, so konnten wir uns unbürokratisch einigen», erinnert sich Spinner. «Sonst wäre wohl auch dieser Plan B gescheitert.» Am Ende sei der Letzigrund «überraschend schlank» realisiert worden. Die drei EM-Spiele fanden in Zürich statt.
Ganz anders die Situation auf dem Hardturm. Spinner verdreht die Augen. «Oje», murmelt er und fasst sich an die Stirn. Dabei habe doch alles so vielversprechend angefangen. Das Pentagon, ein Wurf von Meili Peter Architekten, fand in der breiten Bevölkerung Anklang. Trotz (oder wegen) seinen wuchtigen Dimensionen stimmte eine satte Mehrheit von 63 Prozent dem Gestaltungsplan und einer kleinen finanziellen Beteiligung der Stadt 2003 zu. Die «Euro-Euphorie», wie sie Spinner nennt, lag in der Luft. Die Finanzierung übernahm mit der CS grossmehrheitlich ein privater Investor. Auch das habe die Stimmbürger überzeugt.
Trotzdem spürte Spinner früh, dass nicht alle zufrieden waren. Namentlich die Quartierbevölkerung im Kreis 5 war wenig begeistert. Nein, sie war richtig erzürnt. Spinner erinnert sich an Informationsveranstaltungen im Vorfeld der Abstimmung «in den Höhlen der Löwen» – im Herdernhochhaus, im Kulturlokal Sphères und im Gemeinschaftsraum der Kraftwerk-Genossenschaft. «Uns schwappte eine Welle der Ablehnung entgegen», erzählt Spinner.
Die Kritik war vor allem gegen die sogenannte Mantelnutzung des Stadions mit einem grossen Shoppingcenter gerichtet. Den Widerstand der Anwohner hat im Wesentlichen eine Frau formiert: Monika Spring. «Kämpferisch», «leidenschaftlich», «laut», das sind die Adjektive, die Urs Spinner einfallen, wenn er an die damalige SP-Gemeinderätin und spätere Kantonsrätin zurückdenkt. «Mir war klar: Die meint es ernst.»
Wegen zwölf Zentimetern
Heute lebt Monika Spring immer noch im Kreis 5. Sie empfängt uns in ihrer Wohnung in der Überbauung Limmatwest. Das Industriequartier hat sich über die Jahre stark gewandelt. Noch Mitte der neunziger Jahre lebten kaum mehr als 1500 Leute dort. Heute, nachdem der äussere Kreis 5 als Zürich-West Karriere gemacht hat, sind es gegen 6000. Die IG Hardturmquartier, die Spring mitbegründet und viele Jahre präsidiert hat, war die Fürsprecherin der wachsenden Wohngegend.
Mitten in diese Entwicklung platzte nach der Jahrtausendwende das mächtige Pentagon-Stadion. Im Quartier habe es bald den Übernamen «Elmarion» erhalten, erzählt Spring – in Anlehnung an Elmar Ledergerber, der sich den Bau zum persönlichen Ziel gesetzt hatte.
Im Nachgang zur Urnenabstimmung beschloss man, gegen den Gestaltungsplan und die Baubewilligung zu rekurrieren. Monika Spring erinnert sich lebhaft an diese hektische Zeit. Der Druck auf die Quartierbewohner sei immer grösser geworden – erst recht, als das Projekt wegen der EM 2008 beschleunigt werden sollte. «Leute im Quartier wurden bedroht», sagt sie. Spring selber erhielt massive Drohungen per Mail. Einmal lag ein Couvert mit weissem Pulver in ihrem Briefkasten.
Dabei hätten die Anwohner einfach gemerkt, dass nicht alles sauber gewesen sei am Projekt. Mit dem Schattenwurf habe es nicht so genau gestimmt, und beim Grundwasser sei es besonders seltsam gewesen: Schon im Umweltverträglichkeitsbericht sei gestanden, man habe den Grundwasserspiegel auf dieser oder jener Höhe «definiert». Das Bundesgericht stellte dann fest, dass man beim Kanton auf veraltete Berechnungsgrundlagen abgestellt hatte.
Urs Spinner hat den Rechtsstreit von der anderen Seite erlebt. «Stägeli uf, Stägeli ab» seien die Rekurse durch alle Instanzen gezogen worden. Auch die Bauherren hätten sich nicht alles gefallen lassen und gewisse Urteile angefochten. In den meisten Fällen haben sie recht erhalten.
Die Anwohner liessen aber nicht locker. Oft hätten sie sich auf Details gestürzt. Beim vielzitierten Disput um den Schattenwurf ging es am Ende um zwölf Zentimeter, um die das Stadion in der Höhe angepasst werden musste. «Zwölf Zentimeter!», wiederholt Spinner. Gegen die geänderten Baupläne hagelte es dann erneut Rekurse. «Für die Bauherren war es eine nervenaufreibende Zeit», fasst er zusammen.
Am 4. Juni 2009 hatte die CS genug. Sie beerdigte das Pentagon, weil sie das Projekt nicht mehr für wirtschaftlich hielt. Ein halbes Jahr zuvor hatte sie das alte Hardturmstadion abgerissen – «in einem einsamen Entscheid», wie Spinner festhält. Der alte Fussballtempel war sanierungsbedürftig; die CS wollte mit dem Abriss aber auch Fakten schaffen.
Für Monika Spring gab es schon vor dem Entscheid vom Juni 2009 Anhaltspunkte dafür, dass die Grossbank ihrer Sache nicht mehr so sicher war. Deren Vertreter hätten sich im Quartier erkundigt, welche Nutzungen denn gewünscht gewesen seien. Und auch die Journalisten merkten, dass man etwas hilflos nach Alternativen suchte. Wo ursprünglich ein Hotel geplant war, sah man nun plötzlich ein Gesundheitszentrum vor.
Dass auch das geplante Einkaufszentrum problematisch sein könnte, merkte man spätestens, als jenes im «Puls 5» nicht so richtig zum Laufen kommen wollte. «Letztlich war die CS wohl gar nicht so unglücklich, dass das Projekt nicht zustande kam», sagt Spring.
Urs Spinner teilt die Einschätzung der Quartiersprecherin teilweise. Die Kosten für das Pentagon seien tatsächlich laufend gestiegen – auch wegen des lange andauernden Rechtsstreits. Weitere Verzögerungen seien absehbar gewesen. «Irgendwann war einfach genug.» Die CS versuchte im Nachgang gemeinsam mit der Stadt zu retten, was zu retten war.
An einer ziemlich improvisierten Medienkonferenz präsentierten sie eine alternative Überbauung mit einem städtisch finanzierten Stadion und Wohntürmen der CS. «Die Terminpläne waren völlig unrealistisch», erinnert sich Spinner. Im Hochbaudepartement habe man die Stirn gerunzelt. Tatsächlich verschwand dieses Projekt rasch wieder in der Schublade. Weitere Alternativen wurden verworfen – etwa jene, das Stadion an einem anderen Standort zu realisieren und auf dem Hardturm vor allem Wohnungen zu bauen.
Die Planer waren in einer Sinnkrise. Mit dem Rücktritt von Elmar Ledergerber als Stadtpräsident fehlte der grosse Euphoriker an der Spitze. Ein zweites Pentagon zu planen, war in jener Zeit völlig undenkbar. Die Neuauflage musste bescheidener, kleiner ausfallen – darin war man sich einig. Ein Bijou, kein übertriebener Prachtsbau war nun gefragt.
«Die Zeiten hatten sich geändert», sagt Spinner. Die Ära Ledergerber sei von Aufbruchsstimmung geprägt gewesen, vom Willen nach dem grossen Wurf. Und GC mit seinen traditionell guten Verbindungen zur CS war damals noch einflussreicher. «Die alten Bande spielten», sagt Spinner. Nach dem Rückzieher der CS seien jedoch viele langjährige Gewissheiten ins Wanken geraten.
Die Stadt plante schliesslich ein eigenes Stadion auf dem Hardturm, das sogenannte Hypodrom für rund 19 000 Zuschauer. Das Land stellte die CS zu einem günstigen Preis von 50 Millionen Franken zur Verfügung; eingehandelt war ein Rückkaufsrecht, von dem die Bank Gebrauch machen kann, sofern bis 2035 kein Sportstadion auf dem Hardturm steht.
Verwaltungsintern sprach man davon, dass das Hypodrom das «weibliche» Stadion war im Gegensatz zum «männlichen» Pentagon. Hochbauvorsteherin Kathrin Martelli trieb das Projekt voran. Das Quartier sollte diesmal besser einbezogen werden.
Von den Bewohnerinnen und Bewohnern seien viele Vorschläge für mögliche Zusatznutzungen eingegangen, sagt Monika Spring. «Eine Turnhalle wäre zum Beispiel ideal gewesen.» Tagsüber hätten sie die Fussballer nutzen können, am Abend die Quartierbevölkerung. Auch ein Schulhaus war unter den Vorschlägen. Am Ende wurde nichts davon aufgenommen. Immerhin kam eine gemeinnützige Siedlung mit rund 150 Wohnungen hinzu. Im Quartier war man zufrieden.
Doch es taten sich rasch neue Fronten auf. Und je näher der Abstimmungstermin vom September 2013 über einen Kredit von 216 Millionen Franken rückte, desto lauter wurde die Opposition. Urs Spinner nennt bis heute zwei Hauptschuldige dafür, dass das Hypodrom an der Urne letztlich gescheitert ist: die NZZ wegen ihrer «Kampagne» gegen das städtisch finanzierte Projekt und ein gewisser Jungpolitiker namens Gian von Planta.
Politischer Selbstmord
Wir treffen den GLP-Politiker, der die Pläne für das städtische Stadion quasi im Alleingang zu Fall gebracht haben soll, in Zürich Höngg. Von Planta – modisch gekleidet in Mantel und Turnschuhen – schaut sich ein Erstligaspiel zwischen dem SV Höngg und dem FC Linth Glarus an.
Das kulinarische Angebot besteht in erster Linie aus Würsten – «gut durchgebraten, nicht so wie die im Letzigrund», wie ein Matchbesucher einem anderen kennerhaft zuraunt. Der Eintritt beträgt zehn Franken. Man hört die Spieler mit dem Schiri schimpfen, hört die Anweisungen, die Spieler und Trainer unentwegt über den Platz schreien, hört den unangenehm dumpfen Knall, als zwei Spielerkörper bei einem Zweikampf aufeinanderprallen.
Gian von Planta wohnte früher unweit des Sportplatzes Hönggerberg und war hier oft anzutreffen. Als Junior spielte er selber bei GC. Seit er aus Zürich weggezogen ist, sind die Matchbesuche etwas seltener geworden. Während sich die Spieler auf dem Platz abmühen, erzählt der frühere Zürcher Stadtparlamentarier, wie es dazu kam, dass ausgerechnet er als Fussball-Fan zum Stadiongegner wurde.
Er zieht ein Sichtmäppchen aus seinem Mantel. Es geht um Zahlen. Als der Stadtrat nach dem Scheitern des Pentagon-Projekts den Bau eines eigenen Stadions forcierte, war zunächst von einem Kostenteiler die Rede. Die Stadt sollte 20 Millionen Franken bezahlen, die Fifa einen Beitrag in derselben Höhe spenden, FCZ und GC je fünf Millionen Franken einschiessen. Als es dann an die Ausführung ging, war von Fremdbeiträgen mit einem Mal nicht mehr die Rede. «Mir kam es so vor, als wolle man sich beim Staat bedienen», sagt von Planta.
Höngg gerät in Rückstand: Der Schiedsrichter hat Elfmeter gepfiffen, obwohl das Foul ausserhalb des Strafraums begangen wurde, «mindestens zwei Meter!», mault ein Spieler der Heimmannschaft. Von Planta erzählt vom Abend, als das Geschäft im Stadtparlament debattiert wurde. Kollegen verschiedener politischer Couleur hatten ihm politischen Selbstmord prophezeit, wenn er sich gegen das Stadionprojekt stelle.
Dennoch redet er dagegen an – als Einziger. Lediglich 15 versprengte Abweichler verschiedener Parteien folgen ihm in der Schlussabstimmung. Danach fragte ihn der damalige AL-Gemeinderat Niklaus Scherr halb spöttisch, halb im Ernst: «Und jetzt? Bodigst du das Stadion allein?»
Genau das tat von Planta. Er suchte via Facebook nach Gleichgesinnten. Deren fünf fanden sich, darunter ein FDP-Mitglied, ein junger Grafiker, eine Mitarbeiterin des Mieterverbands. Geld für eine Kampagne hatten sie nicht, aber die Medien interessierten sich früh für das Nein-Komitee, für das fast ausschliesslich von Planta sprach.
Im Hintergrund bearbeitete das Komitee Parteimitglieder von GLP und FDP vor deren Parolenfassung – in beiden Fällen mit Erfolg. Mit 50,8 Prozent Nein-Stimmen-Anteil lehnten die Stimmberechtigten den Stadionkredit schliesslich an der Urne denkbar knapp ab. Für von Planta war es die Bestätigung, dass es sich lohnt, an die eigene Meinung zu glauben, auch wenn man ganz alleine steht.
Höher als die Kirchturmspitze von Höngg
In der Stadtverwaltung hingegen machte sich Ernüchterung breit – einmal mehr. «Was mich wirklich ärgert», sagt Urs Spinner in der Stadthaus-Cafeteria, «ist das viele Geld, das auf dem Hardturm schon verlocht wurde.» Bei den Steuergeldern alleine spreche man von einem zweistelligen Millionenbetrag.
Beim gegenwärtigen Projekt Ensemble, über das am 25. November abgestimmt wird, trägt zumindest die Stadt kein finanzielles Risiko. Die geplante Überbauung mit einem Stadion für 18 000 Zuschauer, einer Genossenschaftssiedlung mit 174 gemeinnützigen Wohnungen und zwei Hochhäusern mit knapp 600 Wohnungen wäre komplett privat finanziert.
Monika Spring, die härteste Kritikerin des ersten Projekts, sass in der Jury, die sich am Ende für das «Ensemble» aussprach. Im Quartier sei die Skepsis gegenüber dieser Vorlage wieder grösser, sagt sie. Die Jury habe in ihrem Bericht geschrieben, dass man das Siegerprojekt noch überarbeiten solle. Spring selber verstand darunter, dass man auch die Höhe der Wohntürme etwas reduzieren müsste. Drei Stockwerke weniger, habe sie vorgeschlagen, sei aber nicht durchgedrungen.
Es sei doch absehbar gewesen, dass die Höngger dies nicht akzeptieren würden. «Höher als die Kirchturmspitze von Höngg, das geht gar nicht!» Sie kritisiert auch die architektonische Gestaltung der Türme und der Sockelgeschosse, und sie fragt sich, warum nicht eine Begrünung der Hochhausfassaden erwogen worden sei.
Zudem hält Spring die Finanzierung für «zu undurchsichtig». Die Investoren hätten in puncto Details der Kalkulation keine Transparenz zugelassen. Auf der andern Seite findet sie, dass die Initiative der SP, die erneut ein steuerfinanziertes Stadion vorsieht, viel zu spät gekommen sei.
Sie habe sich aus der parteiinternen Diskussion herausgehalten und wisse selber noch nicht, wie sie stimmen wolle, sagt Spring. Vielleicht könnten sie die fussballbegeisterten Jungen noch von einem Ja überzeugen. Der Tonfall der Abstimmungskampagne gefalle ihr jedenfalls nicht. «Hätte die SP eine ganz normale Kampagne gemacht, hätte sie bessere Chancen gehabt», glaubt sie.
Optimistisch bis zum Schluss
Auf dem Sportplatz Hönggerberg scheint mittlerweile Flutlicht auf den Kunstrasen. Der SV Höngg gleicht aus, Rockmusik scheppert aus den Lautsprechern. Am Ende wird der Heimklub die Partie knapp gewinnen. In der Pause sitzt Gian von Planta auf einer Festbank und trinkt Bier. Er mag die ungekünstelte Erstliga-Atmosphäre. Das bedeutet aber nicht, dass er etwas gegen Fussball in modernen Stadien hätte, im Gegenteil. Die Argumente der heutigen Stadiongegner kann er nicht nachvollziehen. Das Projekt Ensemble entspricht ziemlich genau seiner Wunschvorstellung.
Nach seinem Stadion-Coup vor fünf Jahren galt von Planta als kommender Mann bei der Zürcher GLP. Aus familiären Gründen zog er nach Baden, dort sitzt er für die Partei im Stadtparlament. Doch am Tag der Abstimmung wird er nach Zürich schauen. Bekäme die Stadt doch noch ihr Fussballstadion, wäre das für ihn eine erneute Genugtuung. Als Stadionverhinderer will er nicht in Erinnerung bleiben. Urs Spinner wagt keine Prognose, wie die Abstimmung vom kommenden Sonntag ausgehen wird. «Ich bin aber optimistisch», sagt er. «So, wie ich es in den letzten 15 Jahren immer war.»
Neue Zürcher Zeitung, Do., 2018.11.22