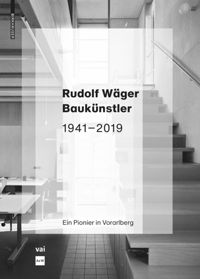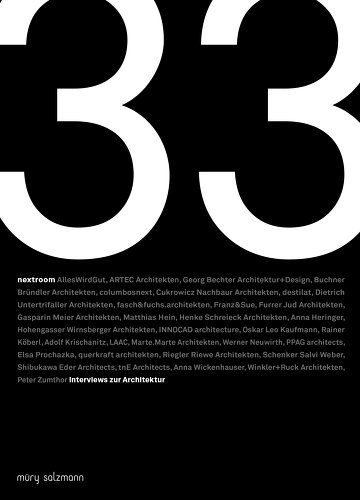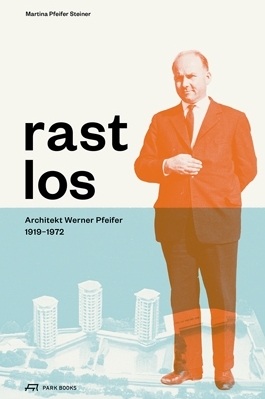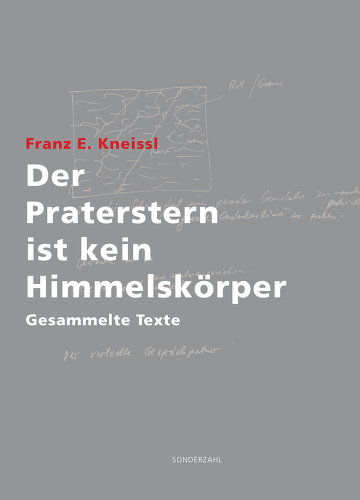„Von Bauwerken, die an ihrem Ort eine besondere Präsenz entwickeln, habe ich oft den Eindruck, sie stünden unter einer inneren Spannung, die über den Ort...
„Von Bauwerken, die an ihrem Ort eine besondere Präsenz entwickeln, habe ich oft den Eindruck, sie stünden unter einer inneren Spannung, die über den Ort...
„Von Bauwerken, die an ihrem Ort eine besondere Präsenz entwickeln, habe ich oft den Eindruck, sie stünden unter einer inneren Spannung, die über den Ort hinausweist. Sie begründen ihren konkreten Ort indem sie von der Welt zeugen. Das aus der Welt Kommende ist in ihnen eine Verbindung eingegangen mit dem Lokalen.“, schreibt Peter Zumthor in seinem Buch `Architektur denken´[1]. Vielleicht macht genau das Zumthors Bauten so spektakulär, wobei für seine wahrhafte Architektur dieses Eigenschaftswort überhaupt nicht adäquat ist. Eindrucksvoll ist jedoch, was seine Häuser mit dem Ort und den Menschen machen. Das weiß auch KUB Direktor Thomas D. Trummer ganz genau: „Die Möglichkeiten, die das Kunsthaus Bregenz bietet, sind einzigartig. Dieser Raum schafft es, dass wir die Wahrnehmung intensivieren. Das erleben nicht nur die BesucherInnen so, sondern auch die KünstlerInnen.“ Wie aufsehenerregend und immer komplett einmalig, um in Superlativen zu bleiben, das wurde bei der Rückschau anlässlich des 20 Jahre-KUB Jubiläums wieder offenkundig. Ebenfalls erwiesen, was das andere große Werk des Architekten im Bregenzerwald als Versammlungsort für die Menschen und ihre handwerklichen Produkte macht. Anlässlich der Fertigstellung 2013 bemerkte Zumthor: „Es war für mich spannend, mit dem Werkraumhaus ein ländliches Gegenstück zum Kunsthaus Bregenz zu bauen, das ebenso stolz ist und selbstbewusst. Das nicht nur vom eigenen Dorf spricht, sondern auch ein wenig von der Welt. Interessant war das Abwägen zwischen Bäuerlichen und Städtischen, wie ländlich oder wie elegant das Haus werden sollte.“
Zumthor bespielte `sein´ Kunsthaus 2007 schon einmal. Die eindrucksvolle Ausstellung `Bauten und Projekte 1986 – 2007´ zeigte nicht nur Modelle (die sieben Jahre später das KUB Sammlungsschaufenster eröffneten) und Pläne, sondern eine Videokunst-Installation, die auf sechs raumhohen Screens pro Stockwerk insgesamt zwölf seiner Bauten, aus sechs Blickwinkeln gefilmt, als Cyberspace im Maßstab 1:1 durchwandern ließ. Bei Zumthors zweiter großen KUB-Ausstellung geht es diesmal nicht um seine Werke. Er hat sich wieder einen besonderen Ansatz ausgedacht: Zumthor lädt ein, zeigt was ihm wichtig ist – Dear to Me - und teilt es, er lädt zum großen Fest der Künste, das vier Monate lang im KUB ausgerichtet wird.
Musik und Literatur
Ein Spektakel, und jetzt passt das Wort! Wie schaffen die das, 150 Veranstaltungen? Doch fragen wir uns nicht immer wieder, wie das KUB-Team in nur drei Wochen alle Spuren verwischt und das Neue installiert? Denken wir nur an die aufwändige vorangegangene Ausstellung `Adrián Villar Rojas´! Zumthor verwandelt das Haus nun in vier verschiedene Kunstlandschaften. Im Erdgeschoß - Lounge-Atmosphäre: Ein großflächiger roter Teppich, zugeschnitten, auf dem schwarzen Podest ein Bösendorfer-Flügel, der Baldachin darüber sowie die geometrischen Paneele an den Wänden haben neben formalen auch akustische Funktionen. 36 Sessel, 36 Hocker und 6 Sofas in braunem Leder wurden von Zumthor eigens entworfen und gehen anschließend in die neue Kollektion eines Deutschen Möbelherstellers über. Es gibt eine Bar und nach sechs Uhr, bei Veranstaltungen, einen Drink, den der Architekt kreierte. Nur an diesem Ort erfährt man auf Monitoren etwas über Zumthors Arbeit. Die filmische Collage von Christoph Schaub, zusammengestellt aus Interviews, Gesprächen, Vorträgen und Diskussionen der letzten 30 Jahre basiert auf Themen, die im Schaffen und Denken des Architekten wichtig sind.
Peter Conradin Zumthor, der Sohn, ist Kurator des musikalischen Programms. Er interpretiert den Titel der Ausstellung so: „In Bezug auf Peter Zumthor und die ihm liebe Musik bedeutet das: Neues und Altes, Ernstes, Augenzwinkerndes, Komponiertes, Improvisiertes, Naturbelassenes, Ausgeklügeltes, Radikales, Überbordendes, Minimalistisches, Tanzbares, Berühmtes, Unbekanntes, Riskantes, Erprobtes, Internationales, Lokales. So lange es gut ist, gilt: It’s dear to me.“ Der Musiker konnte Olga Neuwirth dafür begeistern, ein Stück für Lochkarte und Spieluhr zu komponieren. Im ersten Obergeschoß bleibt das Kunsthaus wie es ist, sogar die langen schwarzen Sitzbänke versammeln sich hier zu abstrakten Linien. Zentral eine zarte Skulptur, die den 16 Meter langen Lochkartenstreifen bis an die Lichtdecke schweben lässt. Die Komposition `Tinkle for P.Z.´ dürfen die BesucherInnen auf der Spieluhr `klimpern´ lassen und erleben zudem die Musik auch optisch, denn in den grafischen Mustern auf dem Band sind deutlich einfache Tonleitern bis zu rasenden Akkordfolgen im voraus sichtbar.
In klassischer Hängung gibt es in diesem Stockwerk noch ein fotografisches Essay von Hélène Binet. Die Tessiner Fotografin hat das KUB schon bei der Eröffnung 1997 fotografiert. Hier findet man ihre noch nie in dieser Form ausgestellte Schwarz-Weiß Bilderserie, mit den gepflasterten Wegen auf die Akropolis in Athen, des griechischen Landschaftsarchitekten Dimitris Pikionis (1887–1968).
Eine Bibliothek
Das literarische Programm kuratiert die Literaturwissenschaftlerin Brigitte Labs-Ehlert. Sie ließ sich bei der Auswahl der Schriftsteller und der Lesetexte auf `Atmosphären´ ein, die Zumthor in seinem ebenso titulierten Buch beschreibt. Besonders erfreulich ist, dass der Georg Büchner Preisträger Marcel Beyer einen neuen Text beiträgt, der im KUB uraufgeführt wird. Das wird wohl im zweiten Stock stattfinden, denn dort ist eine Bibliothek eingerichtet. Ein Dickicht von Bücherwänden fasst eine Privatsammlung von 40.000 Bänden. Sie gruppieren sich labyrinthartig um ein Forum, das mit Stühlen der ältesten Schweizer Stuhl- und Tischmanufaktur `horgenglarus´ möbliert ist.
Wahrlich eine imposante Installation, die schon einen Glücksfall und freundschaftliche Vernetzung voraussetzte. Walter Lietha führte vierzig Jahre lang das `Antiquariat Narrenschiff´ in Chur und ist soeben im Begriff, seine immense Sammlung an Büchern, Bildern, Kleinplastiken, Dokumenten, Fotos, Schallplatten und Sammlungen von Antiquitäten aller Art nach Trin zu transportieren, das Narrenschiff übersiedelt nämlich in die ehemalige Bergpension Ringel. Dadurch war es möglich einen großen Teil der Bücher vorübergehend nach Bregenz zu bringen. Die Sammlung bibliophiler und kostbarer Werke befindet sich bereits im `Ringel-Refugium´. Somit darf die im Kunsthaus eingerichtete Bibliothek benutzt werden, da es sich um ein Gebrauchsantiquariat handelt. Wir werden also Tage im KUB verbringen, und besondere Entdeckungen machen können. Lietha sammelte alle Schätze, die andere Menschen entsorgen wollten. „Mir war bewusst geworden, dass Bücher großartige Zeitmaschinen sind, die Gedanken in gedruckten Buchstaben blitzschnell, über die Zeiten hinweg in mein Bewusstsein zu senden wussten. Dieses Phänomen, das nicht der Vergänglichkeit der Zeit folgte, konnte nur als Geist definiert werden, zeitlos in Büchern in gedruckter Form gebannt und aufbewahrt“, sagt er.
Ein Garten
Für das oberste Geschoss erschafft das Künstlerpaar Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger einen Garten. Ob sie Zumthor ihren Entwurf vorher präsentierten? „Nein, das war eine Einladung an die Künstler, ich habe schon gesehen, dass sie zauberhafte Gärten machen, das gefällt mir gut, da hab ich keine Sorge, ich weiß ja wen ich einlade“, sagt er. `Lungenkraut´ ist der Titel dieser Kunstlandschaft und nach den Fotos und Texten des Künstlerpaars zu urteilen, wird es sehr poetisch.
Konzerte, Lesungen und Gespräche wird es geben, „hochkarätig, anspruchsvoll, überraschend, lustvoll, spielerisch, versponnen, volkstümlich, ausgelassen“. Es sei geplant, dass Zumthor jeden Donnerstag nach Bregenz kommt und bis Sonntag vor Ort bleibt, vorausgesetzt es ist eine schöne Bleibe zu finden. Das gehört wohl zum Konzept, er nimmt sich die Zeit. Von September bis Jänner lädt Zumthor außerdem sonntagvormittags GesprächspartnerInnen ein. Dazu wird sich das Erdgeschoß mit der Bühne anbieten. Aber insgesamt findet das Fest der Künste im ganzen Haus statt. So erfüllt es beispielsweise der Posaunist, der sich zwei Tage lang überall im Haus bewegt, mit Musik. „Die Einladung, das KUB zu bespielen, gibt mir Gelegenheit, Träume dieser Art wahr werden zu lassen und diese mit allen Besucherinnen und Besuchern zu teilen.“
[1] Peter Zumthor, Architektur denken, Birkhäuser, Basel, 2010, S. 41
newroom, Mo., 2017.09.11