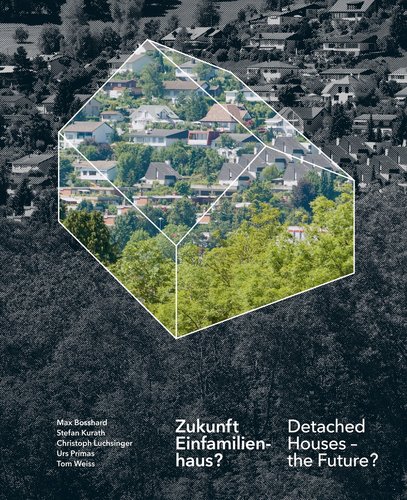Alfred Brunnsteiner
Georg Hochreiner
PIRMIN JUNG Schweiz AG
Konrad Merz
Kurt Pock
Johann Riebenbauer
Richard Woschitz
zuschnitt
»Was heißt konstruieren mit Holz – heute und morgen?«
Holzbau und Architektur sind befreundete Disziplinen, weil dreidimensionales Vorstellungsvermögen, ein umfassendes Planungsverständnis, die Liebe zur Materialität...
Holzbau und Architektur sind befreundete Disziplinen, weil dreidimensionales Vorstellungsvermögen, ein umfassendes Planungsverständnis, die Liebe zur Materialität...
Holzbau und Architektur sind befreundete Disziplinen, weil dreidimensionales Vorstellungsvermögen, ein umfassendes Planungsverständnis, die Liebe zur Materialität und – nicht zuletzt, sondern zuvorderst – die Lust auf experimentelle Lösungen sie verbindet. Das Innovationspotenzial im Holzbau erscheint immens, allerdings auch die Grenzen von dessen Umsetzbarkeit.
Im Spannungsfeld zwischen Systementwicklungen und individuellen Lösungen, zwischen optimiertem Workflow und traditioneller Zimmerei bauen sich die Problematiken von Form- und Materialkongruenz, Planungsschnittstellen und Kostenwahrheiten auf – und nicht zuletzt von Verantwortlichkeiten für Kosten und andere Planungsfolgen. Wenn die These von der Freundschaft zutrifft, dann müsste hier auch die Solidarität von Holzbau und Architektur greifen...
Die Ingenieure Alfred R. Brunnsteiner, Georg Hochreiner, Pirmin Jung, Konrad Merz, Kurt Pock, Johann Riebenbauer und Richard Woschitz beantworteten per E-Mail Fragen zum Stand des Holzbaus.
Wie schätzen Sie aus heutiger Sicht die gestalterischen Chancen des Bauens mit Holz in Konkurrenz zu anderen Bauweisen ein? Welche architektonischen Potenziale hat Holz und sind diese schon ausgelotet?
Alfred R. Brunnsteiner
Durch plattenförmig vorgefertigte Bauteile aus Holz, wie osb, Furniersperrholz, Brettsperrholz etc. kommt man nahe an die Gestaltungsmöglichkeiten von Stahlbeton heran.
Georg Hochreiner
Der Ingenieurholzbau hat sich als »Königsklasse«, als Lehrmeister für künftige Ingenieure etabliert, da er alle Komponenten enthält, die auch bei anderen Bauweisen zur Anwendung kommen. Aktuell ist dieses Wissen nur bei wenigen Experten vorhanden und gipfelt in einzelnen Pilotprojekten und vielen missverstandenen Nachahmungen.
Pirmin Jung
Hölzerne Tragwerke, Flächenbauteile und Verkleidungen für unterschiedlichste Projektarten bergen ein riesiges, noch nicht ausgeschöpftes Gestaltungspotenzial.
Konrad Merz
Das Potenzial liegt in der Vielseitigkeit von Holz. Es sind Bauteile möglich, die nicht nur tragen, sondern gleichzeitig auch den Raum begrenzen, hohen Anforderungen an Oberflächen und Haptik genügen, dämmen und regulierend auf das Raumklima wirken.
Johann Riebenbauer
Holzbau ist im Gegensatz zu Stahl- und Stahlbetonbau wesentlich komplexer, die Grenzen des Sinnvollen und Wirtschaftlichen sind oft schneller erreicht. An eine gewisse »Grenzenlosigkeit« zum Beispiel des Stahlbaus kommt man nicht heran.
Richard Woschitz
Dank neuer Entwicklungen in der Verbindungsmitteltechnik, der Bearbeitungsmöglichkeiten von Holz und des Einsatzes digitaler Technologien in Planung und Herstellung entstehen noch nie gesehene Formen in der Holzarchitektur. Holz hat enormes architektonisches Potenzial, es muss nur konstruktiv richtig eingesetzt und mit modernsten Technologien verarbeitet werden.
Wo liegen aus Ihrer Sicht die (sinnvollen) statisch-konstruktiven Grenzen des Holzbaus? Welche räumlichen Dimensionen und welche Querschnitte sind heute machbar und auf welche Weise? Wo sehen Sie Innovationspotenzial?
Alfred R. Brunnsteiner
Wie Stahlbeton kann man auch Holz vorspannen. Größe hat eigentlich nur mit Höhe zu tun, je weiter gespannt wird, desto mehr konstruktive Höhe braucht es, egal mit welchem Material.
Georg Hochreiner
Die Querschnittsabmessungen sind mit den maschinellen Entwicklungen explosiv gewachsen und reichen heute von Lattenquerschnitten mit 3 mal 5 cm bis hin zu blockverleimten Brettschichtholzbauteilen mit Abmessungen von 60 mal 300 cm. Das dazugehörige Materialverständnis ist jedoch in vielen Fällen auf dem Stand von vor fünfzig Jahren zurückgeblieben, die normative Infrastruktur ist auf klassische Bauweisen abgestimmt und mit unflexiblen Bemessungsrezepturen untermauert.
Pirmin Jung
Für die räumliche Dimension gibt es für mich so keine (sinnvollen) Grenzen. Die Gebäudegeometrie mit der jeweils möglichen statischen Höhe entscheidet über die Spannweite. In einigen Jahren werden wir Hallen und mehrspurige Schwerlastbrücken mit über 100 Metern Spannweite sowie Hochhäuser aus Holz bauen. Dazu müssen wir u. a. Bauteile und Verbindungen für den Meganewton-Lastbereich entwickeln.
Kurt Pock
Konstruktive Grenzen gibt es aus meiner Sicht praktisch keine. Limitierend sind oft die Transportlängen und die Montagestöße. Innovationspotenzial sehe ich vor allem in der Verbindungs- und Fügetechnik. Gerade bei den Standardformteilen für den Holzhausbau besteht großes Potenzial. Hier bauen wir oft hoch entwickelte Elemente mit überalteten, nicht richtig auf die Anforderungen abgestimmten Verbindern zusammen.
Johann Riebenbauer
Sehr verkürzt: Brettsperrholz kann in Stärken von bis zu 60 cm produziert werden, ein 20-geschossiges Bauwerk mit 8 bis 9 Metern Deckenspannweite benötigt im eg eine 24 cm dicke Wand. Ein 100 Meter hoher Turm für Windkraftanlagen ist mit 30 cm Wandstärke machbar.
Richard Woschitz
Bei Großstadien sind die maximalen Spannweiten nur durch Netzwerkkuppeln zu erreichen. Bei Tragwerken mit geraden Stäben können beim Einsatz von Einfeldsystemen mit Vollwandträgern aus Brettschichtholz Spannweiten von 30 Metern, mit unterspannten Trägern Spannweiten von 50 Metern erreicht werden. Setzt man parallelgurtige Fachwerkträger ein, sind Spannweiten von 70 Metern, mit Fachwerkrosten sogar von 100 Metern möglich. Durch den Einsatz der cnc-Technik sind heute (fast) alle Querschnittsformen möglich. Das größte Innovationspotenzial sehe ich in der Verbindungsmitteltechnik sowie in der Homogenisierung des Werkstoffes Holz in der Palette der Holzwerkstoffprodukte.
Wie verläuft Ihrer Meinung nach idealerweise der Planungsprozess Architekt – Holzbauingenieur – Holzbauer – Ausführung? Wie gestalten sich aus Ihrer Sicht diese Schnittstellen?
Alfred R. Brunnsteiner
Beim Vorentwurf sollte der Tragwerksplaner schon neben dem Architekten sitzen. Die ersten Rechenschritte erfolgen auf Basis des Vorentwurfes. Die Holzbaufirmen sind auch immer hilfreich, jedoch in ihrer Fertigungstechnik verwurzelt. In der Auslobungsphase ergeben sich natürlich immer wieder Veränderungen infolge der Bieterideen, da muss das Planungsteam flexibel reagieren können.
Georg Hochreiner
Aktuell verfügen Architekten – bis auf wenige Ausnahmen – noch nicht über genügend Erfahrung im Umgang mit dem Baustoff Holz. Es ist daher zu empfehlen, gleich in den ersten fünf Minuten des architektonischen Entwurfes den Holzbauingenieur mitwirken zu lassen.
Pirmin Jung
In der Schweiz hat sich ein optimaler Planungsprozess etabliert: Vom ersten Entwurf weg entwickeln die Architekten die Tragstruktur und den Holzsystembau zusammen mit einem von Unternehmungen und Produkten unabhängigen Holzbauingenieur. Dieser erledigt die Detailplanung und die Statik, erstellt das detaillierte Leistungsverzeichnis für alle Leistungen, die der Holzbauer zu liefern hat und zeichnet während der Realisierung im Auftrag des Bauherrn für die Qualitätssicherung verantwortlich.
Konrad Merz
Möglichst frühe Einbindung des Ingenieurs und anschließend »herkömmlicher« Weg der Projektbearbeitung. Holzbauunternehmungen machen auf Basis der Ausführungsplanung von Ingenieur und Architekt die Werkstattplanungen.
Kurt Pock
Die Zusammenarbeit sollte so früh wie möglich starten, zumindest zwischen Architekt und Holzbauingenieur, der Holzbauer als Ausführender kann ja nur in Ausnahmefällen in der Planungsphase hinzugezogen werden (Vergaberichtlinien!). Im Zuge der Werkstattplanung soll ein Dialog zwischen Tragwerksplaner und Holzbauer stattfinden, um die Potenziale der Firma im Bereich des Abbundes und der Vorfertigung bestmöglich einzubringen.
Johann Riebenbauer
Ich habe in den letzten Jahren viele Versionen der Zusammenarbeit ausprobiert: nur mit ausführenden Firmen, Varianten über ausführende Firmen, nur Vorstatik und Firma macht die Ausführungsstatik – sowie Planung mit Architekten vom Entwurf weg bis zur Ausführung. Nur letztere Version ist wirklich zielführend! Die besten Projektergebnisse (auch in wirtschaftlicher Hinsicht) gelingen, wenn man der ausführenden Firma alles vorgeben kann.
Richard Woschitz
Architekten und Holzbauingenieure sitzen im selben Boot, mit dem optimalen Ergebnis als gemeinsames Ziel. Um das zu erreichen, ist der Ingenieur zunehmend als gleichermaßen kreativer Gegenpart zum Architekten gefragt, als entwerfender Tragwerksplaner und nicht nur als rechnender Statiker. Architekt und Holzbauingenieur sind aber auch in Ihrer Konstruktionswahl immer verpflichtet, auf die Herstellungs- und Baustellenlogistik zu achten. Erst nach diesen Prozessen sollte der ausführende Holzbauer beigezogen werden, um den kreativen Planungsprozess nicht einzuschränken.
Unter welchen Voraussetzungen sind Holzbaukonstruktionen kostengünstiger als andere Bauweisen?
Alfred R. Brunnsteiner
Ein Pfetten- oder Sparrendachstuhl ist am billigsten mit Holz zu machen. Bei flächigen und räumlichen Bauteilen ist man kostenneutral. Jeder Baustoff hat seine Vor- und Nachteile. Wenn ein Baustoff und die statische Höhe optimiert werden können, kommen fast immer die gleichen Kosten heraus. Preisunterschiede entstehen erst bei Höhenproblemen, weit gespannte schlanke Dächer werden dann meist in Stahl errichtet.
Georg Hochreiner
Wenn mit dem Rohstoff sparsam und effizient umgegangen wird, müssen Holzkonstruktionen nicht mehr zu Liebhaberpreisen eingekauft werden, sondern erweisen sich sogar als wirtschaftlicher. Voraussetzung dafür ist aber Input von Know-how in die Konstruktion inklusive Detailausbildung. Dies liegt dann auf der Linie nachhaltiger Bewirtschaftung, ist jedoch noch nicht in den Köpfen der Industrie verankert, die aktuell noch möglichst viel Holz mit traditionellen Methoden verkaufen will.
Pirmin Jung
Holztragwerke mit einem für den Holzbau optimalen Spannweiten-Höhen-Verhältnis sind billiger als Stahl- und Betontragwerke, auch bei großen Spannweiten und Lasten. Bei Geschossbau ist der Holzbau bei relativ einfachen Grundrissen, im energieeffizienten Bauen (Minergie-P, Minergie-Eco) und bei Schul- und Verwaltungsbauten kostenmäßig konkurrenzfähig.
Konrad Merz
Der Holzbau hat im Geschossbau seine Vorzüge, wenn folgende Punkte zutreffen: regelmäßig strukturierte Grundrisse, Spannweiten unter 6 Metern, möglichst linienförmige Lastabtragung (tragende Wände), tragende Deckenbauteile sichtbar belassen als hochwertige Oberflächen, hohe Anforderungen an den U-Wert der Gebäudehülle. Im Ingenieurholzbau haben Holzkonstruktionen Vorteile bei anspruchsvollen geometrischen Formen und auch, wenn die tragenden Bauteile direkt raumbildend wirken sollen.
Kurt Pock
… wenn das exzellente Verhältnis von Gewicht und Tragfähigkeit dieses wunderbaren Werkstoffs zum Tragen kommt. Dies ist bei großen Spannweiten der Fall. Massive Konstruktionen tragen vor allem sich selbst. Holz hat hier dank seines geringen Eigengewichts echte Vorteile.
Johann Riebenbauer
… nur wenn Leichtigkeit ein Faktor ist bzw. wenn die Bauweise sehr umfassend beurteilt und verglichen wird. Ansonsten ist der Holzbau in Mitteleuropa immer teurer als andere Bauweisen, da im Holzbau meist höhere Maßstäbe angesetzt werden. So gibt es Architekten, die mit Holz nicht bauen, wenn man außen nicht sieht, dass es ein Holzhaus ist. Holzfassaden sind aber teurer als Putzfassaden …
Richard Woschitz
… wenn – bei sparsamstem Holzeinsatz – Systembau in der Holzkonstruktion angewendet wird. Entscheidend ist die konstruktive Effizienz zwischen Materialeinsatz und Tragvermögen.
In welcher Form beeinflusst die internationale – ja, globale – Verbreitung des Holzbaus dessen Techniken und Fertigungsmethoden?
Alfred R. Brunnsteiner
Man sollte immer einheimisches Holz verwenden. Holz aus den Regenwäldern sollte für uns tabu sein. Verrückt ist es auch, wenn Holz aus Weißrussland kommt, in Zentraleuropa verarbeitet und dann in Kanada verbaut wird. Die Globalisierung sollte im gesamten Bauwesen, nicht nur im Holzbau, zum Ideenaustausch führen; die Techniken und Fertigungsmethoden können dann für alle nur besser werden.
Georg Hochreiner
Auch wenn Holzkonstruktionen weltweit errichtet werden, dominieren immer noch nationale Baupraktiken, limitiert durch das lokale Ausbildungssystem für die Baufachleute.
Die Kommunikation von Bildern funktioniert, der Transfer von Fachwissen jedoch wesentlich schlechter. Marketing ist also nicht mehr das alleinige Instrument für die Erschließung neuer Märkte.
Pirmin Jung
Beispiele aus anderen Ländern geben hiesigen Bauherren und Architekten das Vertrauen, dass eine bestimmte Bauaufgabe auch in Holzbauweise möglich ist. Natürlich orientiert man sich am Ausland, um für die eigene Arbeit neue Impulse und Ideen zu erhalten.
Konrad Merz
Trotz Globalisierung bleibt das Bauen und damit der Holzbau ein Geschäft mit vielen nationalen und regionalen Eigenheiten.
Kurt Pock
Um international reüssieren zu können, müssen wir die Standardisierung im Holzbau vorantreiben, weg vom individuellen Prototypenbau hin zur allgemein bekannten Standardlösung. Das Handwerk des Zimmermanns beschränkt sich weitgehend auf den deutschsprachigen Raum. In anderen Ländern werden die Holzkonstruktionen von anderen Gewerken mitbearbeitet. Um dennoch die Qualität zu halten, sind klare und robuste Lösungen erforderlich.
Johann Riebenbauer
International gesehen fehlt es vielen Ländern an Holzbautradition. Fachleute mit einigermaßen fundiertem Wissen hinsichtlich Bauphysik usw. sind oft nicht vorhanden. Deshalb werden international gesehen nur sehr einfache Bauweisen Erfolg haben. Die Anforderungen sind international gesehen auch sehr unterschiedlich, ein Vergleich ist hier schwer, Ansätze, die bei uns Gültigkeit haben, sind in manchen Ländern unsinnig und umgekehrt.
Richard Woschitz
Je mehr beispielhaft ausgeführte Holzbauprojekte in der Öffentlichkeit wahrnehmbar werden, umso mehr wird ein Weiterentwicklungsprozess in der Holzbautechnik und Fügetechnik stattfinden.
(Die Antworten sind zum Teil stark gekürzt.)
zuschnitt, Mi., 2010.07.14