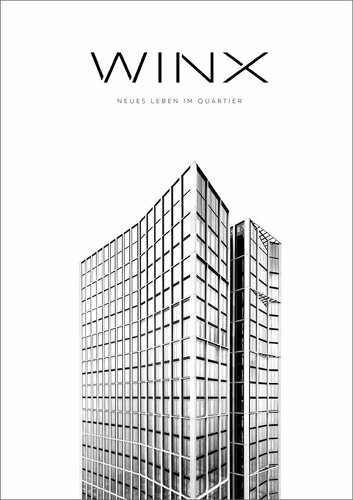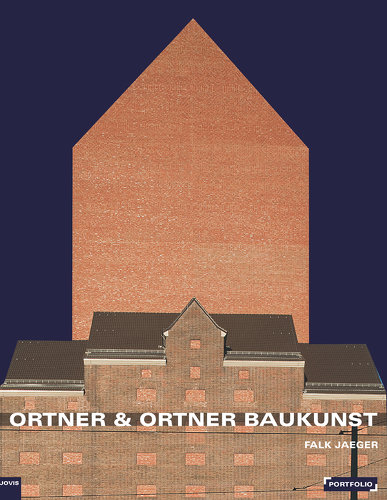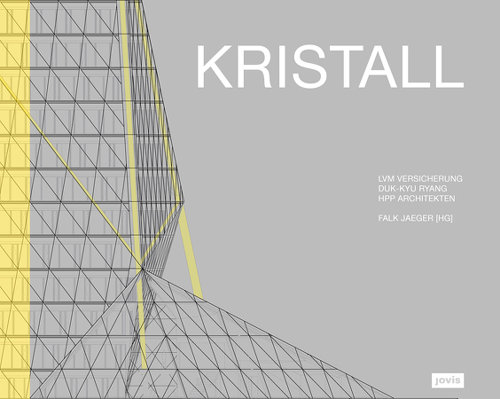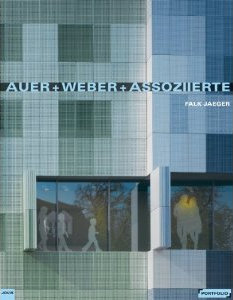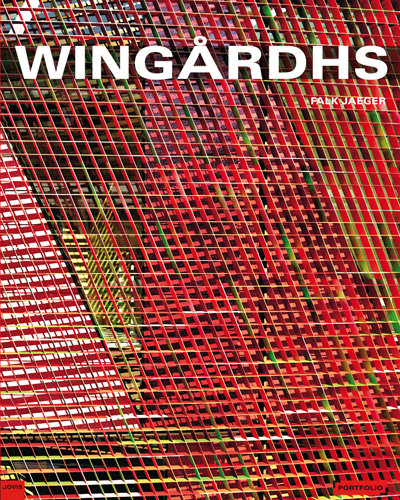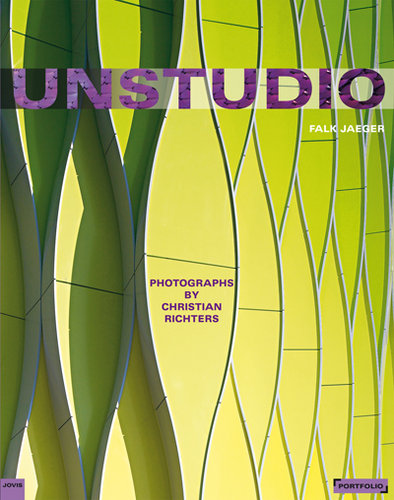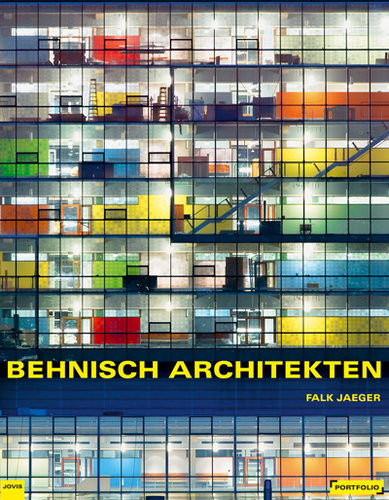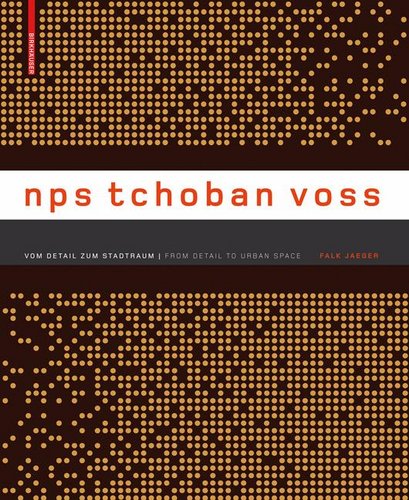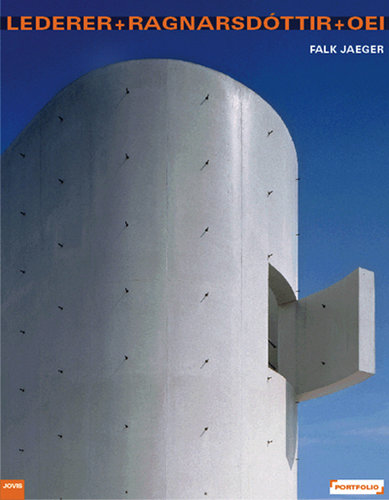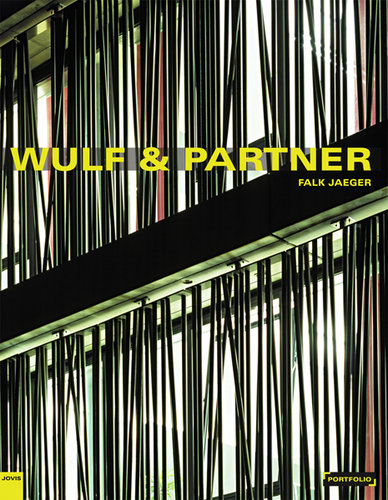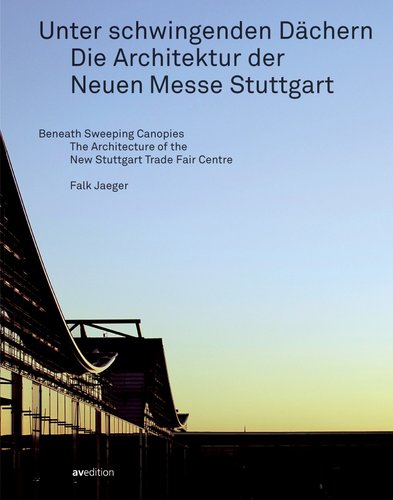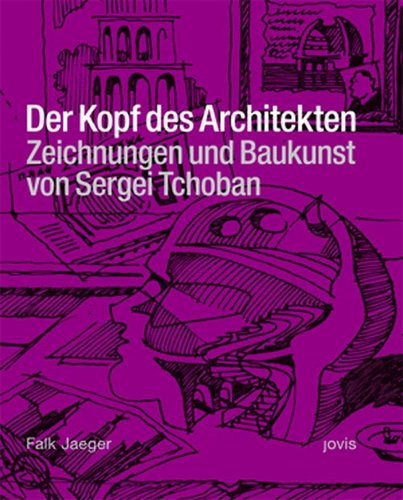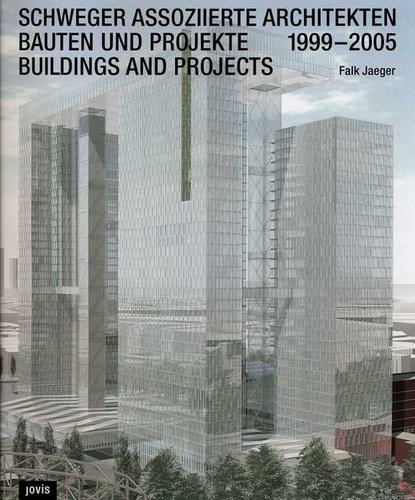Durch Günter Behnisch entstand eine »süddeutsche Architekturschule«, die es nicht immer leicht hat, landesweit Gehör zu finden – so sehen es die Stuttgarter Behnisch-Schüler von 4a-Architekten. Ein Gespräch mit den Büroinhabern Matthias Burkart, Andreas Ditschuneit und Ernst Ulrich Tillmanns, die sich in der Nachfolge Behnischs sehen, sich aber auch von seinen Ansichten emanzipierten.
Durch Günter Behnisch entstand eine »süddeutsche Architekturschule«, die es nicht immer leicht hat, landesweit Gehör zu finden – so sehen es die Stuttgarter Behnisch-Schüler von 4a-Architekten. Ein Gespräch mit den Büroinhabern Matthias Burkart, Andreas Ditschuneit und Ernst Ulrich Tillmanns, die sich in der Nachfolge Behnischs sehen, sich aber auch von seinen Ansichten emanzipierten.
Falk Jaeger: Sie sind Vertreter jener südwestdeutschen Architekturschule, die auf Günter Behnisch zurückgeht. Was war aus Ihrer Sicht das Wesentliche seiner Architekturauffassung?
Ernst Ulrich Tillmanns: Am wichtigsten waren ihm Leichtigkeit, Offenheit und Transparenz sowie das Verschmelzen von Innen- und Außenräumen. Die steinerne Schwere der Postmoderne – die zu unserer Zeit im Büro Behnisch in der Architekturwelt große Aufmerksamkeit erhielt – hat ihm nie gefallen.
Matthias Burkart: Ein weiteres zentrales Thema war für ihn das demokratische Bauen. Dafür stehen besonders zwei Hauptwerke: Das eine ist der Olympiapark in München als sehr offener, freier Landschaftsentwurf mit der gemeinsam mit Frei Otto geplanten Zeltkonstruktion. Das zweite Beispiel ist der Bundestag in Bonn, an dem wir mitgearbeitet haben. Dabei wurde eine »Landschaftsaue« aufgenommen – in Form des versenkten Plenarsaals mit einem freien Dach darüber. Diesen offenen, transparenten, vom Bürger einsehbaren, im übertragenen Sinn kontrollierbaren Raum hat Behnisch als »demokratische Architektur« verstanden.
Andreas Ditschuneit: Allerdings weisen beide Projekte sehr unterschiedliche Formen auf: Der Olympiapark ist stark organisch angelegt, während der Bundestag ein für Behnisch ungewöhnlich orthogonales, strenges Gebäude ist. Allerdings gibt es auch darin verspielte Dinge, z. B. das Vogelnesttreppengeländer.
War es Ihr erklärter Wunsch, im Büro Behnisch zu arbeiten oder war auch Zufall im Spiel?
Tillmanns: Die Stimmung der Zeit war geprägt durch verschiedene Protestbewegungen, z. B. gegen Atomkraft, den Nato-Doppelbeschluss oder die Startbahn West. Ich hatte das Bedürfnis, etwas Konstruktives zu tun, den Protest in etwas Positives zu wenden. Behnisch faszinierte mich damals, weil er einen Geist der Veränderung in Architektur umsetzte. Nicht der postmoderne formale Schnickschnack war für ihn interessant, sondern wie man ein Gebäude organisiert, wie es sich zur Landschaft verhält und wie man im Team arbeitet.
Was unterscheidet die südwestdeutsche Szene z. B. von Berlin oder Aachen?
Burkart: Berliner Architektur ist für uns Süddeutsche ja immer charakterisiert durch geschlossene, steinerne Fassaden. Behnischs Architektur war nie steinern. Seine Häuser zeigen Stahl und Glas und haben einen Bezug zur offenen Landschaft. Den suchen die Berliner nicht. Wie Behnisch bevorzugen auch wir heute noch Bauaufgaben, bei denen es um Solitäre in einem freien Umfeld geht.
Für Behnisch war das Experiment von großer Bedeutung. Lässt sich das heute noch durchhalten?
Burkart: Das Experimentelle wurde im Büro Behnisch nicht nur zugelassen, sondern gefördert. Bei seinem Hysolar-Gebäude für die Uni Stuttgart am Pfaffenwald konnten wir vieles ausprobieren. Heute dürfen wir bei keiner Bewerbung oder bei keinem Bauherrn erwähnen, dass wir experimentieren wollen.
Ditschuneit: Wir haben viel mit Materialien gespielt, auch mit neuen, z. B. mit Kunststoffplatten oder mit Doppelstegplatten. Ungewöhnlich war auch, wie man die Dinge dann zusammengefügt hat, wobei es auf Präzision nicht so sehr ankam. Manchmal gab es Brüche, aber die waren eigentlich willkommen, oft sogar gewollt. Hierzu erinnere ich mich besonders an das Postmuseum in Frankfurt: Um die Rotunde herum gibt es eine Verkleidung, deren Platten eine gezackte Kontur bildeten und der Rundung folgend abgesägt werden sollten. Behnisch war gerade auf der Baustelle und sagte: »Bloß nicht, lasst das! Es ist gerade gut, dass die Verkleidung eine ganz andere Geometrie einnimmt.«
Burkart: Und wir haben bei Behnisch die Schichten der Konstruktion immer offen gezeigt – die abgehängten Decken, die vorgehängten Fassaden. Um noch einmal auf den Vergleich zu Berlin zurückzukommen: Dort baut man viel mehr fugenlos monolithisch, das unterscheidet uns bis heute.
Städtebauwettbewerbe haben Behnisch nicht interessiert?
Ditschuneit: Das stimmt so nicht. Nach der Wende gab es in den neuen Bundesländern sehr viele Wettbewerbe. z.B. in Chemnitz haben wir an einem Wettbewerb für ein Universitätsgelände mit einem großen Studentenwohnheim und einer zentralen Mall teilgenommen. Wir haben strenge städtebauliche Achsen gezogen und alles gerastert und in Blöcke gegliedert. Das hat Behnisch nicht gefallen: »Zeichnet nicht so stures Zeug, macht das mal lockerer.« Am Schluss kam ein ganz wilder Entwurf heraus. Damit sind wir – wenig verwunderlich – in der zweiten Runde ausgeschieden, aber das hat er offenbar gerne in Kauf genommen.
Kann man sagen, dass Behnisch eine Art architektonischer Ideologie geprägt hat, die hier im Südwesten mitunter einen fast religiösen Charakter annahm?
Ditschuneit: Das könnte man so sagen. Das betraf schon die Art, wie man gezeichnet hat. Alle haben damals so gezeichnet, auch an den Hochschulen, vor allem natürlich an Behnischs Hochschule in Darmstadt.
Burkart: Jede Wand nur mit einem dünnen Strich …
Ditschuneit: … ja, alles mit lockerem Strich und möglichst unter Verzicht auf rechte Winkel. Viele der jungen Leute können heute nicht gut mit der Hand zeichnen. In unserem Büro kommen wir trotz Computer nicht umhin, zu skizzieren. Wir haben alle Skizzenrollen auf dem Tisch.
Noch einmal kurz zurück zum Arbeiten bei Behnisch. Wie ging er mit Leuten um, die nicht so dachten oder nicht so denken wollten wie er?
Ditschuneit: Er hat schnell gemerkt, wenn jemand aus einer anderen Richtung kam. Das ging nicht lange gut. Ich erinnere mich an den Spruch: »Wenn ihr was anderes wollt, dann schnürt euer Ränzlein und geht woanders hin.«
Burkart: Aber er hat natürlich viele Mitarbeiter aus Darmstadt geholt, z. B. Carola Wiese, Jens Wittfoth und Falk Petri. Unsere ganze Bonn-Truppe mit zwanzig Architekten bestand zum Großteil aus Darmstädtern, die er unterrichtet hatte.
Wie wurde entworfen?
Ditschuneit: Im Studium haben wir einmal Entwurfsmethoden verschiedener Architekturbüros verglichen und Behnisch gefragt, wie er seine Entwurfsmethodik beschreiben würde. Er hat uns verwundert angeschaut und gesagt: »Weiß ich nicht.« Schon der Begriff Entwurfsmethodik schien ihn irgendwie zu stören. Aber schließlich hat er uns doch einiges dazu sagen können.
Burkart: Eine festgelegte Entwurfsmethodik, bei der sich die Dinge wiederholen, war für ihn schon zu viel der Vorgabe. Wir haben auch nie ein Geländer wie das andere gezeichnet oder irgendein Detail wiederverwendet. Jedes Projekt entstand neu und vollständig anders. Das könnten wir uns heute gar nicht mehr leisten.
Ditschuneit: Später dann, im Stadtbüro mit Stefan Behnisch, wurde diese Haltung nach und nach abgebaut. Da hieß es schließlich doch: »Fangt nicht wieder bei Adam und Eva an, nicht jedes Geländer muss ein Kunstwerk sein.«
Wie kam es schließlich zu Ihrer eigenen Bürogründung? War die Zeit einfach irgendwann reif für die Selbstständigkeit? Oder gab es einen äußeren Anlass?
Burkart: Wir waren alle vier beim Bonn-Projekt dabei und haben nebenbei an Wettbewerben teilgenommen – in der Hoffnung, uns mit einem daraus resultierenden Projekt selbstständig machen zu können. Das Büro Behnisch war so angelegt: Es war immer klar, dass man dort nicht alt wird.
1990 hatten wir bei einem Schulbauwettbewerb in Durmersheim einen zweiten Preis gewonnen und gleichzeitig einen Direktauftrag für ein Gewerbeprojekt in Lutherstadt Eisleben erhalten. Daraufhin marschierten wir zu viert in Behnischs Büro und erklärten, dass wir uns selbstständig machen wollten. Er hat gesehen, dass es uns ernst war und meinte: »Gut, das kann ich verstehen. Aber dass ihr alle gleichzeitig gehen wollt, dazu überlege ich mir noch etwas. Kommt mal in einer Woche wieder.« Er machte uns dann ein sehr gutes Angebot, und so sind wir nacheinander ausgestiegen. Ich persönlich habe das Bundestagsprojekt zu Ende gebracht, d. h. ich bin anderthalb Jahre später ausgeschieden als die anderen.
Wie hat sich die Architektur in Ihrem eigenen Büro dann verändert? Kann man sagen, dass Sie sich von Behnisch entfernt haben, und wenn ja, in welche Richtung?
Burkart: Wir haben uns nicht wirklich von ihm wegentwickelt, v. a. hat sich unsere Arbeit von den Aufgaben her geändert. Wir sind mit bescheidenen Aufträgen eingestiegen und haben uns langsam hochgearbeitet. Das begann mit einer Garage hier, einem Balkonanbau da und mit Messebauten für Daimler. Unsere Architekturhaltung hat sich dabei nicht sehr gewandelt, aber es gab nach und nach neue Einflüsse, etwa die heutigen Bauvorschriften. Dadurch wurde unsere Architektursprache strenger. Aber ich finde, z. B. bei unseren Bädern schaffen wir es immer noch ganz gut, relativ frei zu agieren und offene Räume zu entwerfen.
Ditschuneit: Unsere Architektur hat sich aber nicht nur durch die technischen Zwänge verändert. Wir gehen auch bewusst anders an die Dinge heran, nicht mehr additiv, sondern mehr kubisch, z. B. jüngst in Wien, bei diesen verputzten Badehäusern. Es ist gibt dort noch schiefe Winkel und alles fließt, aber die Bauteile sind nicht mehr so locker gefügt, sondern kompakter, massiver.
Ist denn Behnisch-Architektur heute überhaupt noch zeitgemäß?
Tillmanns: Ich finde, dass unser Bundestag auch heute noch toll dasteht und eine Ikone ist. Aber wenn ich sehe, wie Behnisch seine ersten Schulen gebaut hat, wo die Stahlträger ruppig durchs Glas stoßen: Das kann man heute nicht mehr so machen. Die Bedingungen haben sich ja geändert, die Wärmeschutzverordnung, das ganze Vergabewesen. Mich würde wirklich interessieren, wie Behnisch heute damit umginge. Er hat sich ja schon damals gegen diese Verwaltungsvorgaben aufgelehnt und hat mutig Anderes gemacht.
Die den Rationalisten so wichtige Symbolhaftigkeit von Archetypen ist für Sie nicht von Interesse?
Tillmanns: Mich persönlich hat es immer mehr gereizt, wenn ein Bauwerk nicht wie ein herkömmliches Haus aussieht. Wenn das Gebäude mehr zu sagen hat als ein einsilbiger Archetypus. Wenn man die Nutzungen und Funktionen neu denkt und sich die Dinge anders ausformulieren können als gewohnt.
Nehmen Sie sich Themen vor, gibt es narrative Elemente? Bei Behnisch kam das nie in Frage …
Burkart: Wir entwickeln unsere Entwürfe immer aus dem Ort heraus und gewinnen daraus Motive. Bei der Wiener Therme orientierten wir uns an einem Bachlauf, der sich zwischen Steinen hindurchwindet. In Luxemburg schwebt der Bau topografiebedingt über der Badehalle und die golden eloxierte Fassade bezieht sich auf die Gemarkung »Am Sand« …
Ditschuneit: … und bei der Bodensee-Therme ist es das Schiffsthema, zu sehen am Saunahaus, das mit einer Dachterrasse und einer Reling zum See hin auskragt. In Bad Ems sind die Kieselsteine das Motiv.
Burkart: Wir suchen damit durchaus auch nach Themen, die so ein Projekt marketingmäßig tragen, die sich verkaufen lassen. Denn die Badbetreiber legen heute Wert auf Alleinstellungsmerkmale.
Ist das nicht zwangsläufig mit formalen Spielereien verbunden?
Ditschuneit: Das ist es durchaus, wenn z. B. die Form der Fenster von den Flusskieseln abgeleitet ist.
Matthias Burkart: Die Gebäudehülle folgt heute vielleicht mehr formalen Ideen, aber die Grundrisse zeigen immer noch das Prinzip des von innen nach außen fließenden Raums. Natürlich muss das Sportschwimmerbecken immer rechteckig sein, aber ansonsten gibt es organische Formen, etwa bei den Planschbecken und den Außensaunen.
Sie sagten, Ihre Architektur sei formaler geworden. Wie kann man das verstehen?
Tillmanns: Uns interessiert heute durchaus, wie das Bild des Gebäudes wirkt. Bei Behnisch hat sich alles von innen heraus entwickelt und die Außenansicht ist dann eben wie von selbst entstanden. Wir machen schon noch einmal den Rückgriff auf den Grundriss und betreiben dieses Hin-und-her-Spielen zwischen äußerer Gestalt und Funktion. Aber wenn ich alte Behnisch-Gebäude angucke, dann dreht es mir manchmal den Magen um, wie lässig mitunter Details entstanden sind. Behnisch hat das damals nicht gestört, der fand das gut.
Burkart: Wie bereits gesagt: Formale Aspekte sind auch oft dem Wunsch der Bauherren nach dem Alleinstellungsmerkmal geschuldet. Bei der Erweiterung der Wilhelm-Maybach-Schule in Stuttgart-Bad Cannstatt zum Beispiel wurde die Aufstockung mit einem eigenen Tragwerk über das bestehende Schulgebäude gestülpt. So etwas kann man dann schon abschätzig formale Spielerei nennen, aber wir finden es legitim, denn es handelt sich um eine Ausbildungsstätte für Automobiltechnik. Wenn die Statik für eine normale Aufstockung ausgereicht hätte, wäre es wahrscheinlich weniger interessant gewesen.
Also ist es zutreffend, dass Sie und andere Architekten aus dem Behnisch-Umkreis ihre Architektur verfeinern, delikater und perfekter machen, obwohl Behnisch ja Akkuratesse und Perfektion hasste?
Tillmanns: Das kann man so sagen. Uns interessiert, wie gesagt, das gute Detail und die ortsspezifische Thematik.
Wie sieht es mit dem Einsatz von Farbe aus?
Tillmanns: Wir arbeiten mit kräftigeren Farben, während Behnisch damals mit Christian Kandzia zusammen die Bauteile in Pastelltönen anlegte. Er zerstückelte die Elemente und Zusammenhänge sozusagen durch die Farbgebung und unterteilte ihm zu mächtige Baukörper durch differenzierte Farben in Einheiten kleineren Maßstabs. So etwas machen wir nicht. Bei uns dürfen ein Dach ein Dach, eine Wand eine Wand und ein Fenster ein Fenster sein.
Burkart: Über Farbe wird jedenfalls in unserem Büro heiß diskutiert. In den Anfangstagen gab es relativ wenig Geld und da war Farbe natürlich immer ein Thema, weil man damit auf einfachem Wege viel erreichen kann: Strukturen größer oder kleiner wirken lassen, Stimmungen und Atmosphäre erzeugen usw. Höhepunkt war die Moskauer Therme ELSE-Club, in die wir eine geschwungene Wand, eine Art goldenes Ei gesetzt haben. Wir haben dabei keine goldene Farbe, sondern tatsächlich Blattgold verwendet. Die Reflexionen im Wasser, ein goldenes Schimmern, erzeugt eine besondere Atmosphäre. Von dort war der Schritt zur reinen Materialwirkung nicht weit. Pures Material wird bei uns immer wichtiger.
Wie hätte wohl Behnisch auf das Gold reagiert?
Ditschuneit: Ach, er hätte wahrscheinlich gesagt: »Wenn schon, dann müsst ihr echtes Gold nehmen.«
Burkart: Allerdings würden wir so etwas wie 2007 in Moskau heute nicht mehr machen. Was Farben betrifft, sind wir gerade eher in der Reduktion begriffen.
Ditschuneit: Außer bei den Bädern. Gerade an deren Decken bleibt Farbe etwas ganz Wichtiges. In Wien, wo wir nicht viel Geld zur Verfügung hatten, wollten wir zuerst eine schöne Holzdecke einbauen. Doch dann wurden es farbige Heraklitplatten: Die sind nicht teuer und akustisch vorteilhaft – im Hallenbad enorm wichtig – und die stehen in 300 verschiedenen Farben zur Verfügung. Wir haben Fotos in diesem Plattenformat gepixelt und für jede Halle, für jeden Bereich eine eigene Farbstimmung bekommen, von Frühlingsmotiven bis hin zu Winter- und Eisbildern. Die Wände sind hingegen nur grau oder weiß verputzt oder betonsichtig.
Burkart: … ein atmosphärisches Thema: Naturbilder zu Frühling, Sommer, Herbst und Winter, verpixelt als Abstraktion. Wenn man hindurchgeht, spürt man, wie sich die Bereiche und die Stimmungen ändern. Darin sehe ich auch einen entscheidenden Unterschied zur Behnisch. Der hatte kein Interesse, so ein Thema durchzudeklinieren oder Symbolik einzubringen. Die Farben als Symbol für die Jahreszeiten – einen solchen Transferschritt hätte er nie vollzogen.
Noch eine letzte Frage: Ist mein Eindruck richtig, dass man mit Ihrer Auffassung von Architektur v. a. in Südwestdeutschland erfolgreich ist? Dass das in anderen Gegenden Deutschlands nicht akzeptiert wird, bei Wettbewerben z. B.?
Ditschuneit: Die Erfahrung haben wir gerade jüngst wieder gemacht, bei einem Wettbewerb, wo der Bauherr ausdrücklich unsere »süddeutsche Architektur« nicht wollte.
Burkart: Wir überlegen uns deshalb, mit gleichgesinnten Büros eine Art süddeutsche Allianz zu bilden, um gegen eine Fraktion, die für massive, schwere Architektur steht, zu bestehen. Denn wir haben bei Wettbewerben oder bei Preisgerichten das Gefühl, dass die mehr zusammenhalten als wir und dass wir mit unseren Arbeiten nicht richtig nach vorne kommen. Wir sind diesbezüglich wahrscheinlich, wie generell, ein bisschen zu lässig.
Herr Burkart, Herr Ditschuneit und Herr Tillmanns, vielen Dank für das Gespräch.
db, Mo., 2017.10.02
verknüpfte Zeitschriftendb 2017|10 Stuttgart
![]()