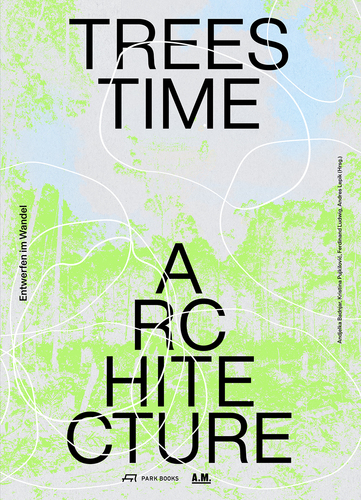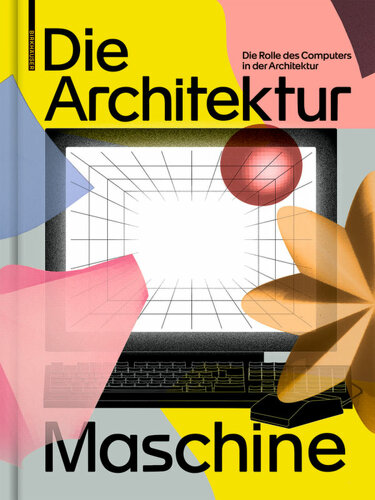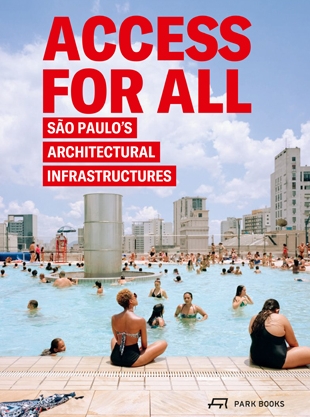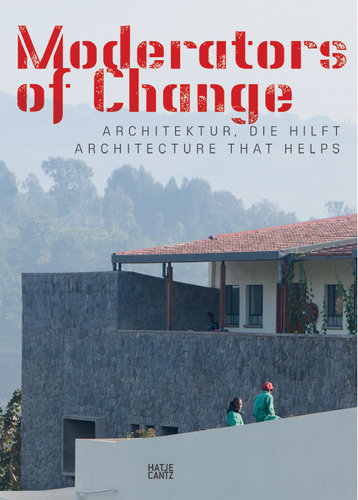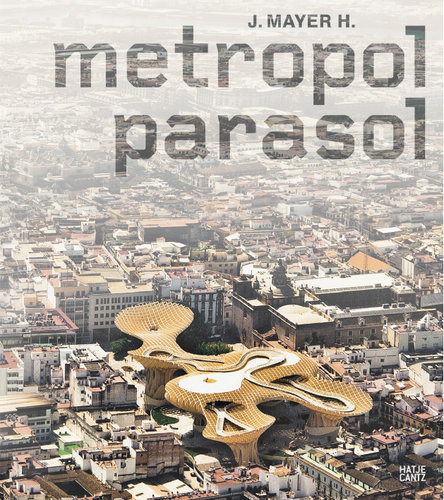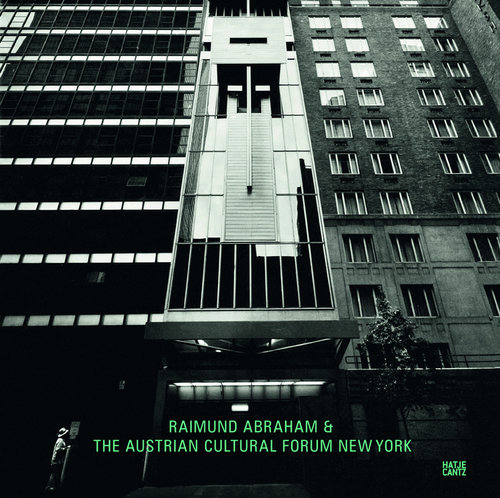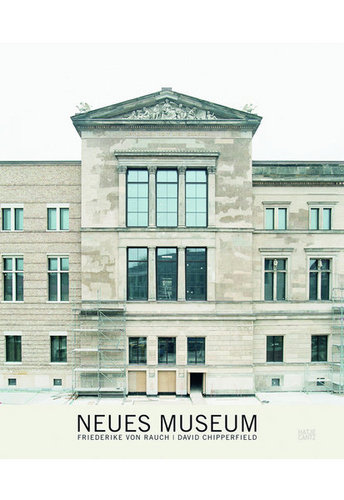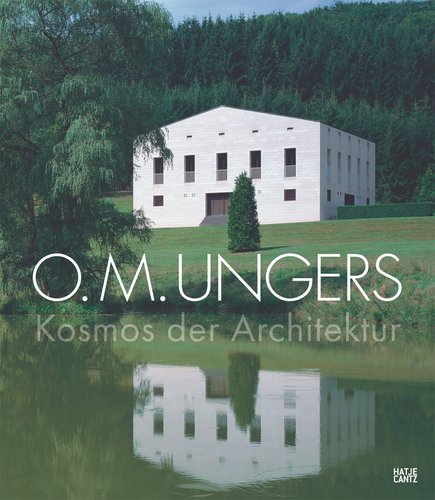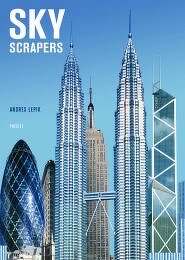Ein Besuch im Atelier von Renzo Piano
Renzo Pianos Atelier «Punta Nave» liegt am westlichsten Rand Genuas, gerade an der Stadtgrenze. An der stillgelegten Kurve einer Küstenstrasse (die Felsnadel wird heute von einem Tunnel durchquert) befindet sich der Eingang. Wo sich zur Seeseite das türkisblaue Meer an den Felsen bricht, gibt es am Fuss des Abhangs ein eisernes Tor. Hat sich die automatische Türe geöffnet, so steht man nach einigen Stufen vor dem gläsernen Unterstand einer Zahnradbahn. Die Auffahrt in der allseits verglasten Kabine ist spektakulär, und man fühlt sich wie James Bond auf der Fahrt in das Büro von Dr. No.
Schon nach wenigen Metern ist der Blick auf die Strasse durch den Knick im Gefälle verschwunden, und die Kabine scheint, direkt aus dem Meer aufgetaucht, in die Höhe zu fahren. Die Fahrt vorbei an einigen Gartenterrassen mit Ölbäumen, Bambus und ozeanischen Skulpturen ist aber schon nach zwei Minuten zu Ende, und man scheint auf diesem Felsvorsprung zwischen Himmel und Meer der Erde völlig entrückt zu sein.
Der Blick in das Studio zeigt eine allseits offene, an den Berg angepasste Raumsituation. Entsprechend den Gartenterrassen stufen sich die Arbeitsebenen in mehreren Treppen den Berg hinab, von einem einfachen Glasdach mit grossen Sonnenblenden überdacht. Die Grenze zwischen aussen und innen ist völlig transparent, das Gebäude duckt sich an den Hang wie ein Gewächshaus. Die Pflanzen im Inneren verstärken diesen Eindruck fehlender Raumgrenzen noch mehr. Überall summen und klingeln Telefone, es herrscht eine fröhliche Unruhe wie im Innern eines Bienenstocks an einem Frühlingstag. Renzo Pianos eigener Arbeitsplatz ist nur als ein wenig vorspringender Bereich in der Mitte der gestuften Anlage zu erkennen. Als einziger Hinweis auf die Auszeichnung seines Platzes gegenüber den anderen mag der Umstand gelten, dass er von seinem Tisch aus ganz direkt und allein auf das Meer hinunterblickt. Sonst gibt es in diesem Büro keinen Hinweis auf eine Hierarchie der Räume.
Offene Atmosphäre
Im jadegrünen Pullover, hellblauen Hemd und einer sandfarbenen Baumwollhose kommt Piano nun selbst, das schmale, beinahe hagere Gesicht wirkt nur durch den grauen Bart etwas voller. Die listigen Augen blitzen, während er uns freudig begrüsst, und nach wenigen Sätzen gibt er zu verstehen, dass er mit «Renzo» angesprochen werden will. Angesichts der heiter-offenen Atmosphäre seines Büros, das er noch immer «Renzo Piano Building Workshop» nennt, scheint dies nur folgerichtig. Es ist nicht die erste Erinnerung daran, dass er in den sechziger Jahren aufwuchs. Vieles, was damals gegen die Konvention autoritärer Systeme gerichtet war, ist nun selbst zu einer - durchaus angenehmen - Tradition geworden.
Ein Rundgang führt über alle Terrassenstufen der Anlage. Durch die Hanglage entsteht trotz aller Grösse und Offenheit keineswegs der Charakter eines Grossraumbüros. Auf jeder Stufe werden unterschiedliche Projekte vorbereitet - nahezu über den ganzen Globus hinweg ist dieses Büro inzwischen tätig. Es gibt zwar auch noch eine Dépendance in Paris, die aber etwas kleiner besetzt ist. Auf der untersten Stufe findet sich die grosse Werkstatt des Modellbauers Dante, eines immerhin 70jährigen Spezialisten, der hier jene handwerklich einzigartigen Modelle herstellt, die untrennbar mit der schrittweisen Entwicklung der Ideen Renzo Pianos verknüpft sind. Von der Skizze über die Zeichnung zum Modell - diese Trias des Entwurfsprozesses seit Brunelleschi findet auch bei Renzo Piano noch immer Anwendung, wobei er eben auch besonderen Wert auf die einfache und dennoch vollkommene Ausführung der Modelle legt. Für Piano sind sie wichtige Arbeitsinstrumente - auch wenn seine Mitarbeiter längst mit CAD arbeiten. Den Ausgangspunkt seiner Planungen bilden immer die eigenhändigen, meist mit grünem Filzstift und eilend hingeworfenen Skizzen, und nach der weiteren Ausformulierung kommt dann stets das Modell.
Von Projekt zu Projekt
Renzo Piano läuft durch sein Büro, von Tisch zu Tisch, von Projekt zu Projekt, den immer wieder erlöschenden Cigarillo in der Hand. In den Gesprächen mit seinen Mitarbeitern ist er humorvoll, er behandelt sie wie Familienangehörige, nachsichtig, aber mit der klaren Erwartung, dass er am Ende als pater familias das letzte Wort behält. Er improvisiert, er skizziert im Gespräch auf kleine Zettel, er doziert - aber keinen Moment lässt er seine Gesprächspartner ganz aus dem Auge, bemerkt jede Unaufmerksamkeit. Hört man einmal nicht hin, so spricht er einen direkt an, mit einem Scherz ruft er zur Aufmerksamkeit zurück. Schnell erkennt er die Eigenheiten seiner Gesprächspartner, wechselt nach Bedarf fliessend vom Italienischen ins Französische oder Englische. Aber die fröhliche Gelassenheit täuscht nicht darüber hinweg, dass er mit höchstem Einsatz arbeitet, plant und koordiniert. Seinen Terminkalender, der noch jeden Aussenpolitiker erblassen liesse, kennt er auswendig.
Renzo Piano liebt die Kunst. Vom Centre Pompidou (dessen Renovierung er nun dreissig Jahre nach der Errichtung betreut) über die Menil Collection bis hin zur Sammlung Beyeler in Riehen ist die Bauaufgabe Museum nicht zufällig ein roter Faden in seinem Œuvre. Gerne erzählt er, mit welchen Künstlern, Schriftstellern und Komponisten ihn persönliche Freundschaften verbinden: Mario Vargas Llosa, Michelangelo Antonioni, Robert Rauschenberg, Luigi Nono. Die Verbindung zwischen seinen architektonischen Projekten und der Kunst sieht er vor allem darin, dass er von den Künstlern lerne, die Überraschung, das Risiko in jedem Projekt wieder aufs neue zu suchen. Piano hat keine fest umrissene Theorie, aber man vermisst sie auch nicht bei ihm - er lebt, denkt und arbeitet ganz aus der Praxis des Bauens heraus, aus dem Gespräch und der grossen Neugier.
Es ist Mittagspause - die Mitarbeiter seines Büros versammeln sich in der Gemeinschaftsküche und auf der Terrasse mit dem stupenden Meeresblick. Piano setzt sich mit seinen Gästen an einen eigenen Tisch. Eine Stunde Unterbrechung gehört zum festen Tagesrhythmus, wenn er in Genua ist. Eine kühle Flasche Gavi di Gavi darf hier nicht fehlen und noch weniger die Focaccia, die Genueser Pizza bianca, die als Weissbrot zum Essen gereicht wird. Da ist auch Insalata Caprese mit dem piemontesischen Basilikum und als Dessert Melone und Crostata. Die Heiterkeit des gemeinsamen Arbeitens wird hier auf einfachste und doch gleichermassen qualitätsvollste Weise fortgesetzt. Beim Photographiertwerden lacht Piano und meint, dass wir die Abbildung nur machten, um der Öffentlichkeit zu beweisen, dass sein Büro in Wirklichkeit ein Restaurant sei, in dem er und seine Mitarbeiter nichts anderes tun als den ganzen Tag essen. Wenn es so wäre - wir würden gerne öfter dabeisein.
Neue Zürcher Zeitung, Sa., 1999.08.28
verknüpfte AkteurePiano Renzo
![]()