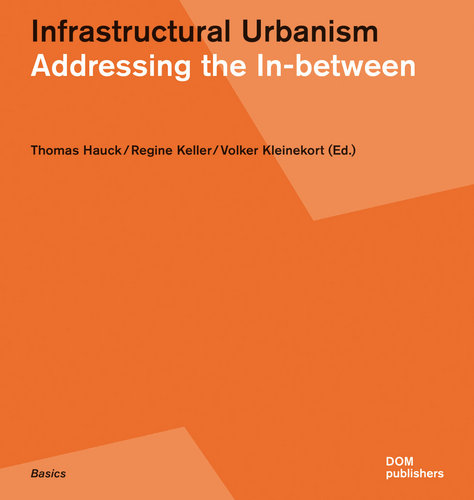Neuer Städtebau
»Neuer Städtebau« ließe sich als Forderung verstehen, als Wunsch nach neuen Ansätzen. Aber was kommt nach der funktionsgetrennten Stadt und der Wiederentdeckung...
»Neuer Städtebau« ließe sich als Forderung verstehen, als Wunsch nach neuen Ansätzen. Aber was kommt nach der funktionsgetrennten Stadt und der Wiederentdeckung...
»Neuer Städtebau« ließe sich als Forderung verstehen, als Wunsch nach neuen Ansätzen. Aber was kommt nach der funktionsgetrennten Stadt und der Wiederentdeckung des Ideals der europäischen Stadt? Die auf der Ebene wissenschaftlicher Forschung durchgeführten Perspektiven Zwischenstadt und Shrinking Cities sind bestenfalls Analysen, haben aber von der wesentlichen Frage nur abgelenkt: In welchem Sinne sollen wir Stadt bauen?
Die heutigen Voraussetzungen auf dem Feld der Stadtplanung erfordern ein Umdenken in der Gestalt der Entwicklungsperspektive. Die bisher zumeist auf Leitbildern basierenden Entwürfe erfahren große Probleme in der Prozessualität ihrer Umsetzung. Mehr denn je gilt es die Organizität dessen anzuerkennen, was man als Stadt zu bezeichnen gewohnt ist. Die Forderung schließt an den Begriff der Stadtlandschaft an, ohne sich in dessen Bildhaftigkeit zu verfangen. Dabei sind es gerade die realen Bilder der Städte, die uns die Begrenztheit von Planung und damit die Begrenztheit des Menschen überhaupt vor Augen führen. Das Erreichen einer Grenze ist eine schwierige wie wertvolle Erfahrung, schließlich verdeutlicht die Grenze sowohl die kulturelle Relevanz, als auch das kulturelle Potential von Planung. Das größte Problem, das sich den Beteiligten in dieser Situation stellt, liegt in der Antizipation, die unweigerlich mit der Planung verbunden ist. Jeder Entwurf hat ein Verfallsdatum, wobei sich gute Entwürfe durch ein möglichst geringes Maß an Antizipation und damit durch eine längere Haltbarkeit auszeichnen.
Städtebauliche Entwürfe werden wesentlich durch wirtschaftliche und politische Faktoren beeinflusst. Städtebau ist im Gegensatz zur Architektur grundsätzlich politisch. Das Recht auf Freiheit nimmt in den westlichen Demokratien einen vergleichsweise hohen Stellenwert ein. So liegt das politisch Verhandelbare stets nahe am kleinsten gemeinsamen Nenner der zur Entscheidung berechtigten Öffentlichkeit. Dieser Schwachpunkt im System Demokratie ist letztlich der Grund für den Erfolg immer größerer geschlossener Systeme, wie beispielhaft der Gated Communities und Shopping Malls, die eigentlich nichts anderes tun, als die aus dem Freiheitsanspruch des Einzelnen resultierenden Störfaktoren zu minimieren. Vom Erfolg dieser Systeme zu lernen, ohne deren fatale Entwicklung fortzusetzen, ist einer der Ansprüche, die hier formuliert werden sollen.
Die meisten städtebaulichen Konzepte der Vergangenheit zerbrachen an dem in der Planung ignorierten Faktor Zeit. Die stetig wechselnden Parameter von Stadt führen dazu, dass selbst neu entwickelte Bildversprechen nicht eingelöst werden können. Begreift man das Geflecht heutiger Stadtagglomerationen ein Stück mehr als Organismus, geraten Eingriffe zu Implantationen. Städtebau bezeichnet zwar eine durch Verfasstheit bestimmte Form von Stadt, doch handelt es sich in der Regel um überschaubare Einheiten, die bereits bestehende Siedlungsgefüge ergänzen. Städtebau entwerfen heißt somit, den Ausschnitt eines größeren Ganzen zu entwerfen, das selbst nicht mehr die Stadt, sondern ein sich stets entwickelndes polyzentrisches Netz von Siedlungsstrukturen ist. Eine wesentliche Qualität städtebaulicher Entwürfe misst sich in ihrem Verhältnis zu diesem größeren Ganzen, nicht nur als baulicher, sondern auch als gesellschaftlicher, sozialer, und ökonomischer Kontext. Die zwei diametral entgegen gesetzten Möglichkeiten der Stellungnahme dazu lauten Autonomie oder Kontextualität. Das Erste bedeutet Isolation, das Zweite Vernetzung. Als Extreme sind sie ebenso unbrauchbar wie uninteressant. Gute städtebauliche Entwürfe sind wie gute Implantate, formal und infrastrukturell gleichzeitig autonom und vernetzt, möglichst natürlich – künstlich. Allgemeine Wachstums- und Schrumpfungsprozesse spielen ebenso eine Rolle wie die aktuellen Anforderungen der Immobilienwirtschaft und sollten bei der Planung berücksichtigt werden. Die vierte Dimension der Stadt muss bei ihrer Konstitution mit entworfen werden.
So ist für den neuen Städtebau eine strategische Methode zu entwickeln, die den immer und nie fertigen Zustand der Stadt nicht nur akzeptiert, sondern voraussetzt. Es geht darum, Möglichkeitsräume zu schaffen, die sich einer endgültigen Form verweigern. Die Wiederentdeckung des Ideals der europäischen Stadt ergoss sich in postmodernen Bilderwelten. Rem Koolhaas kritisierte sie als eine »Welt ohne Urbanismus (...) nur noch Architektur«. Dem lässt sich die »unfertige Stadt« gegenüber stellen. Eine Stadt die nicht das eine Bild annimmt, die konträr dazu Brüche und Ungereimtheiten nicht nur akzeptiert sondern gerade fordert und mit entwirft - die räumliche »Gelegenheit« steht vor der ästhetischen Präfabrikation.
Zum besseren Verständnis könnte eine Analogie zum Begriff der »konglomeraten Ordnung« von Alison und Peter Smithson helfen. Sie schrieben der konglomeraten Ordnung die Eigenschaft zu, sich schwerlich im Gedächtnis zu verankern, »nur wenn man wirklich dort ist, dann scheint alles ganz einfach«. Durch diese Komplexität bildet sich eine räumliche Präsenz von Stadt, die über die Präsenz des Objektes hinausgeht. So gesehen sollte es auch ein Mittel des Städtebaus sein, Komplexität, Differenz und Heterogenität zu betonen, Brüche und Zweckentfremdung zu ermöglichen. Ausgehend von diesem Verständnis sehen wir städtebauliche Projekte als eine Mischung aus Prozess und Produkt, aus Verfahren und Gestalt. Der Willen zur Form und der Hang zum Verfahren, um die Tendenzen der beiden Professionen Architektur und Stadtplanung zu nennen, gilt es immer wieder neu zu verhandeln. Dies aber nicht nur auf der strukturellen Ebene aller Handlungsbeteiligter, der Raum selbst muss dieser Justierung folgen. Das Ziel ist eine urbane Kontingenz - eine Sichtweise, in der nicht Architektur und Städtebau zwei Bereiche sind, Objekt und Kontext bedingen sich hier vielmehr wechselseitig.
Wenn eingangs der Wunsch nach dem Mitentwerfen der vierten Dimension erwähnt wird, so will das nichts weniger, als mit der beschriebenen Wechselseitigkeit alle Eventualitäten aufzunehmen. Der Raum ist eine Form des Nebeneinanders, die Zeit dagegen eine Form des Nacheinanders. Diese Widersprüchlichkeit ist zu vereinen in einem »StadtRaum« der Gleichzeitigkeiten. Die geforderte vierte Dimension, also die Zeit als strategische Komponente im Entwurf, meint aber gerade nicht die gewohnte Sichtweise auf ökonomisch technisch bedingte Baufolgen und Baustufen. Vielmehr ist es von entscheidender Bedeutung, einen flexiblen Plan zu denken und zu entwerfen – flexibel in seinen unterschiedlich möglichen Entwicklungsstufen und seinem »Endzustand«. Bei der Entwicklung eines städtischen Areals können sich die Parameter im Laufe der Phasen ändern, hier darf der Planungsstand nicht nur mehr reagieren, sondern die Planung sollte so strategisch konzipiert sein, dass diese Eventualitäten bereits als Szenarien implementiert sind. Das Ganze ist wie die beweglich flexible Masse eines Gummibandes zu sehen, welches zwar in Material und Struktur kontinuierlich ist, dessen Form aber auf unterschiedlichste Einflüsse von innen und außen reagieren kann und das in jeder erdenklichen Form einen Zusammenschluss leistet.
Aus der geschilderten Sichtweise kommen wir wieder zu dem eingangs erwähnten Aspekt der Voraussetzungen. Bestand und Programm stehen in einer unmittelbaren Wechselbeziehung. Wir unterscheiden uns grundlegend von dem »Neuen« in der Moderne, denn dieses Neue ist nicht mehr anzutreffen. Da es den geschichtslosen Ort in unserer Kulturlandschaft nicht gibt, ist Bauen heute immer Umbauen. So wird die Formulierung der Aufgabenstellung ein zunehmend bedeutender Teil der Arbeit von Architekten sein. Es gilt bereits die Nutzungs- und Programmdefinition eines Ortes als Teil des Entwurfes strategisch mitzugestalten.
Architektur + Wettbewerbe, Fr., 2008.12.19
verknüpfte Zeitschriften
Architektur + Wettbewerbe 216 Neuer Städtebau