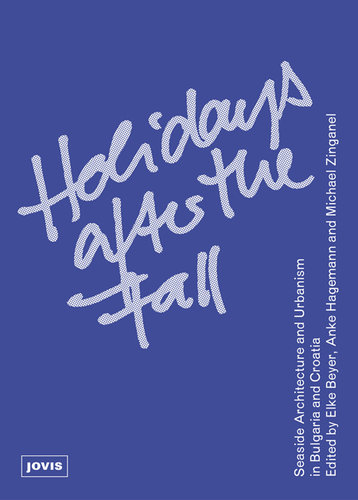Drehkreuz
Das Drehkreuz (englisch turnstile) hat seinen Vorläufer in Durchgängen von Weidezäunen: Der Begriff Stile bezeichnet eine Stiege, mit der Menschen die...
Das Drehkreuz (englisch turnstile) hat seinen Vorläufer in Durchgängen von Weidezäunen: Der Begriff Stile bezeichnet eine Stiege, mit der Menschen die...
Das Drehkreuz (englisch turnstile) hat seinen Vorläufer in Durchgängen von Weidezäunen: Der Begriff Stile bezeichnet eine Stiege, mit der Menschen die Zäune oder Mauern von Viehweiden übersteigen können.
Drehkreuze bestehen in der Regel aus einem Metallgestänge mit vier Flügeln, die um eine senkrechte Achse kreisen. Die platzsparende Variante, bei der sich drei Arme um einen schräg gestellten Drehpunkt bewegen, wird auch als Drehsperre bezeichnet. Drehkreuze werden in Eingangs- und Durchgangsräumen als Mittel der Zutrittskontrolle verwendet und erfüllen dabei unterschiedliche Funktionen: Bei Massenandrängen regulieren sie den Fußgängerfluss durch eine Vereinzelung der Personen, die nur nacheinander ein Drehkreuz passieren können. Wie ein Ventil können Drehkreuze mit Hilfe eines Sperrmechanismus die Durchgangsrichtung festlegen.
Darüber hinaus können eingebaute Zähler die Anzahl der Durchgänge festhalten. Ihre Passierbarkeit kann von einem/r PförtnerIn sowie automatisch – durch Münzeinwurf, Ticketscanner oder maschinelle Identifizierung – gesteuert werden. Der Mechanismus des Drehkreuzes automatisiert also den Übertritt räumlicher Grenzen; er ist der physische Erfüllungsgehilfe für die Disziplinierung, Kontrolle und Selektion der Personen, die diese Grenzen überschreiten. Die wichtigsten Anwendungsbereiche des Drehkreuzes sind stark frequentierte oder regulierte Räume wie Sportstadien, Bahnhöfe, öffentliche Verkehrsmittel und Supermärkte oder Büro- und Gewerbebauten mit eingeschränkter Zugänglichkeit.
Im 19. Jahrhundert verbreitet sich das Drehkreuz zunächst in Parks, Zoos, an Piers und Sportstätten. Mit dem Aufkommen des Massensports erlebt es dann gegen Ende des Jahrhunderts einen starken Aufschwung, da es die Besucherströme reguliert und die effiziente Einnahme von Eintritt gewährleistet. 1895 meldet der Engländer Samuel Alfred Nelson Deluce ein Patent über das „Rush Preventive Turnstile“ an, das die Firma WT Ellison aus Salford, Manchester, in den folgenden Jahrzehnten in hoher Stückzahl produzieren wird. Ellison’s Drehkreuz verfügt über ein Fußpedal, mit dem die KassiererInnen das Drehkreuz steuern können, um nur zahlenden BesucherInnen den Durchgang zu gewähren. Ein verplombter Zähler kontrolliert wiederum den/die KassiererIn und verhindert, dass dieser Gäste umsonst auf das Gelände lässt.
Im Lauf des 20. Jahrhunderts wird die Funktionsweise des Drehkreuzes durch zahlreiche technische Entwicklungen verbessert, ergänzt und an unterschiedliche Anwendungsbereiche angepasst. So spielt das Drehkreuz beim Siegeszug des Supermarkts eine wichtige Rolle: Am Eingang bestimmt es die Bewegungsrichtung der Kunden und gewährleistet, dass der Verkaufsraum nur durch die Kassenschleuse verlassen werden kann. Schon im ersten Supermarkt, dem Piggly Wiggly Store, der 1916 in Memphis eröffnet, sind Drehkreuze am Eingang installiert. In öffentlichen Verkehrsmitteln wird durch Drehkreuze die Zahlung und Kontrolle der Fahrscheine automatisiert. Bereits 1911 sollen verbesserte Drehkreuzmechanismen in amerikanischen Personenzügen eine „Pay-as-you-enter“-Funktion ermöglichen und damit nachlässige KondukteurInnen ersetzen. Die U-Bahnen von New York, London oder Paris werden durch die Installation von Drehkreuzen an Ein- und Ausgängen zu geschlossenen Systemen gemacht. So kommen in New York ab 1920 automatisierte Drehkreuze zum Einsatz, in die die Fahrgäste Fünf-Cent-Münzen, später durch tokens abgelöst, einwerfen müssen. Seit den 1990er Jahren werden viele der Einwurf- und Ticketsysteme durch wiederaufladbare oder zeitbasierte smart cards ersetzt, die auf der Basis von Magnetstreifen (Metrocard, New York) oder RFID (Oyster Card, London) funktionieren und am Ende einer Fahrt den jeweiligen Fahrpreis automatisch abbuchen.
Einer der wichtigsten Einsatzbereiche für Drehkreuze sind nach wie vor Sportstadien. Viele der großen Fußballarenen sind in den letzten 10 bis 15 Jahren auf Drehkreuze mit elektronischen Zugangskontrollsystemen umgerüstet worden. Zur Speicherung und Weitergabe der Informationen auf den Tickets kommen dabei Techniken wie Magnetstreifen, Strichcodes oder RFID zur Anwendung, die von Scannern oder Lesegeräten am Drehkreuz ausgelesen werden. Die automatisierte Ticketkontrolle reduziert nicht nur den Personalbedarf, sondern ermöglicht es auch, zusätzliche Funktionen an den Einlassprozess zu knüpfen. Zum Beispiel können Anzahl, Ort und Zeitpunkt der Durchgänge zentral registriert und ausgewertet werden, was das Crowd Management im Stadion erleichtert. Häufig dient die Eintrittskarte gleichzeitig als bargeldloses Zahlungssystem für Parkscheine, Speisen, Getränke oder Fanartikel. So wirbt das Berner Stade de Suisse mit einer Swatch-Armbanduhr als wiederaufladbarem „tickenden Ticket“ für „Zier, Zeit, Zutritt, Zahlen“. Dies optimiert zwar die Abläufe im Stadion, macht aber gleichzeitig das Konsumverhalten der BesucherInnen für den Betreiber transparent.
Um potenzielle UnruhestifterInnen aussondern zu können, wird es darüber hinaus zunehmend zum Ziel der Sicherheitsverantwortlichen, die StadionbesucherInnen zu personalisieren. So waren etwa die Tickets der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 mit individuellen RFID-Tags versehen, mit denen die persönlichen Kundendaten der TickethalterInnen aufgerufen werden konnten. Die RFID-Funktechnik zur berührungslosen Auslesung der Tickets wurde von dem österreichischen Drehkreuzhersteller SkiData zunächst für Skilifte eingesetzt, um das lästige Hervorkramen der Skipässe zu vermeiden. Diese Technik ermöglicht aber auch eine unbemerkte Auslesung des Tickets jenseits der Drehkreuze: Mit entsprechend verteilten Lesegeräten ist es technisch möglich, Aufenthaltsorte und Bewegungsprofile der TickethalterInnen zu ermitteln. Zur tatsächlichen Identifizierung der BesucherInnen werden in Stadien sogar bereits biometrische Systeme getestet.
Während sich die mechanische Funktionsweise des Drehkreuzes über mehr als hundert Jahre hinweg kaum verändert hat, werden die Steuerungssysteme des Drehkreuzes technisch immer ausgefeilter. Der Prozess der Zugangskontrolle und Identifizierung wird zunehmend automatisiert und durch Funktionen ergänzt, die einen immer größeren Wirkungsradius haben. Trotz einer Etablierung flächendeckender Überwachungstechnologien wird also die Bedeutung von physischen Grenzen und Kontrollpunkten nicht aufgehoben: das Drehkreuz spielt als regulierbarer Filtermechanismus weiterhin eine wichtige, wenn nicht sogar wachsende Rolle.
[Anke Hagemann, „Filter, Ventile und Schleusen. Die Architektur der Zugangsregulierung“, in: Volker Eick/Jens Sambale/Eric Töpfer (Hg.), Kontrollierte Urbanität. Zur Neoliberalisierung städtischer Sicherheitspolitik, Bielefeld 2007, S. 301-328.
Simon Inglis, „Turnstiles“, in: ders., Played in Manchester, London 2004, S. 64-69.
Stefan Nixdorf, „Die Komposition von Stadien. Zwischen Multifunktion und Rückbau“, in: Detail 9 (2005).]
ARCH+, Mi., 2009.03.25
verknüpfte Zeitschriften
ARCH+ 191/192 Schwellenatlas