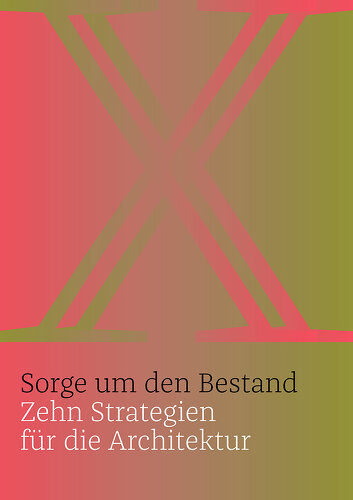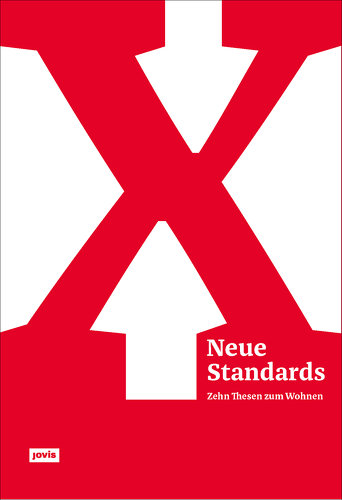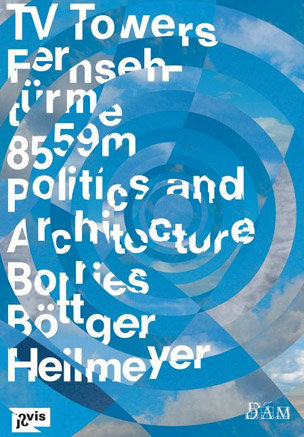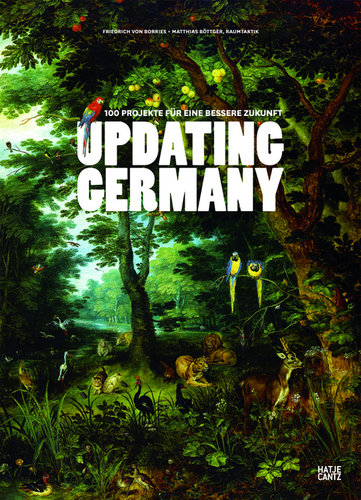Content Unfinished
„Unfinish!“ Ein Wort, das im Englischen ebenso wenig existiert wie im Deutschen (unbeende!), bildete das Motto der 20. Transmediale, die am ersten Februarwochenende...
„Unfinish!“ Ein Wort, das im Englischen ebenso wenig existiert wie im Deutschen (unbeende!), bildete das Motto der 20. Transmediale, die am ersten Februarwochenende...
„Unfinish!“ Ein Wort, das im Englischen ebenso wenig existiert wie im Deutschen (unbeende!), bildete das Motto der 20. Transmediale, die am ersten Februarwochenende in der Berliner Akademie der Künste stattfand. In 20 Jahren hat sich die Veranstaltung von einem „Videofest“ zu einem bedeutenden, mittlerweile von der Kulturstiftung des Bundes als „Leuchtturm“ geförderten Medienkunstfestival gewandelt. Heute sind elektronische Medien in der Kunst- und Alltagswelt längst selbstverständlich, und so suchten die Macher der Transmediale nach einer Öffnung des Diskurses, verbanden Klassik mit Avantgarde – und Analog mit Digital. Eine solche Rückkopplung wurde im Ausstellungsteil der Transmediale sehr schön von Aram Bartholls „Random Screen“ illustriert. Der in Apple-Ästhetik aufblinkende 5x5 Pixel Screen sieht aus wie eine digitale Lava-Lampe, entpuppt sich aber von der Rückseite betrachtet als rustikale Konstruktion aus Teelichtern und modifizierten Bierdosen, die sich in der erhitzten Luft drehen.
Ähnliche Rücktransfers präsentierte Bartholl auch auf dem „Salongespräch“ zum Trendthema „Second Life“. In das Foto einer Straßenflucht hat er einen merkwürdigen Baum montiert, es ist ein digitaler Baum im Augenblick des Downloads. Noch sind nicht alle Daten angekommen, er besteht nur aus zwei sich kreuzenden Flächen, die auf dem Bildschirm in den nächsten Sekunden mit Bildern eines echten Baums gefüllt werden. Hier aber bleibt dieser Baum als Skulptur eingefroren, „unfinished“, im Straßenraum stehen und lässt Parallelen und Differenzen von „erstem“ und „zweitem Leben“ hervortreten. „Second Life“ ist eine Online-Parallel-Welt, geschaffen nach dem Vorbild des Metavers aus Neal Stephensons Roman SnowCrash. Derzeit erlebt sie eine im Verhältnis zu ihrer Population völlig überzogene Medienaufmerksamkeit. Realistisch gesehen treffen sich dort Teenager im Körper des anderen Geschlechts, um ihren Identitätskonflikt auszuleben und um über Sex zu reden. Spannend an „Second Life“ aber ist die Versprechung eines zweiten, eines virtuellen Raums, in dem sich eine eigene Ökonomie entfalten könnte – und auch eine eigene Ästhetik, Kunst und Architektur. Da dieses neue Phänomen in unglaublich kurzer Zeit in die Öffentlichkeit katapultiert wurde, fehlt es an einem fundierten Diskurs und etablierten Inhalten. Das Potential dieser gestalterisch momentan zwischen Las Vegas und Suburbia verorteten Räume gerade für die Architektur ist aber unverkennbar und wird zunehmend an Hochschulen behandelt.
Auch auf dem zweiten Salongespräch über „Urban Screens“ ging es um die Produktion von Inhalten, dabei wurde die Bandbreite von städtischen Medienwänden und -fassaden dargestellt. Mike Gibbons stellte seine für die BBC in verschiedenen britischen Städten installierten „Big Screens“ vor, die er als Teil einer Innenstadtbelebung versteht. BBC-Screens sind werbefreie Massenfernseher, vor denen sich – ganz im Gegensatz zum allgemeinen Trend der Privatisierung öffentlicher Räume – Zuschauer versammeln und gemeinsam an Großveranstaltungen teilnehmen können. Ergänzend werden auch lokale Ereignisse und Kulturproduktionen verbreitet, um die Interaktion mit den Zuschauern zu stimulieren. Stadt(re)vitalisierung wird in Zukunft also wohl auch mit diesen Mitteln betrieben.
Der Architekt Tim Edler präsentierte die neuesten Projekte seines Büros realities:united, die suggerieren, dass Medienarchitektur gerade erst am Anfang steht. Ganze Häuser könnten zukünftig zu Skulpturen werden und ihre Fassaden zu Bildschirmen, die man nur noch aus dem Flugzeug entziffern kann; Häuser werden temporär mit Marken und Images „aufgeladen“; die Hochhaussilhouette einer Stadt wird nachts zu einem tanzenden Ballett, das diese Machtarchitektur destabilisiert. Die Gefahr dabei ist, dass diese Art Fassaden bei zunehmender Verbreitung zu einer Vereinheitlichung im Sinne einer „generischen Universalfassade“ führen – Leuchtreklamen im ganz großen Stil. Für die mögliche Zukunft der Stadt zeigte die Transmediale in jedem Fall eine Reihe Anknüpfungspunkte. Und ein „unfinish“ kann man der Stadt, vor allem in Berlin, ohnehin nur wünschen.
Bauwelt, Fr., 2007.03.09
verknüpfte Zeitschriften
Bauwelt 2007|11 Das Khandama-Projekt