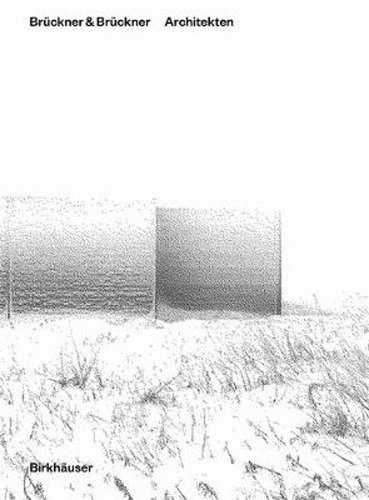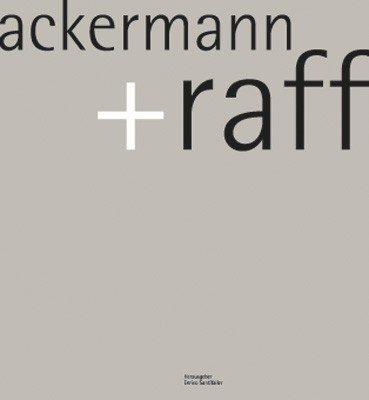Die Goethe-Universität gibt ältere Liegenschaften auf und konzentriert sich auf das ehemals von den amerikanischen Streitkräften genutzte Gelände am I.G.-Farben-Haus. Einem städtebaulichen Masterplan folgend entstand auf dem neuen Campus Westend ein an städtische Blockstrukturen angelehntes Ensemble in Naturstein, das sich gleichermaßen selbstbezogen wie auch offen für außerakademische Aneignung erweist.
Die Goethe-Universität gibt ältere Liegenschaften auf und konzentriert sich auf das ehemals von den amerikanischen Streitkräften genutzte Gelände am I.G.-Farben-Haus. Einem städtebaulichen Masterplan folgend entstand auf dem neuen Campus Westend ein an städtische Blockstrukturen angelehntes Ensemble in Naturstein, das sich gleichermaßen selbstbezogen wie auch offen für außerakademische Aneignung erweist.
Am Wochenende ist der zentrale Platz des Campus Westend fest in Kinderhand. Alles rollt und kreischt – es ist ein Heidenspaß. Im Hörsaalgebäude, das mit der Mensa den Platz säumt, ist die Cafeteria auch sonntags geöffnet. Heiße Schokoladen und dampfende Kaffeebecher werden zu den Gartentischen herausgetragen. Obwohl teilweise von grünem Maschendrahtzaun umgeben, wird das parkartige Areal der Johann Wolfgang Goethe-Universität als weitere Grünfläche, als Fortführung des westlich angrenzenden Grüneburgparks wahrgenommen und genutzt. Dabei – da mehrere Fachbibliotheken auch am Wochenende in Betrieb sind – mischen sich Studierende mit Kindern, Eltern mit Passanten und Radfahrern. Auf dem Campus Westend gibt das multikulturelle Frankfurt auch im recht kalten Spätwinter ein friedliches Bild ab.
Im Sommer 2001 bezogen die Kulturwissenschaften die ehemalige, nach Plänen von Dissing+Weitling (Kopenhagen) renovierte Konzernzentrale der IG Farben im Norden des Westends. Der aus der Feder von Hans Poelzig stammende, mit Cannstatter Travertin bekleidete Stahl-Bau, der zwischenzeitlich als Headquarter der US Army in Europa diente, ist heute noch so eindrucksvoll wie damals. Den 2002 ausgelobten städtebaulichen Wettbewerb für einen Uni-Campus nördlich des Poelzig-Baus mit insgesamt 39 ha gewann Ferdinand Heide. Der großen städtebaulichen Qualität des Entwurfs halber sowie wegen der zukunftsfähigen »Hochschultypologie« und der »genügenden Entwicklungschancen«. Mit 15 Jahren Abstand ist Heides Vision eines urbanen Campus, der die Qualitäten des Bestands aufnimmt und weiterführt, im Wesentlichen aufgegangen.
Gerade die beiden Grünspangen, die zusammen mit dem »zentralen Band« das Areal durchziehen, geben ihm Großzügigkeit und eine angenehme Weite. Sein Entwurf, den das Frankfurter Stadtparlament 2006 als rechtsgültigen Bebauungsplan beschloss, wird auch in der stets misstrauischen Frankfurter Architektenschaft als der beste aller Wettbewerbsteilnehmer beurteilt.
Varianten der Strenge
Anders dagegen die in der Nachfolge, stets nach RPW-Wettbewerben (Richtlinie für Planungswettbewerbe) entstandenen Uni-Gebäude, die sich – so wollte das jede Auslobung – am Poelzig-Bau orientieren sollten (s. Liste zum Lageplan auf der linken Seite). Insgesamt wurden 185 000 m² BGF neu gebaut und etwa 480 Mio. Euro (2600 Euro/m²) ausgegeben. Nicht darin eingeschlossen ist das Wohnheim beider christlichen Konfessionen mit Apartments für etwa 425 Studierende (Architekten: Karl + Probst, München).
Für all diese Uni-Bauten fällt das Urteil, je nach architektonischer Provenienz des Beurteilenden, anders aus. Für die, die an der TU Darmstadt studierten – und davon gibt es im nahen Frankfurt viele –, haben die Berliner »Schlagschattenfuzzis« die Mainmetropole erobert. Von denen, die anderswo, etwa in Dortmund oder gar in Berlin studierten, hört man naturgemäß andere Ansichten. Dass sich bis auf das Wohnheim stets Berliner Architekten – Heide hat an der TU Darmstadt und an der UdK Berlin studiert – durchsetzten, erklärt das Hessische Wissenschaftsministerium als Wettbewerbsauslober mit »Zufall«. Dessen ungeachtet: Ob des steinernen Fassadenmaterials, v. a. ob der alles robust integrierenden Gartenlandschaft ist zweifellos ein städtebaulicher Zusammenhang entstanden, der sich unschwer als Campus identifizieren lässt, der auch durchweg von besserer Qualität ist als vieles, was in Frankfurt in den vergangenen Jahren entstanden ist. Der neben dem Studieren auch zum Verweilen, Kaffee-Trinken, Spazieren oder sogar zum Spielen einlädt. Und es scheint auch so, dass dies den Studierenden bewusst ist: Es lässt sich auf den Natursteinfassaden kein einziges Graffito entdecken.
Freilich: Über einige inhaltliche Widersprüche kann man durchaus schmunzeln. Denn die Gebäude nehmen keinerlei Beziehung, keinerlei Verbindungen zu ihren Nachbarbauten auf – trotz im B-Plan vorgegebener Raumkanten, Höhen, Dimensionen, trotz der Natursteinfassaden, trotz »Orientierung« an Poelzig. Der ach so kontextsensitive, vom städtischen Straßenraum gedachte Berliner Neorationalismus bleibt in der durchgrünten Stadtlandschaft des Campus Westend auf Einzelstatements beschränkt. Er kann, wenn kein städtischer Kontext da ist – und das Uni-Gelände liegt relativ isoliert –, offensichtlich selbst wenig Kontext aufbauen. Heide hatte gedacht, über die Nutzung Beziehungen herzustellen: Über die Bibliotheken für insgesamt knapp 1 500 Studierende, die sich in den Sockelgeschossen des RuW- und des PEG-Gebäudes befinden. Die sollten offen sein und sich zum Campus orientieren. Doch Müller Reimann bauten zwei introvertierte, jeweils um einen grünen Innenhof liegende Büchereien. Auch die dritte Bibliothek – im Fachcluster für Sprach- und Kunstwissenschaften, der von 2018 an nach Plänen von BLK2 Architekten im Nordosten des Uni-Areals gebaut werden soll – orientiert sich mit ihren 350 Studentenarbeitsplätzen nach innen.
Darüber hinaus ist der Einwand berechtigt, dass die Kollegen aus der Hauptstadt Poelzig allzu eng, allzu klassizistisch interpretierten. Es braucht nicht viel, um beim I.G.-Farben-Haus bei allem Willen zur strengen Form einen furiosen Formen- und Anspielungsreichtum in Detail zu entdecken, der die Monumentalität des Baus immer wieder unterläuft. Erst die Verschränkung beider Ebenen macht seine eigentliche Qualität, seine Kraft aus. Von dieser Synthese ist bei den Berlinern wenig zu sehen – obwohl die Bauten durchweg in hoher handwerklicher Qualität, teilweise sogar hervorragend ausgeführt sind. Kleihues, dem Drittmittel zur Verfügung standen, zitiert in seinem »House of Finance« das Vestibül des Poelzig-Baus, glänzt mit verschiedenfarbigen Marmorböden und drei Seminarräumen, die dem britischen Oberhaus entlehnt sind. Das Haus, das in exklusiver Clubatmosphäre der Begegnung von Finanzwirtschaft, Forschung und Politik dienen soll, ist gesammelter Ausdruck der Distinktionsbedürfnisse, die die Finanzelite hegt – inklusive derer, die dazugehören wollen.
Müller Reimann bauten jeweils viergeschossige Baukörper, die sich über einen zweigeschossigen Sockel erheben. Sie punkten mit Flächeneffizienz und schönen Details – etwa im PEG-Gebäude eine Wand mit handgestocktem, mit ockerfarbenen Zuschlagstoffen versehenem Sichtbeton, umrahmt von ebensolchem, aber geschliffenem. Auch Volker Staab hat drei über ein Sockelgeschoss sich erhebende Baukörper geplant: Einer davon, mit Apartments für Gastwissenschaftler, ist einnehmend charmant geraten, die beiden anderen nur bedingt. Und die Fassade zur Hansaallee mit ihren Schießscharten – querliegende, vom Bücherregal ausgesparte Fenster für eine weitere Bibliothek – ist, mit Verlaub, hässlich und in ihrer fast hermetischen Abgeschlossenheit ein Affront gegenüber Passanten und Betrachtern.
Bei Gesine Weinmillers stocksteifem Quader lässt sich maliziös vermuten, die Architektin habe die »normativen Ordnungen« allzu wörtlich genommen, obwohl sie für ihre Verhältnisse mit L-förmigen Naturstein-Formaten geradezu spielt und feine Schattenwürfe auf die profilierte Fassade zeichnet.
Der Verweis auf die Bauaufgabe kann die ob ihrer gehobenen Rasteristis gescholtenen Kollegen entlasten: Schließlich ist Universitätsbau Bürobau. Weil sich auch der universitäre Mittelbau geschlossen für Einzelbüros aussprach, blieb den Architekten nicht viel anderes übrig, als über den Bibliotheken Bürostrukturen für Institute und Lehrstühle zu bauen. Ob diese in solch barscher Rigidität wie auf dem Campus Westend ausfallen müssen, darüber lässt sich trefflich streiten.
Einzig Heide nutzte konsequent die Freiheiten, die ihm die Sonderfunktionen seiner Gebäude gaben: Mit tiefen Einschnitten, Loggien und geschossübergreifenden Verglasungen geht er fast skulptural zu Werke. Er schneidet Volumina aus, variiert Fensterbreiten hier, schließt groß dimensionierte Fassadenflächen da. Weil auch sein Travertin eine weit größere Farbvarianz aufweist und stärker strukturiert ist als der seiner Berliner Kollegen, kommt er dem Poelzig des IG-Farben-Gebäudes wesentlich näher als jene.
Ausbau der Selbstbezogenheit
Der Campus Westend, der zentrale Anlaufstelle für etwa 25 000 der insgesamt 46 500 Studierenden der Goethe-Uni ist (neben dem Campus Riedberg für Naturwissenschaftler und dem Campus Niederrad für Mediziner), hat mit historischen Altlasten zu kämpfen. Schon Ernst May und Martin Elsässer kritisierten Poelzig, weil dieser mit seinem 250 m langen Riegel – dem damals größten Bürohaus Europas – das dahinter liegende Gelände vom Westend abschneide (Dass die beiden einem ähnlichen, doch architektonisch nicht ganz so beeindruckenden Wettbewerbsbeitrag eingereicht hatten, war ihnen offenbar entfallen). Als im Mai 1972 die Rote Armee Fraktion den ersten von insgesamt drei Anschlägen auf das Hauptquartier der US Army verübt hatte, verwandelte sich der bis dahin öffentlich zugängliche Park zur militärischen Sperrzone. Das galt auch für die dahinter liegenden Offiziersvillen, die Zeilengebäude der Mannschaften und die Frankfurt American High School. Weil die Adickesallee, die den nördlichen Abschluss des Areals bildet, ein vielbefahrener Autobahnzubringer ist, dahinter wiederum Zeilenbauten liegen, und auch im Osten wenig städtische Strukturen vorhanden sind, wird der Campus vermutlich auch weiterhin isoliert bleiben. Und dass gar ein Studentenviertel entsteht – wie einstmals in Bockenheim rund um den derzeit sich rapide leerenden Kramer-Campus –, kann man sich schwerlich vorstellen. Zumal sich in jedem neuen Uni-Gebäude eine Cafeteria mit gehobenem Angebot befindet (auch das eine Vorgabe des Masterplans), sodass die Studierenden nicht gezwungen sind, das Areal zu verlassen. Das Studierendenhaus, derzeit in der Ausführungsplanung (Architekt: HJP, Würzburg), soll das Angebot in naher Zukunft sogar noch vergrößern.
Die weitere Zukunft des Campus ist noch nicht abzusehen. Heide hatte als nördlichen Abschluss insgesamt fünf Sechsgeschosser mit 13-geschossigen Hochpunkten – analog zu den Risaliten des I.G.-Farben-Hauses – vorgesehen. Einer davon, an der Nordost-Ecke, wird derzeit nach Plänen von K9 Architekten (Freiburg) für das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) gebaut. Die restlichen Vier stehen als Reserveflächen für Uni-nahe Einrichtungen zur Verfügung. Darüber hinaus steht die Philipp-Holzmann-Schule dem Campus-Ausbau buchstäblich im Wege. Diese städtische Berufsschule hatte das Gebäude der High School übernommen, deren Sportplatz sollte bis vor Kurzem als Übergangsstandort für ein Gymnasium dienen.
Wegen des enormen Zuzugs sucht die Stadt händeringend nach Grundstücken für Schulen und Kitas. Im Januar 2017 verkündeten Land, Stadt und Goethe-Uni eine »grundsätzliche Verständigung«: Man tauscht Grundstücke aus, die Stadt bekommt einen neuen Schulstandort, die Uni Planungssicherheit für ihren weiteren Ausbau. Über die einzelnen Modalitäten wird noch verhandelt. Wann also der letzte Stein des dann nicht mehr ganz so neuen Campus gesetzt wird, steht in den Sternen. »Mittel- bis langfristig«, heißt es offiziell. Vielleicht zu einer Zeit, in der jene, die ihn heute zum Spielen benutzen, selbst studieren wollen.
db, So., 2017.04.02
verknüpfte Zeitschriftendb 2017|04 Campus
![]()