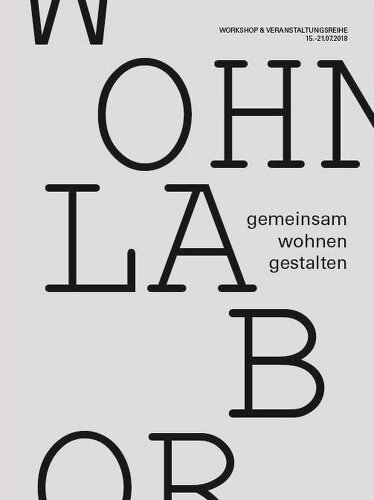Unser Freund, der Boden
Ein heftig umstrittener 100.000-Euro-Eigenheim-Bonus, eine Bodenstrategie der Länder und ein Petitionspapier der Architekten. Der Umgang mit Österreichs Boden ist derzeit ein Politikum und Schauplatz von Debatten Eine Übersicht.
Ein heftig umstrittener 100.000-Euro-Eigenheim-Bonus, eine Bodenstrategie der Länder und ein Petitionspapier der Architekten. Der Umgang mit Österreichs Boden ist derzeit ein Politikum und Schauplatz von Debatten Eine Übersicht.
Der Boden ist unser Freund. Er ist enorm wichtig für den Klimaschutz und die Klimawandelanpassung, weil er in naturbelassener Form Kohlenstoff und Wasser speichert und neues Wasser, das bei Extremwetterereignissen sehr schnell in großer Menge anfällt, aufnehmen kann.
Naturbelassene Flächen sind außerdem wichtig für den Erhalt der Biodiversität. Unverbaute Böden sind die Existenzgrundlage der Landwirtschaft und somit für unsere Ernährung – und zukünftig zunehmend für die Energieversorgung, wenn größere Mengen Biogases produziert werden müssen und man Äcker mit Photovoltaik und Windkraft kombiniert. Ebenso wichtig ist der unverbaute Boden für Tourismus und Erholung. Niemand fährt nach Österreich, um Einfamilienhausteppiche und Gewerbegebiete zu besuchen. Und auch wer hier lebt, ist gern im Grünen unterwegs statt nur auf der Autobahn.
Der Bodenverbrauch ist somit unser Feind. Aber diesen Feind füttern wir jeden Tag mit weiteren zwölf Hektar (etwa 17 Fußballfelder) sogenannter Flächeninanspruchnahme. Dieser Boden steht nicht mehr als naturbelassenes Grünland, Ödland, Gewässer, Wald oder landwirtschaftliche Fläche, sondern für Siedlungs- und Verkehrsflächen zur Verfügung. Weil der Boden nicht nur für Biodiversität, Landwirtschaft und Erholung gebraucht wird, sondern auch, um darauf zu wohnen, zu arbeiten, sich vorwärts zu bewegen. In Österreich benötigen wir dafür vergleichsweise viel Platz, obwohl wir nur wenig davon haben. Und jeder Neubau auf der grünen Wiese löst einen flächenfressenden Dominoeffekt aus: neue Verkehrsflächen, neue Gewerbeflächen, neue Wohnflächen.
Dichte Stadt, weites Land
Hierzulande gibt es den Begriff des „Dauersiedlungsraums“. Das ist die Fläche, die für Bebauung oder Landwirtschaft genützt werden kann. In Österreich sind das nur 39 Prozent der Landesfläche. In anderen Ländern gibt es diesen Begriff gar nicht, weil fast die gesamte Fläche nutzbar ist. In Deutschland beispielsweise beträgt die tägliche neue Flächeninanspruchnahme 55 Hektar, also nur 4,5-mal so viel wie in Österreich, obwohl es neunmal so viel Einwohner und siebenmal so viel Dauersiedlungsraum gibt.
Wir müssen also weniger Boden verbrauchen. Städte können das besonders gut, so ist Wien Meister darin, große Bevölkerungszuwächse auf wenig Fläche bei hoher Lebensqualität zu bewältigen – und das gilt für andere große österreichische Städte ähnlich. Mehr als ein Drittel des Bevölkerungswachstums hierzulande nahm in den letzten Jahren Wien auf, das in dieser Zeit aber nur 0,1 Hektar neue Fläche pro Tag gebraucht hat. Der Rest des Landes brauchte für die weiteren zwei Drittel ein Vielfaches. Aber natürlich können nicht alle in Wien wohnen, die Stadt platzt ohnehin schon aus allen Nähten. Was nötig ist: sorgfältig entwickelte, relativ dicht weitergebaute Dörfer, Klein- und Mittelstädte. Sanierung und Umbau bei Bestandsbauten, Aktivierung von Leerstand, um wenig neue Fläche zu verwenden.
Heute sind wir in der bizarren Situation, dass in Wien jeder Quadratmeter Boden in zentraler Lage von Bürgerinitiativen umkämpft ist. Gleichzeitig stört niemanden der stetig wachsende Wiener Speckgürtel auf genauso wertvollem Boden, wo aber pro Person die zehnfache Fläche verbraucht wird.
Faust auf den Tisch
Die Politik kennt das Problem. Bereits in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung von 2002 wurde als Ziel festgelegt, dass bis 2010 maximal 2,5 Hektar pro Tag zu verbrauchen seien. Die aktuelle Regierung erneuerte dieses Ziel für 2030. Vor zwei Jahren startete die Entwicklung einer Bodenstrategie: Alle Bundesländer, die Bundesministerien, Städtebund und Gemeindebund erarbeiteten Ziele und Maßnahmen, wie der Boden zu schützen sei. Im Juni 2023 war man fertig, doch der zuständige Minister Werner Kogler knallte die Faust auf den Tisch, weil etwas Zentrales fehlte: das genaue Ziel, wie viel (oder wie wenig) Boden man 2030 noch verbrauchen wollte. Denn die 2,5 Hektar standen nicht drin.
Die Bundesländer fanden dieses Ziel nicht „plausibel“ (zu ambitioniert, könnte man auch sagen). Seither lag das Papier in den Schubladen, bis sich letzte Woche die Bundesländer sowie der Städte- und Gemeindebund in Linz zu einer „Raumordnungstagung“ trafen, um den Bund vor vollendete Tatsachen zu stellen: Die Bodenstrategie von 2023 wurde nun beschlossen, natürlich ohne das fixierte 2,5-Hektar-Ziel. Das ist einerseits gut, weil die Maßnahmen richtig und wichtig sind. Es ist andererseits aber auch höchst problematisch: Bis 2030 sind es noch sechs Jahre. Wenn man jetzt erst beginnt, Zielwerte zu erarbeiten, wird man sie nicht mehr erreichen.
Die österreichische Politik ist beim Thema Bodenschutz janusköpfig: Einerseits will man schon, man muss ja auch, es gibt Übereinkommen wie die UN-Agenda 2030 oder die EU-Bodenstrategie für 2030. Aber andererseits ist es viel schöner, Flächen großzügig zu verteilen, damit alle Österreicherinnen mit ihrem eigenen, neugebauten Einfamilienhaus glücklich werden können (dabei gibt es schon 1,5 Millionen davon).
So präsentierten im Februar die Sozialpartner in trauter Einigkeit einen 100.000-Euro-Eigenheimbonus für jene, die es sich leisten können, viel Fläche zu verbrauchen. Zum Glück wurde die Idee breit abgelehnt. Das finale Konjunkturprogramm der Bundesregierung ist zwiespältig zu sehen: Auf der Habenseite stehen der vermiedene Bonus, 20 Prozent der Mittel für Sanierung und die sehr wichtige Ermächtigung der Länder für Leerstandsabgaben. Auf der Sollseite: Warum gibt es, soweit derzeit bekannt, keine Qualitätskriterien? Klimaschutz, Ortskernentwicklung, Architekturqualität? Warum wird nicht verhindert, dass man damit auf der grünen Wiese statt in den Orts- und Stadtkernen baut? Warum werden nicht vorrangig Holzbau, verdichtetes Bauen, Leerstandsaktivierung gefördert?
Verantwortungsbewusstsein
Da kommt das aktuelle Positionspapier „Klima, Boden & Gesellschaft“ der Bundeskammer der Ziviltechniker:innen gerade recht. Die Vertretung der planenden Berufe sagt nicht etwa: Bauen, bauen, bauen! Im Gegenteil. Sie meint, Österreich sei fertiggebaut. Sie fordert Bodenschutz, nachhaltige Energieversorgung und ressourcenschonendes Bauen, das heißt Priorität für Bestandserhaltung. Und sie verlangt eine gerechte Verteilung der knappen Ressourcen, Fokus aufs Gemeinwohl im Bauen. So viel Verantwortungsbewusstsein würde man sich von anderen Repräsentanten auch wünschen.
Robert Temel ist einer der drei Sprecher der Plattform Baukulturpolitik.
Der Standard, Sa., 2024.03.09