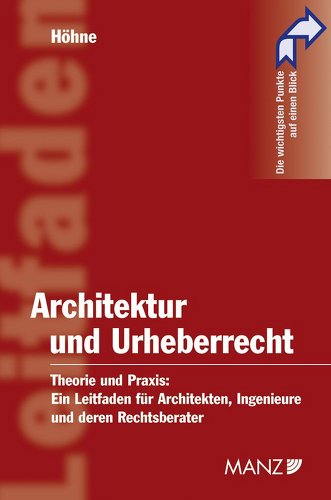Wem gehört die Architektur?
Der neue Lehrter Bahnhof in Berlin zeigt das alte Dilemma zwischen Bauherren und Architekten
Der neue Lehrter Bahnhof in Berlin zeigt das alte Dilemma zwischen Bauherren und Architekten
Am 28. November 2006 gab es ein böses Erwachen für Hartmut Mehdorn, Chef der Deutschen Bahn, als das Landgericht Berlin der Klage des Architekturbüros von Gerkan, Marg und Partner stattgab, mit der die Architekten die Entfernung der umgebauten Flachdecken in den Untergeschoßen des Berliner Hauptbahnhofs verlangt hatten. Der Neubau des Lehrter Bahnhofs in Berlin war pünktlich zur Fußball-WM 2006 fertig geworden - allerdings nicht so, wie sich die Architekten das vorgestellt hatten. Wesentliches Kennzeichen der Planung war die Überdachung des Gleiskörpers über eine Länge von 450 Metern, der, in einer weiten Parabel geschwungen, von den Bahnhofsgebäuden gequert wird. Für Herrn Mehdorn reichten 320 Meter Überdachung aus - was nicht nur zur Folge hatte, dass die Relationen nicht mehr stimmten und die vormals großzügige Parabel eher an eine abgebissene Wurst erinnerte, sondern auch, dass aufgrund der Überlänge der ICE-Züge es just die Passagiere der ersten Klasse waren, die nun unbedacht der Witterung trotzen mussten, wenn sie Berliner Bahnhofsboden betraten. Die Bahn richtete daher einen Regenschirm-Dienst ein. In der Hoffnung, Schlimmeres zu verhindern, hatte von Gerkan der Dachverkürzung zugestimmt, weswegen er sich dagegen nun nicht mehr wehren kann. Die Pointe dabei: Die aufwändig hergestellten Bauteile waren bereits fertig. Jetzt liegen sie im Depot.
Von Gerkan hatte aber nicht irgendeine Überdachung geplant, sondern ein gläsernes Kreuzgratgewölbe. Herrn Mehdorn ging das zu weit: „Wir haben einen Bahnhof bestellt, keine Kathedrale“, kommentierte er und ließ eine schlichte Flachdecke einziehen. Da wäre es wohl besser gewesen, die Deutsche Bahn hätte ihre Ausschreibung auf die schlichte Formel „Wir wollen eine Schachtel, durch die die Eisenbahn durchfährt“ beschränkt. Die Bahn hatte allerdings sehr wohl eine „Kathedrale“ bestellt, hatte von Gerkan Meinhard doch nicht nur nicht verheimlicht, was er da geplant hatte, sondern dies mit der Bahn in jahrelanger Planung abgestimmt und bemustert. Der Bahn wurde der Kathedralenbau zu teuer, und Mehdorn zog die Notbremse, was allerdings fürs Erste in einem Crash für die Deutsche Bahn endete. Die Klage von Gerkans gegen diese Entstellung qualifizierte Mehdorn als „Egotrip des Architekten“. Fragt sich nur, wessen Egotrip. Von Gerkan meint, dass es Mehdorn bloß darum gehe zu zeigen, wer der Herr im Haus ist. Wer aber ist der Herr im Haus?
Darf der Bauherr die Planung über den Haufen werfen und nach Gutdünken verhunzen? Darf er nicht, sagt das deutsche Urheberrechtsgesetz, das dem Bauherrn schlechthin die Änderung des Werks verbietet. Dennoch ist der Berliner Prozess für die Architekten keine „g'mahte Wies'n“. Das zeigte schon der Prozess von Roland Rainer gegen die Stadt Bremen, als diese seine in den 50er-Jahren erbaute Stadthalle so aufstockte, dass von Rainers kühnem Wurf nur mehr eine Karikatur übrig blieb. Rainer klagte - und das Bremer Gericht gab ihm sogar schriftlich, dass hier der Tatbestand der Entstellung vorlag. Allerdings sind nach deutschem Urheberrechtsgesetz Änderungen des Werks, zu denen der Urheber seine Einwilligung nach Treu und Glauben nicht versagen kann, zulässig. Dies ist in der Praxis Einfallstor für eine weit gehende Aushöhlung des zunächst so stark scheinenden Schutzes der Baukünstler. Rainer verlor den Prozess. Umso sensationeller der Spruch des Bremer Landgerichts, der allerdings nicht das Ende vom Lied darstellt. Die Deutsche Bahn wird berufen.
Der Berliner Prozess bringt die Frage der Verantwortung der öffentlichen Hand als Bauherr auf den Punkt. Ist der Shareholder-Value nun auch im Bereich der Architektur das Einzige, was zählt? Kennt die öffentliche Hand noch so etwas wie Verantwortung für die Gestaltung der gebauten Welt, die uns umgibt?
Wie sieht es denn mit den Bauten Roland Rainers in Österreich aus? Die Böhler-Werke waren ein Bauherr nach Rainers Geschmack, ein Bauherr, der vom Architekten „ein mit sparsamen Mitteln errichtetes, aber erstklassig funktionierendes Gebäude verlangte, sich aber aller Gestaltungswünsche und -ratschläge enthielt und bereit war, auch ungewöhnliche Architektenvorschläge zu verwirklichen.“ Das Böhler-Haus in der Wiener Elisabethstraße wurde nach jahrelangem Leerstand 2003 als Teil des Hotels „Le Meridien“ revitalisiert. Und wie sieht es mit dem Flaggschiff der österreichischen Moderne, dem ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg, aus? Das Gebäude bedarf der thermischen Sanierung, manche bezeichnen es als baufällig, es muss an neue technische Gegebenheiten angepasst werden. Die Frage, warum das Hauptgebäude des wichtigsten österreichischen Rundfunksenders in einer Wüste von Siedlungshäusern, die kaum durch öffentliche Verkehrsmittel erschlossen ist, stehen muss, ist unbeantwortet. Die Zeiten, als der Monopolist hoch vom Berge die frohe Botschaft verkündete, sind vorbei: Die Symbolsprache stimmt nicht mehr. Wenn allerdings Alexander Wrabetz den „Küniglberg“ umbauen will, hindert ihn kein Urheberrecht. Denn das österreichische Urheberrechtsgesetz trifft eine klare Entscheidung zugunsten des Bauherrn: Er kann mit der Planung des Architekten machen, was er will - was dem Architekten bleibt, ist das bescheidene Recht, ein Täfelchen mit dem Hinweis aufzustellen, dass er/sie für diese Verhunzung nun wirklich nichts kann. Bislang war das immer noch mehr, als die Praxis deutscher Gerichte hergab. Mit Berlin könnte sich dies jetzt ändern.
Wie auch immer der „Küniglberg“ in Zukunft genutzt wird, die Gefahr droht dem Eigentümer nicht vom Urheberrechtsgesetz, sondern von anderer Seite, nämlich dem Denkmalschutz. Gebäude im öffentlichen Eigentum - und dazu zählt auch das ORF-Zentrum - unterliegen per se dem Denkmalschutz. Auf den Eigentümer des ORF-Zentrums wie auch das Denkmalamt kommen schwierige Zeiten zu: Formal hat der Denkmalschutz die besseren Karten, dennoch ist Behutsamkeit von beiden Seiten gefragt, kann es doch nicht um museale Erhaltung gehen, sondern nur darum, die Sprache und Individualität des Gebäudes mit den modernen Anforderungen zu versöhnen.
Gelingt dies bei anderen Werken der österreichischen Moderne? Das Hotel Bellevue von Wolfgang und Traude Windbrechtinger wurde 1982 durch Zerstörung von der Himmelstraße in den Himmel der Architektur befördert, das Philips-Haus von Karl Schwanzer am Wienerberg hat halbwegs glücklich überlebt, ebenso der Wiener Ringturm. Und das vormalige Museum des 20. Jahrhunderts, von Karl Schwanzer als Pavillon der Weltausstellung in Brüssel 1958 gebaut, hofft auf seine Revitalisierung durch Adolf Krischanitz. Die Bewahrung des modernen Erbes der österreichischen Architektur liegt in den Händen von Bauherrn und Denkmalschutz, nicht der Gerichte. Und gerade deshalb, weil sich in Österreich die Architekten rechtlich nicht wehren können, kommt der öffentlichen Aufmerksamkeit besondere Bedeutung zu.
[ Thomas Höhne ist Rechtsanwalt in Wien, sein Buch „Architektur und Urheberrecht“ erscheint im Februar 2007 im Manz-Verlag. Geschrieben wurde es in einem wunderschönen Bau der 60er-Jahre von Jaksch/Lippert, dessen Eigentümer die kühle Aluminiumfassade in den 90er-Jahren mit braunen Plastikjalousien zu verschandeln beliebten. ]
Der Standard, Sa., 2006.12.30
verknüpfte Publikationen
Architektur und Urheberrecht