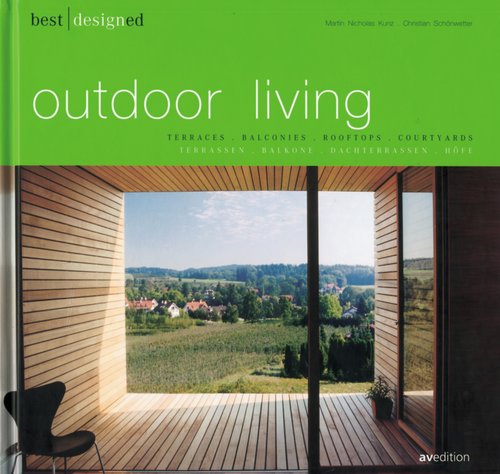Die 60er Jahre weitergestrickt
»Lubetkin Apartment« nennt das STUDIO NAAMA seinen Umbau einer Wohnung in einem Hochhaus von Berthold Lubetkin. Ist dieser Name gerechtfertigt? Tatsächlich greift die Neugestaltung zahlreiche Merkmale des Bestands auf und entwickelt sie subtil weiter.
»Lubetkin Apartment« nennt das STUDIO NAAMA seinen Umbau einer Wohnung in einem Hochhaus von Berthold Lubetkin. Ist dieser Name gerechtfertigt? Tatsächlich greift die Neugestaltung zahlreiche Merkmale des Bestands auf und entwickelt sie subtil weiter.
Das Projekt für den Umbau einer Dreiraumwohnung in Sivill House war bereits in Planung, als das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wurde. Mitte der 60er Jahre hatten prominente Architekten der englischen Vor- und Nachkriegsmoderne, Skinner, Bailey und Lubetkin, das Hochhaus als sozialen Wohnungsbau in Ostlondons trendiger Columbia Road errichtet; nun stand dem eleganten, 20-geschossigen Wohnturm eine plumpe Modernisierung mit doppelt verglasten Kunststofffenstern bevor, deren Gestaltung deutlich vom Original abwich. Dies rief die Twentieth Century Society and architekturverliebte Nachbarn auf den Plan, die für einen Eintrag in die Denkmalliste plädierten. Historic England und die Zentralregierung stimmten zu und Sivill House wurde 2020 auf der niedrigsten Denkmalstufe, Grade II, in die Liste eingetragen. Die Wohnungen selbst sind davon nicht betroffen und können im Innern prinzipiell ohne denkmalrechtliche Genehmigung verändert werden. Dennoch reichten die Architekt:innen Natalie Savva und Mark Rist von Studio NAAMA einen Bauantrag ein, v. a. um ihre Bauherren abzusichern, denn ein Bruch des Denkmalgesetztes ist in England strafbar.
Mehr Licht, mehr Durchblick, mehr Stauraum
Die Wohnung liegt im 12. OG des Hochhauses. Aufgrund des ungewöhnlichen Gebäudegrundrisses mit zwei Flügeln, die durch einen zentralen runden Treppenturm verbunden und in vier Einheiten pro Geschoss aufgeteilt sind, bietet sie Ausblick nach drei Seiten. Trotz der dadurch möglichen Helligkeit waren die Räume nicht gerade lichtdurchflutet, zudem wirkte die Dreizimmerwohnung auf insgesamt 65 m² eher kompakt. Die jungen Architekt:innen entfernten daher eine Reihe nichttragender Wände zugunsten von möbelartigen Einbauelementen, die mehr Stauraum, Durchblick und Lichteinfall ermöglichen. Die Wand zwischen dem Wohnzimmer und größerem Schlafzimmer wurde durch ein Regal inklusive einer mehrteiligen Schiebetür ersetzt. Die Wand zwischen Hauptschlafzimmer und Flur machte in ähnlicher Weise Platz für ein Regal. Das kleinere Schlafzimmer avancierte zum Mehrzweckraum: An der Wand befindet sich ein ausklappbares Bett, das in neu entworfenen Einbauschränken verschwindet, wenn das Zimmer als Büro oder Fahrrad-Trainingsraum benutzt wird. Einen ursprünglich kleinen Einbauschrank im Flur ließ STUDIO NAAMA vergrößern, um darin die Bikes der fahrradbegeisterten Bauherren verstauen zu können. Die spartanisch ausgestattete Küche wiederum wurde von einem geschlossenen Element vor dem beinahe bodentiefen Fenster befreit und mit einer minimierten Spüle versehen, um möglichst wenig Ausblick und Licht zu verlieren – eine neue frei stehende Frühstücksbar bietet gleichzeitig einen Essplatz. Der Flur schließlich erhielt ein frei stehendes Garderobenmöbel mit einer verspiegelten Seitenfläche, um den kleinen Raum optisch zu vergrößern, und einer Rückwand aus transluzentem Polycarbonat, um Licht zu streuen.
Der Bestand als Leitschnur
Ein Ziel des Umbaus war es, die Materialität des 60er-Jahre-Hochhauses aufzugreifen. Die Wohnung selbst hatte keine erhaltenswerten originalen Elemente, aber die spektakuläre Haupttreppe im Zentrum des Gebäudes und der Fußbodenbelag im Gemeinschaftsflur dienten als Inspiration für neue Materialien in der Wohnung: So erhielt die Küche einen grünen Terrazzoboden, der dem im Aufzugsflur ähnelt, und viele der Einbauelemente, etwa die Frühstücksbar und Garderobe, sind aus gebogenen Metallrahmen konstruiert, die an das Treppengeländer von Skinner, Bailey und Lubetkin erinnern. In Anlehnung an andere Interieurs der 60er Jahre bestehen die Einbaumöbel aus dem preiswerten Material Sperrholz. Alle Türen wurden gegen moderne Exemplare mit Holzrahmen und Glasfüllung ausgetauscht, da die vorherigen Bewohner pseudoviktorianische Modelle eingebaut hatten.
Trotz dieser zahlreichen Veränderungen war es den Architekt:innen wichtig, den Originalbau nicht komplett unter neuen Elementen verschwinden zu lassen. Betonunterzüge etwa wurden freigelegt und sichtbar belassen und unterbrechen die hölzerne Wandpaneelierung – auch dies eine Referenz an die Gestaltung der Gemeinschaftsflächen des Gebäudes, verleiht doch eine Betonstruktur dem Haupteingang im EG besonderen Charakter.
Handwerklich, preiswert, nachhaltig
Das Rastermaß aller Einbauten war durch den Bestand vorgegeben: Der Aufzug, dessen Benutzung für einen Umbau im 12. OG unabdingbar war, ist klein; er erlaubte nur den Transport schmaler und flach verpackter Elemente und diktierte somit einen Rhythmus von 600 mm breiten Bekleidungen und anderen Einbauten. Sie wurden vom Bauunternehmer montiert, der das kleinere Schlafzimmer während des Umbaus zur Werkstatt umfunktionierte . Diese handgefertigte Herangehensweise liegt Mark Rist und Natalie Savva am Herzen: Besonders sie entwirft viel Ausstellungsdesign und Bühnenbilder, oft für kleine Budgets, die eine volle Konzentration auf das Essenzielle und Wirkungskräftigste im Entwurf verlangen, manchmal mit den alltäglichsten Materialien. Bei der Neugestaltung der Wohnung setzten die beiden u. a. auf einfache Metallrohre, die in abgesägter Form als Griffmuscheln der Einbauschränke dienen und die Verwendung teurer Beschläge überflüssig machten.
Eines der wichtigsten Kriterien der Bauherren für den Umbau war eine nachhaltige Energieversorgung. Die bestehende Erdgasleitung wurde daher gekappt. Die naheliegende Installation einer Luftwärmepumpe als Ersatz kam nicht infrage, da der Balkon der Wohnung, der einzige zugängliche Außenraum, außen verglast ist und eine sichtbare Pumpe nicht den Denkmalkriterien entsprochen hätte. Stattdessen baute man in die Küche einen 210 l fassenden Wärmespeicher ein, der sich nachts über Ökostrom auflädt und tagsüber die Wohnung sowohl mit Warmwasser versorgt als auch die Heizung bedient.
Sind solche Aspekte nachhaltigen Bauens etwas, das den Architekt:innen schon an der Universität vermittelt wurde? Beide erzählen, dass dieses Themenfeld während ihres eigenen Studiums vor wenigen Jahren noch eine geringe Rolle spielte, doch dass die Lehre sich seither rapide verändert habe. Heute unterrichten beide an der Oxford Brookes Universität und die Ausbildung sei inzwischen klar auf Nachhaltigkeit als einen der wichtigsten Aspekte des Entwerfens und Bauens orientiert. Für Mark Rist ist gerade in diesem Bereich, der sich sehr dynamisch entwickelt, das Prinzip des lebenslangen Lernens von größter Bedeutung.
db, Di., 2023.08.01
verknüpfte Zeitschriften
db 2023|08 Jung saniert Alt