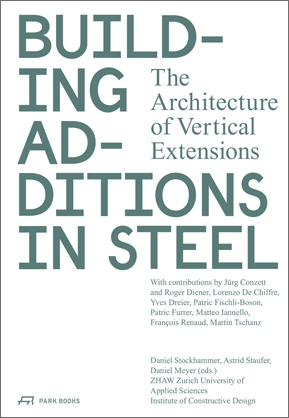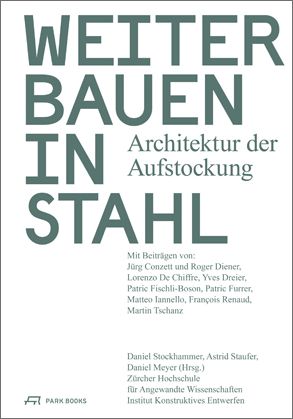Oberlicht neu gefaltet
Die Decke der Schwimmhalle im Hallenbad City in Zürich ist für die Badegäste wieder in ihrem ursprünglichen Erscheinungsbild erlebbar. Das Glasoberlicht, das die Atmosphäre und Ausstrahlung der lichten, grosszügigen Schwimmhalle betont, wurde neu konstruiert. Das Projektteam, ernst niklaus fausch architekten mit dem Ingenieurbureau Heierli und Dr. Lüchinger Meyer Bauingenieure AG (Glasstatik) und BWS Bauphysik AG, orientierte sich zwar an der ursprünglichen Ausführung von 1941, nutzt jedoch die Möglichkeiten der heutigen Glastechnik.
Die Decke der Schwimmhalle im Hallenbad City in Zürich ist für die Badegäste wieder in ihrem ursprünglichen Erscheinungsbild erlebbar. Das Glasoberlicht, das die Atmosphäre und Ausstrahlung der lichten, grosszügigen Schwimmhalle betont, wurde neu konstruiert. Das Projektteam, ernst niklaus fausch architekten mit dem Ingenieurbureau Heierli und Dr. Lüchinger Meyer Bauingenieure AG (Glasstatik) und BWS Bauphysik AG, orientierte sich zwar an der ursprünglichen Ausführung von 1941, nutzt jedoch die Möglichkeiten der heutigen Glastechnik.
War das originale Oberlicht streng symmetrisch aufgebaut, so hat das neue – eine Glasfaltdecke – ein eigenes Thema erhalten: Die Neigung der Elemente zu den Rändern hin erzeugt eine leichte Wellenbewegung, die die Schwimmenden vom Becken aus wahrnehmen können. Während beim Original die strenge Symmetrie durch die mittige Anordnung des Sprungturms betont war, verweist das neue Oberlicht mit der Bewegung der Glaselemente auf die grosszügige Schwimmhalle.
Auch beim bauphysikalischen Konzept beziehen sich die Planenden auf das Original: Die obere Verglasung übernimmt den Witterungs- und Wärmeschutz, die untere den Feuchteschutz für das Dachtragwerk. Das Originaldach im denkmalgeschützten Hallenbad war ursprünglich eine dreischalige Dachkonstruktion, die die den Feuchte-, Wärme- und Witterungsschutz auf drei Schichten verteilt. Im Mittelbereich über dem Becken waren zwischen den Untergurten der Fachwerkbinder Glasoberlichter eingesetzt: auf dem Obergurt der Fachwerkbinder lagen Doppelverglasungsfenster, die unten mit einem Maschengitter gesichert waren. Der zentrale Dachraum war beheizt, und auf den Hauptbindern war das äussere, als Wetterschutz konzipierte Oberlicht aufgeständert. Bei den als Kaltdach ausgeführten Seitenbereichen dagegen war in der Untergurtebene eine Stahlbetondecke integriert mit einer etwa 8 cm dicke Dämmschicht aus zementgebundenem Korkschrot.
Schon vor den Erneuerungsmassnahmen Ende der 1970er-Jahre (vgl. «Original im Wesen, nicht in der Substanz», S. 28) hat man das Oberlicht verschlossen. Im Zuge des 1978 folgenden Umbaus, der im Zeichen der Ölkrise stand und wärmetechnische Instandsetzungsmassnahmen erforderte, wurde dann eine abgehängte Akustikdecke und eine offen geführte Abluftanlage eingebaut. Eine Blecheindeckung ersetzte das äussere Oberlicht, sodass der zentrale Dachraum als Kaltdach fungierte. Die zwischen den Untergurten liegende Verglasung ersetzte man durch eine Holzschalung mit aufgelegter Wärmedämmung. Dabei wurde der Wärme- mit dem Feuchteschutz kombiniert, was Korrosionsrisiken für das Stahlfachwerk zur Folge hatte, da der untere Flansch im beheizten Hallenbereich lag.
Im Rahmen der Erneuerungsarbeiten rekonstruierten die Planenden das ursprüngliche Erscheinungsbild der Schwimmhalle mit Oberlicht, passten Entwurf und Konstruktion jedoch den heutigen Rahmenbedingungen an. Dafür sprachen nicht nur architektonische und denkmalpflegerische Aspekte, sondern auch das bauphysikalische Konzept.
Licht, Wärmegewinn und eine bessere Raumakustik
Die neue Dreifach-Isolierverglasung auf den Bindern übernimmt den Wärme- und Witterungsschutz. Zur Vermeidung einer zu starken Überhitzung im Sommer lassen sich einzelne Scheiben der Oberlichtverglasung öffnen. Die Simulation der Temperaturen im Dachhohlraum ergab zudem, dass dieser mit dem neuen Aufbau nicht mehr beheizt werden muss, um Kondenswasserbildung an der Verglasung und Korrosion an der Metallkonstruktion zu verhindern. Die ursprünglich als Kaltdach konzipierten Seitenbereiche sind neu als Warmdach gestaltet: Das Dach ist von innen zwischen den Sparren kompakt gedämmt. Dadurch liegt die Stahlfachwerkkonstruktion vollständig im beheizten Bereich. Die neue Glasfaltdecke im Untergurt schützt die Dachkonstruktion vor der hohen Raumluftfeuchte in der Schwimmhalle. Zudem verbessert sie die ursprünglich vorhandene raumakustische Wirkung, denn das gefaltete Oberlicht reflektiert die ankommenden Schallwellen nicht direkt, sondern streut sie in alle Richtungen.
Dem Thaleskreis folgend
Bereits im Vorfeld der Planungsarbeiten für das neue Glasoberlicht wurde die Stahlkonstruktion über der Schwimmhalle statisch überprüft. Dabei wiesen die Bauingenieure von Heierli nach, dass ihre Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit nach wie vor erfüllt ist. Verstärkungsmassnahmen waren somit nicht erforderlich, allerdings durfte die neue Glaskonstruktion keine Mehrlasten verursachen. ernst niklaus fausch architekten und Dr. Lüchinger Meyer Bauingenieure AG entwickelten das neue Oberlicht in Anlehnung an das originale Erscheinungsbild, passten die ursprünglich symmetrische Geometrie aber an. Waren die Glaselemente im Dachquerschnitt ehemals gleichschenklige Dreiecke, so setzten die Planenden nun Glaselemente ein, deren Dreiecksformen unterschiedliche Schenkellängen aufweisen: Von der Mittelachse der Halle neigen sie sich in sechs Teilschritten zu den Beckenenden hin. Die Spitze des Dreiecks folgt dabei einem definierten geometrischen Ort: Sie liegt auf dem Thaleskreis (Abb. 05). Aufgrund dieser Konstruktionsorganisation bleibt der 90 °-Winkel im Scheitelpunkt für alle aufgefalteten Glaselemente erhalten. Dies macht zusammen mit der Bildung von sechs Konstruktionstypen die Fertigung und Montage effizienter, zudem kann das eigens entwickelte Auflagerprofil bei allen Elemente verwendet werden, auch wenn sich deren Scheitelpunkte von Element zu Element verlagern (Abb. 04).
Rahmenlose Ecke und einlaminiertes Metall
Diese Anpassungen wurden erforderlich, weil die Auflagerprofile der ursprünglichen Konstruktion, einzelne, geneigte, liniengelagerte Glasscheiben, nicht vollständig erhalten waren. Beim Rückbau entfernte man an den Hochpunkten der Gläser die Auflagerprofile. Jene an den Tiefpunkten wurden für die eingesetzte Holzschalung genutzt. Sie sind erhalten, lassen allerdings keine genügende horizontale Lastabtragung zu. Das reduzierte Auflagersystem veränderte die Rahmenbedingungen für die neue Glasfaltdecke grundlegend. Die Eckverbinder an den Scheitelpunkten der Gläser mussten biegesteif und dennoch «unsichtbar» sein, um den ästhetischen Anforderungen zu genügen. Die Glasstatiker entwickelten dafür neue Eckverbinder. Bei diesen sind Metallstreifen in die Zwischenschicht im Verbundsicherheitsglas (dem sogenannten Interlayer) einlaminiert. Sie koppeln so die (laminierten) Glasscheiben. Dabei wird der Interlayer als Verankerungszone aktiviert. Um eine möglichst transluzente Projektionsfläche zu erzielen, sind die Streifen perforiert (Abb. 06). Sie wurden nach dem Laminierungsprozess gekantet, formen so die dreidimensionalen Glasfaltelemente und gewährleisten eine biegesteife Eckverbindung. Mit der entsprechenden Distanz des Betrachters sind sie im Verbundsicherheitsglas nicht mehr sichtbar. Die kleinmassstäbliche Veränderung der Glaselementgeometrie hingegen nimmt der Badegast wahr. So erscheint das Oberlicht vom Becken aus gesehen nicht plan und transparent, sondern als transluzente, dreidimensional strukturierte Fläche.
TEC21, Fr., 2013.02.08
verknüpfte Zeitschriften
TEC21 2013|07-08 Hallenbad City Zürich