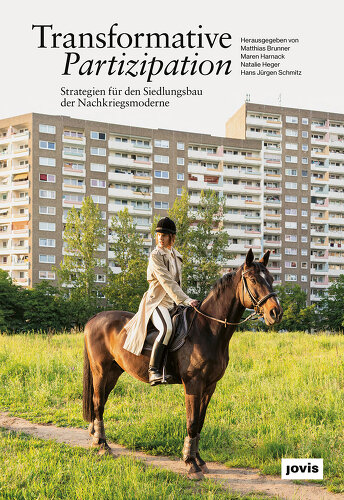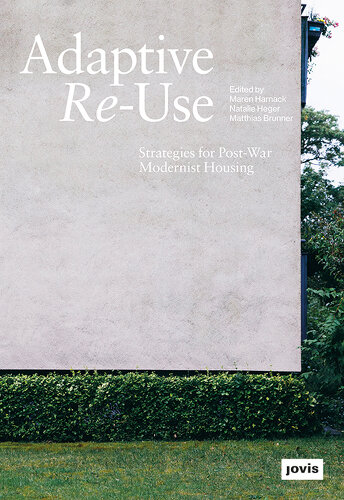Herrlichkeit in Hoogvliet
Hoogvliet, ein Stadtteil von Rotterdam (NL), wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ab 1948 nach dem Vorbild der englischen New Towns als eine mit einem Grüngürtel umgebene Siedlung mit voneinander abgegrenzten, um ein Zentrum angelegten Quartieren geplant. Mitte der 1990er-Jahre schrieb der Ort die «Chronik eines Ghettos». Nun hat die britische Architektengruppe FAT mit starken Farben, zeichenhaft en Formen und einfachen Details einem Unort eine ebenso unverwechselbare wie robuste Identität gegeben.
Hoogvliet, ein Stadtteil von Rotterdam (NL), wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ab 1948 nach dem Vorbild der englischen New Towns als eine mit einem Grüngürtel umgebene Siedlung mit voneinander abgegrenzten, um ein Zentrum angelegten Quartieren geplant. Mitte der 1990er-Jahre schrieb der Ort die «Chronik eines Ghettos». Nun hat die britische Architektengruppe FAT mit starken Farben, zeichenhaft en Formen und einfachen Details einem Unort eine ebenso unverwechselbare wie robuste Identität gegeben.
Der Park «Heerlijkheid Hoogvliet» war in erster Linie als temporäres jährliches Sommerfestival geplant, um der Hoogvlieter Bevölkerung zu zeigen, dass Hoogvliet trotz umfassenden Stadterneuerungsmassnahmen ein lebenswerter Wohnort ist. Der Park lehnt sich deshalb ursprünglich an den temporären, zweidimensionalen Kulissenbau an, wie er bei indischen Hochzeiten, aber auch in der Zeit des Wiederaufbaus bei Rotterdamer Geschäftsleuten gebräuchlich war, und soll Hoffnung und Fantasien der Bewohner (trotz der städtebaulichen Realität) widerspiegeln. Die Heerlijkheid Hoogvliet ist im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Rotterdam Hoogvliet entstanden und wurde durch die Programmleitung namens WiMBY! (Welcome into my backyard!) initiiert (siehe Kasten S. 22). Die Idee eines temporären Festivals wuchs sich schnell zu einem grossen, ernst zu nehmenden Bauprojekt aus. Bei der Planung und Konzeption des Parks wurden zwei Prinzipien verfolgt: Einerseits wurden von Anfang an potenzielle Nutzer einbezogen, anderseits sollte die Gestaltung garantieren, dass sich das Image von Hoogvliet verbessert und der Park über den Stadtteil hinaus Wirkung entfaltet. Das jährliche Festival bekam nun zusätzlich die Funktion, die Akzeptanz unter den Bewohnern für das Konzept und das Programm des zukünftigen Parks zu testen. Neben einem kulturellen Programm (unter anderem mit Auftritten verschiedener landesweit bekannter Künstler) bekamen Hoogvlieter Vereine und Organisationen die Gelegenheit, sich zu präsentieren, und machten für alle Bewohnergruppen ein breites Angebot. Nach und nach fanden sich so Gruppen, die sich langfristig für den Park engagieren wollten und die während der Festivals ausgiebig Gelegenheit hatten, sich kennenzulernen und probeweise miteinander zu arbeiten. WiMBY! ging davon aus, dass diejenigen, die sich schon am Planungsprozess beteiligen, den Park anschliessend auch nutzen und sich um ihn kümmern würden, und so das langfristige Bestehen des Parks gesichert ist.
„Dekorierte Schuppen“
Die britische Architektengruppe FAT (Fashion, Architecture, Taste) wurde von WiMBY! damit beauftragt, ein detailliertes Gestaltungskonzept für den Park zu entwickeln. FAT wurde 1995 von Sean Griffiths, Charles Holland und Sam Jacob in London gegründet und hat sich vor allem in den ersten Jahren durch kleinere Interventionen, Statements und vor allem ihre Vorliebe für die Postmoderne einen Namen gemacht – mittlerweile gehören auch grössere Wohnungsbauprojekte zu den Aufträgen der Gruppe. Während WiMBY! auf die Suche nach potenziellen, permanenten Nutzern des Parks ging, interpretierte FAT mithilfe von Fotocollagen, die an die Arbeit der amerikanischen Architekten Venturi und Scott-Brown erinnern, die Einrichtung von Vorgärten und Laubengängen im Stadtteil, um einen zu Hoogvliet passenden Architekturstil zu entwickeln. Die Architektursprache des Parks greift heute zwar ortstypische Elemente auf, kann aber keiner der vielen hier lebenden Gruppen explizit zugeordnet werden. Dies war wichtig, damit der Park zu einem Ort werden konnte, mit dem sich alle Hoogvlieter identifizieren können. Die Arbeit und die Entwürfe von FAT wurden der Öffentlichkeit und den zukünftigen Nutzern immer wieder vorgestellt und mit ihnen diskutiert. Wegen der Sprachschwierigkeiten wurde der Partizipationsprozess von WiMBY! moderiert. So konnte sichergestellt werden, dass der Park den Bedürfnissen der zukünftigen Nutzer entspricht und auch die Gestaltung nicht auf Widerstand stossen würde. FAT, bekannt für poppig-polemische Gestaltung, war in diesem Fall genau die richtige Wahl. Mit starken Farben, zeichenhaften Formen und einfachen Details hat es FAT geschafft, einem Unort ein unverwechselbares Gesicht zu geben. Während der hier vorherrschende Witz der Architektur im Wohnumfeld schnell aufdringlich wirken kann, ermutigt er in Hoogvliet dazu, sich Park und Villa anzueignen, und weist indirekt darauf hin, dass Ballspiele, Grillieren und all die Dinge, die in anderen Parks verboten sind, hier ausdrücklich erwünscht sind.
Die Gruppen, die heute im Park aktiv sind oder Teile des Parks betreiben, sind so unterschiedlich wie die Bevölkerung Hoogvliets. Eine Gruppe vornehmlich älterer Damen, die Baumritter, die sich schon früher für den Erhalt von Bäumen eingesetzt hat, betreibt ein Arboretum. Es grenzt den Park von der angrenzenden Wohnbebauung ab, erfüllt also gleichzeitig eine in das Gesamtkonzept eingebundene gestalterische Funktion und trägt dazu bei, Konflikte mit den Anwohnern zu vermeiden, weil es als ruhiger Ort zwischen eventuell lärmerzeugenden Aktivitäten und Wohnbebauung Abstand schafft. Eine gelbe «Hobbyhütte» wird vom Modellbootverein, dem vor allem ältere Hoogvlieter angehören, als Vereinsheim genutzt. Zunächst sollte ein ganzes Dorf dieser Hütten entstehen, für die verschiedene andere Vereine Interesse gezeigt haben, aber dies liess sich leider nicht finanzieren. Eigentlich waren die Hobbyhütten als eine Art erweiterter Garagen in einfachster Ausführung gedacht, mussten dann aber Anforderungen an Aufenthaltsräume erfüllen und ausserdem mit Sanitäranlagen ausgestattet werden – und wurden damit für die zukünftigen Nutzer zu teuer.
Im nordwestlichen Teil des Parks ist ein Abenteuerspielplatz angesiedelt, der mit einem Wassergraben vom Rest des Parks abgegrenzt ist. Die Brücke und das Tor, über das man ihn betritt, sind ebenfalls von FAT gestaltet und machen deutlich, dass er zum Park gehört. Der nordöstliche Teil des Parks wird von einer grossen, flexibel nutzbaren Rasenfläche und einem See eingenommen. Auf dem Rasen ist Ballspielen ebenso möglich, wie Festivals veranstaltet werden können. Der See hat die Form der Niederlande. Ausserdem gibt es in diesem Teil des Parks Grillstellen und viele Sitzgelegenheiten.
Einfachheit als Widerstandsfähigkeit
Am wichtigsten für den Park ist die Villa Heerlijkheid, in der ganz verschiedene Aktivitäten stattfinden können. Typologisch handelt es sich um einen «dekorierten Schuppen», eine einfache Halle mit Stahlskelett und Wandverkleidung aus Holzfaserplatten, auf die Baumornamente und eine an die Schornsteine in der Umgebung angelehnte Holzverkleidung appliziert wurden. Beides ist deutlich als schmückendes Ornament erkennbar und verbirgt nicht, dass die eigentliche Gebäudehülle darunter einfach, billig und zweckmässig gebaut ist. Auch innen fehlt unnötiger Schnickschnack: Man sieht die pink angestrichene Stahlkonstruktion, es gibt einen unauffälligen, aber belastbaren Industrieboden, und die Treppe in den ersten Stock ist ein einfaches Standardprodukt aus dem Gerüstbau. Von innen wird auch sichtbar, dass die Fensterformen den Ornamenten auf der Fassade nicht entsprechen, sondern dahinter einfach rechteckig bleiben. Diese Einfachheit ist von einer Robustheit, die vielleicht widerstandsfähiger ist als manche Bauten, deren Architekten eine vermeintliche «Wahrheit» zur Schau stellen, die aber sowohl ästhetisch als auch im Gebrauch sehr viel anfälliger auf den Zahn der Zeit reagieren.
Die Villa verfügt über eine Profiküche, einen grossen Veranstaltungssaal, einen kleinen Saal, in dem ein Restaurant betrieben wird, und über zwei schalldichte Räume, in denen ursprünglich ein kulturell orientierter Kinoveranstalter Filme zeigen wollte. Veränderte politische Konstellationen haben dazu geführt, dass diese Kooperation nicht zustande kam. Stattdessen werden die beiden Räume heute von Musikern als Proberäume genutzt. Dass die Villa Heerlijkheid flexibel genutzt werden kann, hat sich damit schon einmal gezeigt, aber auch das Spektrum der Veranstaltungen, die in den beiden Sälen stattfinden, ist breit gefächert und reicht von islamischen Hochzeiten bis zu Technokonzerten. Für den Fall, dass kommerzielle Veranstaltungen im Aussenraum stattfinden, lässt sich der Bereich um die Villa herum abtrennen. Er ist dann nur noch über eine Brücke zu erreichen, sodass der Zugang sich sehr einfach kontrollieren lässt. Dass kommerzielle Nutzungen nötig sind, um die Villa auf Dauer betreiben zu können, war allen Beteiligten klar und schmälert den Gewinn für Hoogvliet nicht. Im Gegenteil, die Villa ist so nicht von einem einzigen Geldgeber abhängig, kann ein vielfältigeres Angebot machen und ausserdem Veranstaltungen, die dem Stadtteil nützen, quersubventionieren.
Nachdem WiMBY! ihre Arbeiten in Hoogvliet 2007 abgeschlossen hat, ist es nun an den beteiligten Hoogvlieter Organisationen, den Park als einen Treffpunkt für alle Bewohner zu erhalten und auszubauen. Das ist vor allem eine Frage des Gleichgewichts unter den vielen verschiedenen Nutzergruppen. Bisher sieht es ganz so aus, als würde ihnen das auch ohne die Betreuung durch WiMBY! bestens gelingen.
TEC21, Fr., 2009.05.08
verknüpfte Zeitschriften
tec21 2009|19 Robustheit