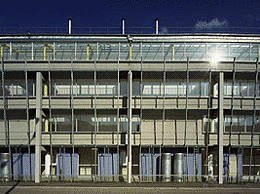Forum Neues Bauen: GUGLE
Serie Umwelt und Planung
Europäische Klimaschutzziele
Um für die nächsten Generationen eine zukunftssichere Entwicklung zu garantieren, haben sich...
Serie Umwelt und Planung
Europäische Klimaschutzziele
Um für die nächsten Generationen eine zukunftssichere Entwicklung zu garantieren, haben sich...
Serie Umwelt und Planung
Europäische Klimaschutzziele
Um für die nächsten Generationen eine zukunftssichere Entwicklung zu garantieren, haben sich die Länder der EU einvernehmlich den Ausstieg aus der fossilen Energie als wichtigstes Ziel gesetzt. Nach dem renommierten US-Ökonom Jeremy Rifkin, ist die EU trotz Finanzkrisen der letzten Jahre aufgrund ihres Bildungsniveaus, ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und ihres Wohlstandes die einzige globale Region, in der dieser Umstieg zuerst möglich ist.
In der EU wurden zur Erreichung dieser Zielsetzungen, beginnend im Jahr 2000 mit dem Europäischen Programm für den Klimaschutz (ECCP), auf politischer Ebene Beschlüsse gefasst. Dazu zählen die EU-Kernziele bis 2020 (Senkung der Treibhausgasemissionen gegenüber dem Niveau von 1990 um 20 %, Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien auf 20 %, Steigerung der Energieeffizienz um 20 %) und die „Roadmap 2050“ („Dekarbonisierung“ der europäischen Wirtschaft durch die Senkung des Treibhausgasausstoßes um mind. 80 % gegenüber 1990). Die vier primären Beweggründe der EU-Nationen, sich geschlossen für diese Zielsetzungen zu engagieren sind[1] Sicherheit ohne Abhängigkeit von fossilen Energieimporten[2], Verhindern von Energiearmut durch Verknappung fossiler Energie[3], Senkung von CO2-Emissionen aus Klimaschutzgründen[4], die Vision, Europa als globale Leitwirtschaft auf dem Sektor der Umwelttechnologien und Erneuerbaren Energien zu etablieren.
Smart Cities
In einem Jahrzehnt werden rund zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben. Nur ökologisch funktionierende Städte bieten jedoch die Chance, natürliche Landschaften zu erhalten und gleichzeitig die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu sichern [1]. Dies ist der Hintergrund von „Smart City“ Initiativen, welche das Ziel verfolgen Städte, als potenziell energieeffizienteste Wohnräume, in Zukunft lebenswerter und attraktiver zu gestalten. Zu den wichtigsten Werkzeugen smarter Stadtentwicklungsmodelle zählen: ambitionierte Sanierungen des Gebäudebestands, die Schaffung neuer Wohnquartiere mit höchster Energieeffizienz, der Umstieg von fossilen Energieträgern auf Erneuerbare Energien und die Entwicklung intelligenter Verkehrslösungen. [...]
Anmerkungen:
[01] Treberspurg, „Ökologischer Stadtbau“, Bauwelt 1995 , Heft 24
[02] Das erste weltweite „Smart City Ranking“ wurde 2012 vom USKlimastrategen Boyd Cohen durchgeführt – Wien landete vor Toronto und Paris auf dem ersten Platz. Mehr Infos zur Smart City Wien siehe wettbewerbe 304, Heft 3/2012
[03] „Invert/EE-Lab“ ist ein dynamisches Simulationstool, welches eine Entwicklung des Gebäudebestandes, die Investitionsentscheidungen der Investoren und das Nutzerverhalten der Gebäudenutzer über eine bestimmte Zeit abbildet. Der Energieeinsatz wird über Gebäudekenngrößen und Klimabedingungen berechnet. Das Tool wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes von EEG und TU Wien entwickelt. Weitere
Informationen bei Kranzl et al. (2011)
[04] ÖROK, 2011: ÖROK-Regionalprognosen 2010, Anhangtabellen im
Excel Format, http://www.oerok.gv.at/r
architekturjournal wettbewerbe, Mo., 2012.11.26
verknüpfte Zeitschriften
architekturjournal wettbewerbe 305