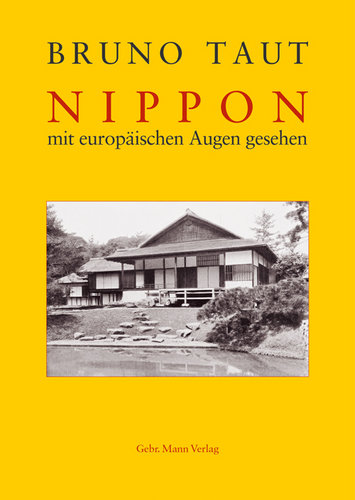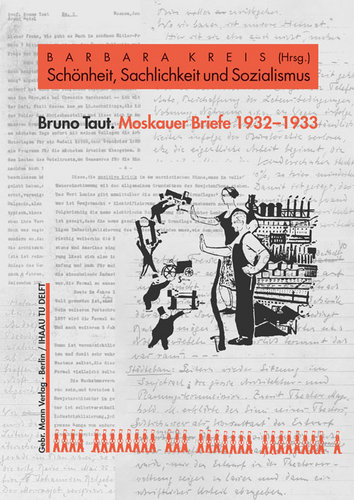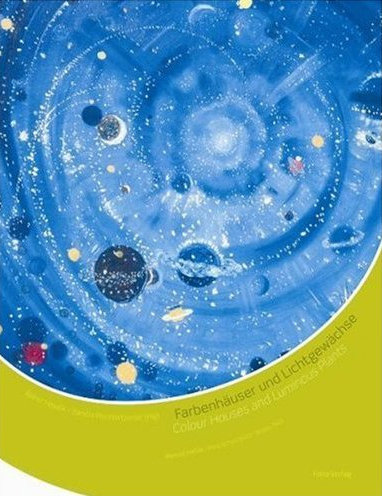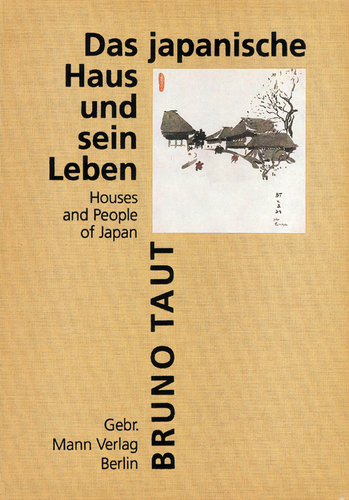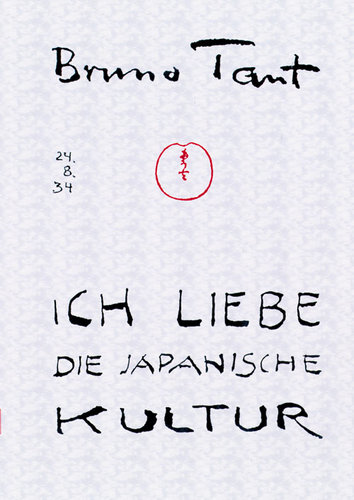Glossar - Personen- und Sachverzeichnis
Taut hat in der Architekturlehre als auch in den Architekturüberlegungen Erläuterungen zu zeitgenössischen Personen und Bauwerken nicht für nötig befunden. Ein Grund dafür könnte sein, daß er viele von ihnen in seinem bekannten Buch „Die neue Baukunst in Europa und Amerika“ von 1929 ausführlich behandelt hat. Zum Vergleich sind die Abbildungsnummern der „Neuen Baukunst“ in eckigen Klammern angegeben.
Taut hat in der Architekturlehre als auch in den Architekturüberlegungen Erläuterungen zu zeitgenössischen Personen und Bauwerken nicht für nötig befunden. Ein Grund dafür könnte sein, daß er viele von ihnen in seinem bekannten Buch „Die neue Baukunst in Europa und Amerika“ von 1929 ausführlich behandelt hat. Zum Vergleich sind die Abbildungsnummern der „Neuen Baukunst“ in eckigen Klammern angegeben.
Ashbee, Charles Robert (1863–1942), Architekt und Designer, Sozialreformer; entwickelte aus der englischen Arts-and-Crafts-Bewegung, die auf William Morris und John Ruskin zurückgeht, Ansätze für ein Industriedesign. Seine Land- und Stadthäuser stellen mit klaren und dekorfreien Formen eine auf das Wesentliche reduzierte, traditionelle Baukunst dar. Er war Vorbild für Hermann Muthesius, der ihm einen wichtigen Platz in seinem Werk „Das englische Haus“ (1904–05) einräumte. [14]
Bashô, Matsuo (1644–94), japanischer Dichter; vervollkommnete die Kunst des Haiku, des Kurzgedichtes aus 5–7–5 Silben. Berühmtestes Werk ist sein poetisches Tagebuch „oku no hoso michi“ (1694), englisch: „The Narrow Road to the Deep North and Other Travel Sketches“, hrsg. v. Nobuyuki Yuasa, Penguin Books 1966.
Behrens, Peter (1868–1940), Maler, Architekt, Designer. Sein einflußreichstes Werk entstand während seiner Tätigkeit als künstlerischer Beirat der AEG Berlin (1907–14): Turbinenhalle der AEG (1909), Kleinmotorenfabrik (1911), Design von Lampen und Elektrogeräten, Wohn- und Ausstellungsbauten. Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe gingen bei ihm in die Lehre, mit Le Corbusier arbeitete er zusammen. Lit.: Tilmann Buddensieg (Hrsg.), „Industriekultur, Peter Behrens und die AEG 1907–1914“, Berlin 1979. [27]
Berlage, Hendrik Petrus (1856–1934), holländischer Architekt. Reform der eklektizistischen Baustile hin zu einer konstruktiven und rationalen Baukunst. Hauptwerk: Die Börse in Amsterdam (1896–1903). Politisch links-liberal, förderte und beteiligte er im Rahmen seiner städtebaulichen Planung Amsterdam-Süd die jungen „Expressionisten“ Michel de Klerk, Piet Kramer u.a. Lit.: Manfred Bock, „Anfänge einer neuen Architektur“, ’s-Gravenhage/Wiesbaden 1983. [38]
Bonatz, Paul (1877–1956), Architekt, ab 1908 Professor an der TH Stuttgart als Nachfolger von Theodor Fischer. Entwickelte einen reduzierten Historismus mit monumentalen Ausdrucksformen. Hauptwerk: Hauptbahnhof in Stuttgart (1911–28). In den späten 20er Jahren Tendenzen zur Moderne: Hotel Graf Zeppelin, Stuttgart. Ab 1938 schuf er u.a. monumentale Brücken für die Reichsautobahnen. Lit.: Norbert Bongartz, Peter Dübbers, Frank Werner, „Paul Bonatz 1877–1956“, Stuttgart 1977.
École des Beaux-Arts, seit 1823 Bezeichnung der französischen Kunstakademien. Im Paris des 19. Jahrhunderts war sie die führende Ausbildungsstätte für Architektur. Sie vertrat eine neobarocke Architektursprache, deren Merkmale Symmetrie und historistische Bauformen waren. Lit.: Donald Drew Egbert, „The Beaux-Arts Tradition in French Architecture“, Princeton 1980.
Eiffel, Alexandre Gustave (1832–1923), französischer Ingenieur und Unternehmer. Sein berühmtestes Werk ist der nach ihm benannte Eiffelturm in Paris, der für die Weltausstellung 1889 erbaut wurde. Mit 300 Metern war er bis 1930 das höchste Bauwerk der Welt. Eisen war das alleinige gestalterische Material. An der Stahlkonstruktion der Freiheitsstatue in New York (1885) war er ebenfalls beteiligt. Lit.: Henri Loyrette, „Gustave Eiffel, Ein Ingenieur und sein Werk“, Stuttgart 1985. [15]
Fischer von Erlach, Johann Bernhard (1656–1723), führender Barockarchitekt in Österreich. Ab 1704 Wiener Hofarchitekt. Sein Meisterwerk wurde die Karlskirche in Wien (begonnen 1716). Erbauer der Wiener Hofbibliothek, heute Nationalbibliothek in der Wiener Hofburg, begonnen 1723 und vollendet 1726 von seinem Sohn Josef Emanuel Fischer.
Freyssinet, Eugène (1879–1962), französischer Ingenieur, bedeutend vor allem durch seine Spannbeton-Konstruktionen. Für die Luftschiffhalle in Orly bei Paris (1916) entwarf er eine gefaltete, schlank dimensionierte Eisenbetontonne in der Form einer Parabel. 1928 reichte er ein Patent zur Vorspannung von bewehrtem Beton ein, das 1930 erteilt wurde. Lit.: Jupp Grote, Bernard Marrey, „Freyssinet, der Spannbeton und Europa“, Paris 2000.
Garnier, Tony (1869–1954), französischer Architekt. Als Prix de Rome-Stipendiat entwarf er die „Cité Industrielle“, eine selbständige Industriestadt für 35.000 Einwohner mit Bauten in Eisenbeton, und publizierte sie 1917 in Paris. Ab 1905 eigenes Büro in Lyon, wo er die großen Projekte wie Viehmarkt, Krankenhaus und Sportstadion im Sinne seiner „Cité Industrielle“ verwirklichen konnte. Lit.: „Tony Garnier. L’œuvre complète“, Ausstellungskatalog, Paris 1989. [34]
Gropius, Walter (1883–1969), Architekt, Gründer des Bauhauses in Weimar (1919) und Dessau (1925). Nach unterbrochenem Studium arbeitete er 1909 bei Peter Behrens, 1910–25 gemeinsames Büro mit Adolf Meyer. Bedeutend für sein Œuvre sind die Faguswerke in Alfeld an der Leine (1911–14) sowie das Bauhausgebäude in Dessau (1925–26). Lit.: Reginald R. Isaacs, „Walter Gropius. Der Mensch und sein Werk“, Berlin 1983–1984. [24, 27, 199]
Haeckel, Ernst (1834–1919), Professor für vergleichende Anatomie und Zoologie in Jena, Naturphilosoph. Meeresbiologische Forschungsreisen führten zu Arbeiten über Radiolaren, Schwämme und Medusen, die er unter ästhetischen Gesichtspunkten zeichnete und publizierte: „Kunstformen der Natur“ (1899–1904). Sie hatten Einfluß auf Künstler des Jugendstils. Unermüdlicher Kämpfer für den Darwinismus. Begründung einer monistischen (atheistischen) Weltanschauung.
Hagia Sophia, Konstantinopel (heute Istanbul), erbaut von Anthemios von Tralles und Isidor von Milet (532–537), nach einem Erdbeben 557 mit höherer Kuppelkonstruktion erneuert, Durchmesser 31,5 Meter.
Haussmann, Baron George Eugène (1809–91), ab 1853 Präfekt unter Napoleon III. Umgestaltung des Pariser Stadtbildes mittels Straßendurchbrüchen, die ein System von Boulevards bilden und sternförmig in runden Plätzen zusammentreffen. Mit den Durchbrüchen entstand auch die 7- bis 8-geschossige Straßenbebauung mit den charakteristischen Mansarddächern, die das Straßenbild der Stadt prägen. Lit.: Howard Saalman, „Haussmann, Paris Transformed“, New York 1971.
Holl, Elias (1573–1646), Renaissancebaumeister. Nach einem Italienaufenthalt wurde er 1602 Stadtbaumeister in Augsburg. Viele öffentliche Bauten, darunter Schulen und Spital. Bedeutendstes Bauwerk ist das Rathaus (1615–20), einfach und streng gestaltet mit gleichmäßigem Fensterraster, aber je nach Funktion in unterschiedlichen Größen symmetrisch zusammengefaßt. Lit.: Bernd Roeck, „Elias Holl, 1573–1646. Architekt einer europäischen Stadt“, Regensburg 1985.
Horeau, Hector (1801–72), französischer Architekt, bekannt für die Lithographien seiner Ägyptenreise (erschienen 1841). Seine Vorschläge zur Verwendung von Eisenkonstruktionen im Monumentalbau fanden Eingang in seinen Siegerentwurf für den Wettbewerb (1850) zur Weltausstellung in London, dessen Dach aus Glas und Wände aus Platten von Porzellan, Terrakotta und farbigem Glas bestehen sollten. Realisiert wurde jedoch Joseph Paxtons Kristallpalast (1851).
Ise-Schreine, Mie Präfektur, Japan. Shinto-Heiligtum bestehend aus „antikem“ Kultspeicher und Nebenbauten. Alle Bauten einschließlich der 120 „Nebenschreine“ werden alle 20 Jahre neu errichtet. Erste dokumentierte Erneuerung 690 n. Chr. Im Inneren (Naiku) Schrein wird die Sonnengöttin Amaterasu verehrt, die als mythologische Ahnengöttin des japanischen Kaisers angesehen wird. Lit.: Kenzo Tange, Noboru Kawagoe, „Ise: Prototype of Japanese Architecture“, Cambridge, Mass. 1965.
Katsura-Palast, bei Kioto, Japan. Kaiserliche Wohnbauten und Teepavillons mit Landschaftsgarten, in drei Abschnitten 1617, 1642–45 und 1658–63 erbaut. Stilistische Merkmale führten zur Zuschreibung an den Fürst und Teemeister Kobori Enshu. Die „Entdeckung“ durch Bruno Taut 1934 machte dieses „architektonische Weltwunder Japans“ weltberühmt. Lit.: Arata Isozaki, Osamu Sato, Yasuhiro Ishimoto, „Katsura, Raum und Form“, Stuttgart/Zürich 1987; Arata Isozaki, Virginia Ponciroli (Hrsg.), „Katsura: The Imperial Villa“, Mailand 2007.
Le Corbusier, eigentlich Charles-Édouard Jeanneret (1887–1965), Architekt und Maler. Ab 1918 in Paris; begründete mit Amédée Ozenfant den sog. Purismus. Ab 1920 Herausgabe der Zeitschrift „L’Esprit Nouveau“, in der seine programmatischen Texte erschienen, die später die Basis seines einflußreichen Buches „Vers une architecture“ bildeten. Von 1920 bis zu seinem Tode die dominierende Persönlichkeit der modernen Architektur. Lit.: Willy Boesiger (Hrsg.), „Le Corbusier, Œuvre Complète, 1910–1965“, Zürich, bis 1965. [51, 186, 203]
Lunatscharski, Anatoli W. (1875–1933), russischer Politiker und Schriftsteller. Nach seiner Rückkehr aus westeuropäischer Emigration war er 1917–29 Leiter des Volkskommissariats für Erziehungswesen in der USSR und förderte die Vielseitigkeit der Kunst- und Architekturströmungen. Persönliche Bekanntschaft mit Bruno Taut; besuchte dessen Siedlungen in Berlin. Lit.: Barbara Kreis (Hrsg.), „Bruno Taut. Moskauer Briefe 1932–1933. Schönheit, Sachlichkeit und Sozialismus“, Berlin 2006.
Mackintosh, Charles Rennie (1868–1928), englischer Architekt und Designer; bildete zusammen mit Margaret und Frances MacDonald sowie James Herbert McNair die bekannte Jugendstil-Künstlergruppe „The Four“. Bedeutendstes Werk ist die Glasgow School of Art (1897–99 und 1907–09), eine Art dreidimensionales Ornament. Das Design zeigt Parallelen zu den Wiener Werkstätten, aber auch zu Frank Lloyd Wright. Lit.: Alan Crawford, „Charles Rennie Mackintosh“, London 1995. [14, 16, 17]
Mendelsohn, Erich (1887–1953), Architekt, prägte den Begriff der „dynamischen Funktion“ für seine vom Eisenbeton angeregten plastisch-organischen Architekturvisionen (1917/18). Der Einsteinturm in Potsdam (1919–21) wurde jedoch gemauert. Seine zahlreichen Fabriken, Geschäfts- und Warenhäuser suggerieren mit ihrer fließenden Linienführung, ihren Eckausbildungen und ihrer rhythmischen Gliederung Bewegung. Mendelsohn emigrierte 1933 (London, Palästina, ab 1941 USA). Lit.: Regina Stephan (Hrsg.), „Erich Mendelsohn. Gebaute Welten. Arbeiten für Europa, Palästina und Amerika“, Stuttgart 1998. [124, 127]
Messel, Alfred (1853–1909), Architekt. Bedeutendster Bau war das im Krieg zerstörte Kaufhaus Wertheim am Leipziger Platz in Berlin (1896–1997, 1904–05), dessen oft kopierte Fassade eine kraftvolle, an Gotik erinnernde Bauskulptur bildete. Messel war kein Neuerer, wurde aber von den Zeitgenossen für die Ausdruckskraft seiner „Architektur der Großstadt“ bewundert. Lit.: Julius Posener, „Berlin auf dem Wege zu einer neuen Architektur. Das Zeitalter Wilhelms II.“, München 1979. [18]
Mies van der Rohe, Ludwig (1888–1969), einer der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Er entwickelte in den 20er Jahren die grundlegenden Bauformen einer Materialästhetik der modernen Architektur. Höhepunkt war der deutsche Pavillon auf der Weltausstellung in Barcelona (1929). Mies emigrierte 1938 in die USA. Mit den Bauten des IIT in Chicago, z.B. der Crown Hall (1956), zahlreichen Wohn- und Bürohochhäusern wie dem Seagram Building in New York (1958) sowie der Neuen Nationalgalerie in Berlin (1962–68) gewann er dem sichtbaren Stahlskelett eine moderne Klassizität ab. Lit.: Jean-Louis Cohen, „Ludwig Mies van der Rohe“, Basel/Berlin/Boston 1995. [120, 153, 171, 218]
Newton, William Godfrey (1885–1949), englischer Architekt, Professor für Architektur an der Royal College of Art; Sohn des einflußreichen Architekten Ernest Newton, dessen zahlreiche Wohnbauten Hermann Muthesius in sein Buch „Das englische Haus“ (1904–05) aufnahm.
Östberg, Ragnar (1866–1945), schwedischer Architekt. Ruhm erlangte er mit dem Bau des Rathauses von Stockholm (1909–23), das durch vereinfachende Bauformen zwischen Historismus und 20. Jahrhundert vermittelt, dabei mit malerischem Turm und großflächigen Ziegelmauern schwedische Atmosphäre ausstrahlt. Ähnlich wie Berlages Börse in Amsterdam wurde es als Meisterwerk geschätzt. Lit.: Elias Cornell, „Ragnar Östberg – en svensk arkitekt“, Stockholm 1972.
Ostendorf, Friedrich (1871–1915), Architekt und Theoretiker. Er entwickelte eine Entwurfslehre der Raumästhetik mit klaren Raumfolgen und eindeutigen Symmetrien, dargelegt in den unvollendeten „Sechs Büchern vom Bauen“ (Berlin 1913–22), die eine Gegenposition zu den funktionalen Differenzierungen der englischen Landhäuser bildete, die Hermann Muthesius propagierte. Lit.: Werner Oechslin, „„Entwerfen heißt die einfachste Erscheinungsform zu finden.„ Mißverständnisse zum Zeitlosen, Historischen, Modernen und Klassischen bei Friedrich Ostendorf“, in: Vittorio M. Lampugnani u. Romana Schneider (Hrsg.): „Moderne Architektur in Deutschland 1900 bis 1950. Reform und Tradition“, Stuttgart 1992, S. 29–53.
Osthaus, Karl Ernst (1874–1921), Mäzen, Sammler; gründete in Hagen, Westfalen, das Museum Folkwang, das 1902 von Henry van de Velde ausgebaut wurde. Privat und als Vorstandsmitglied des Deutschen Werkbundes förderte er u.a. van de Velde, Richard Riemerschmid, Bruno Taut, Peter Behrens, Walter Gropius und Mathieu Lauweriks. Die Planung einer reform-pädagogischen Folkwangschule in Hohenhagen (1919–20), mit der Taut betraut wurde, konnte er nicht vollenden. Lit.: Herta Hesse-Frielinghaus u.a., „Karl Ernst Osthaus, Leben und Werk“, Recklinghausen 1971.
Oud, Jakobus Johannes Pieter (1890–1963), holländischer Architekt. 1917 Mitbegründer der Künstlerbewegung und Zeitschrift „De Stijl“. Von 1918–33 Stadtarchitekt im Wohnungsbauamt der Stadt Rotterdam: u.a. Wohnblöcke in Spangen (1919–20), Siedlungen in Hoek van Holland (1924–-27) und De Kiefhoek (1925–29), die sich durch eine sorgfältige Durchgestaltung der Alltagseinrichtungen auszeichnen. Lit.: Günther Stamm, „J. J. P. Oud, Bauten und Projekte 1906 bis 1963“, Mainz/Berlin 1984. [41, 42, 138, 158, 159]
Palladio, Andrea (1508–80), italienischer Architekt. Entwickelte eine Villen-Typologie, die Elemente antiker Tempelarchitektur wie Säulenportikus, Symmetrie und harmonische Proportionen auf Wohnhäuser überträgt. Im Veneto schuf er zahlreiche Villen, die einem humanistischen Ideal folgen, u.a. Villa Rotonda (ab 1550). Bedeutende Kirchen in Venedig: San Giorgio Maggiore (1566) und Il Redentore (1576). Lit.: „Vier Bücher zur Architektur“, 1570, deutsch: hrsg. v. Andreas Beyer und Ulrich Schütte, Zürich/München 1984.
Parthenon, Tempel der Athene auf der Athener Akropolis, 447–438 v. Chr. von Iktinos erbaut. Lit.: Manolis Korres, „Die klassische Architektur und der Parthenon“, in: Antikensammlung der SMPK Berlin (Hrsg), „Die griechische Klassik – Idee oder Wirklichkeit“, Mainz 2002, S. 364–373.
Perret, Auguste (1874–1954), französischer Architekt. Perrets Bauten blieben trotz des Einsatzes von Eisenbeton einem klassizistischen Formenrepertoire aus kannelierten Säulen, Andeutungen von Kapitellen und Gesimsen treu: Apartmenthaus in der Rue Franklin (1903), Garage in der Rue de Ponthieu (1906–07), Kirche Notre-Dame in Le Raincy (1922–23), Hôtel de Mobilier National in Paris (1934–36), Musée des Travaux Publics (1936–48). Lit.: Roberto Gargiani, „Auguste Perret 1874–1954, teoria e opere“, Mailand 1993. [98, 217, 221]
Pöppelmann, Matthäus Daniel (1662–1736), seit 1705 Landbaumeister Augusts des Starken; Erbauer des Dresdener Zwinger (1711–22), einem Meisterwerk des Rokoko. Die erfolgreiche Zusammenarbeit von Bildhauer und Architekt ergab eine prachtvolle, geschlossene Wirkung der ganzen Anlage, die allerdings nicht vollendet wurde. 1944 zerstört, wurde der Zwinger nach dem 2. Weltkrieg wiederaufgebaut. Lit.: Hermann Heckmann, „M. D. Pöppelmann (1662–1736), Leben und Werk“, München/Berlin 1972.
R.I.B.A., Abkürzung für Royal Institute of British Architects, entspricht in etwa den deutschen Architektenkammern.
Scheerbart, Paul (1863–1915), Dichter phantastischer Literatur, wirkte u.a. im Kreis der Berliner Expressionisten um Herwarth Walden und dessen Zeitschrift „Der Sturm“. Seine Orientphantasien und Texte über Glasarchitektur beflügelten die Visionen von Architekten und Künstlern um Bruno Taut. Er dichtete für den Kölner Glaspavillon von Taut (1914) launige Reime. Tauts Buch „Alpine Architektur“ verdankt seine Anregungen Scheerbart. Lit.: Mechthild Rausch, „ Paul Scheerbart, 70 Trillionen Weltgrüsse. Eine Biographie in Briefen 1889–1915“, Berlin 1990.
Schinkel, Karl Friedrich (1781–1841), bedeutendster deutscher Architekt des frühen 19. Jahrhunderts. Ab 1815 im Dienst des preußischen Staatsbauamts. Sein streng klassizistischer Stil veranschaulicht mit architektonischen Mitteln die Trennung von tragenden und füllenden Bauteilen: u.a. in Berlin die Neue Wache (1816), das Schauspielhaus (1818–21), das Alte Museum (1822–28) und die Bauakademie (1831–36). Wichtigstes theoretisches Werk sind die Skizzen und Texte zu einem architektonischen Lehrbuch. Lit.: Goerd Peschken, „Das architektonische Lehrbuch“, Band 14 der Reihe: „Karl Friedrich Schinkel. Lebenswerk“, Berlin 1979. [7]
Schmitz, Bruno (1858–1916), Architekt; Erbauer zahlreicher Nationaldenkmäler der wilhelminischen Zeit, so auf dem Kyffhäuser (1896), an der Porta Westfalica (1896), am Deutschen Eck in Koblenz (1897) sowie des Völkerschlachtdenkmals in Leipzig (1898–1913). Für den Wettbewerb Hauptstadt Groß-Berlin (1910) entwickelte er mit Otto Blum und Havestadt & Contag die Vision einer monumentalen Stadt. Lit.: Julius Posener, „Berlin auf dem Wege zu einer neuen Architektur. Das Zeitalter Wilhelms II.“, München 1979, Kapitel „Wilhelminismus“, S. 81–105.
Scott, Baillie M. H. (1865–1945), englischer Architekt, spezialisiert auf Wohnhäuser. Er gewann den Wettbewerb „Das Haus für einen Kunstfreund“, den Alexander Koch, Herausgeber der Zeitschrift „Innendekoration“, 1901 in Darmstadt ausschrieb. Beteiligt hatten sich auch Charles Rennie Mackintosh. 1912 wurde sein Buch „Häuser und Gärten“ bei Wasmuth in Berlin verlegt, in dem er anhand eigener Häuser einfache und wohnliche Räume demonstriert.
Semper, Gottfried (1803–1879), Architekt und Theoretiker; wurde mit seiner Publikation über die Polychromie der antiken Architektur (1834) sowie dem Bau der Dresdener Oper (1838–41) und der Gemäldegalerie im Zwinger (1857–54) bekannt. Wegen seiner Beteiligung am Dresdener Maiaufstand 1949 floh er über Paris nach London. 1855–71 lehrte er am neugegründeten Polytechnikum in Zürich (heute ETH), dessen Hauptgebäude (1858–64) er entwarf. 1871–76 Arbeit am Kaiserforum in Wien. Nach seiner materialistischen Theorie der Stile entstehen Ornamente und Bauformen aus den Techniken der Bearbeitung und Übertragung auf andere Materialien. So entwickelten sich aus der Verkleidung der Konstruktion die sekundären Elemente wie Fassaden, Putz oder Schmuck (Bekleidungstheorie). Hauptschrift: „Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten“, 1860–63. Lit.: Winfried Nerdinger, Werner Oechslin, „Gottfried Semper 1803–1879, Architektur und Wissenschaft“, Zürich/München 2003.
Sesshû Tôyô (1420–1506), japanischer Maler von Landschaften in Tusche. Lebte 1467–69 in China, wo er die Malerei der Song- und der Ming-Dynastie studierte. Sein berühmtestes Tuschebild im Stil des Ming-Meisters Yujian, „Haboku Landschaft“ (1495), suggeriert mit abstrakten, dynamischen Pinselklecksen und -strichen Klippen, Bäume und Häuser. Zu seinem Repertoire gehörten auch fein ausgemalte Szenenbilder.
Sinan (1489?–1588), bedeutendster osmanischer Architekt; erbaute über 300 Moscheen, Schulen, Krankenhäuser, Bäder, Brücken und Paläste. Die Hagia Sophia in Konstantinopel (heute Istanbul) diente ihm als Vorbild für die Entwicklung der Kuppelmoschee: u.a. Süleyman-Moschee in Istanbul (1550–67), Sultan Selim Moschee in Edirne (1569–75). Lit.: Ernst Egli, „Sinan, der Baumeister osmanischer Glanzzeit“, Zürich/Stuttgart 1954 (1974); Wolfgang Voigt (Hrsg.), „Die Moschee von Sinan. Sinan’s Mosque“, Tübingen/Berlin 2008.
Sullivan, Louis Henry (1856–1924), amerikanischer Architekt; Pionier der Chicagoer Schule, die aus den konstruktiven Bedingungen des Stahlskelettes und den funktionalen Anforderungen an ein Hochhaus die sachliche Form zu gewinnen suchte. Seine theoretischen Betrachtungen in „The Tall Office Building Artistically Considered“ (1896) kulminierten in der Formel: „Die Form folgt der Funktion“. Lit.: Sherman Paul, „Louis H. Sullivan. Ein amerikanischer Architekt und Denker“, Bauwelt Fundamente 5, Berlin 1965. [35, 37]
Ueno, Isaburo (1892–1972), japanischer Architekt. 1922 Weiterstudium der Baukonstruktion in Berlin, ab 1924 an der Universität in Wien, anschließend Arbeit im Architekturbüro von Josef Hoffmann. 1925 Rückkehr nach Japan. 1927 Mitbegründer des „Internationalen Architektenbundes in Japan“. Ab 1929 Mitherausgeber der Zeitschrift „Arkitekturo Internacia“, dem Organ des Verbandes. Ueno wurde nach Tauts Weggang aus Japan 1936 dessen Nachfolger im Kogeisho (Werkstatt für kunstgewerbliche Gegenstände) in Takasaki.
Unwin, Raymond (1863–1940), englischer Architekt; Planer und Erbauer der Gartenstädte Letchworth (ab 1903) und Hampstead (1905–14). Sein Ziel war es, einen Bezug zur Landschaft herzustellen sowie das „Gefühl einer lokalen Gebietsgemeinschaft“ mittels einer Ortsmitte, dem Civic Center, hervorzurufen. Sein theoretisches Hauptwerk ist „Town Planning in Practice“ (London 1909, deutsch: „Grundlagen des Städtebaus“, Berlin 1910). Lit.: Mervyn Miller, „Raymond Unwin. Garden Cities and Town Planning“, Leicester 1992.
Uragami, Gyokudô (1745–1820), japanischer Maler, Musiker und Dichter, entstammt einer Samurai-Familie. Um 1790 begann er mit Tusche Landschaften im Stil der Literati zu malen. Überlagerungen von grauer und schwarzer Tusche, von verwaschenen Flächen und scharfen Strichen, ausgefüllt von Linien und Punkten, kennzeichnen die Berglandschaften. Erst im 20. Jahrhundert fanden seine Bilder gebührende Anerkennung. Unter den Bewunderern war auch Bruno Taut.
Van de Velde, Henry (1863–1957), belgischer Architekt und Designer. Ursprünglich Maler, entwarf er als Autodidakt 1895 sein Wohnhaus Bloemenwerf in Uccle bei Brüssel und die gesamte Innenausstattung. Sein organisches Linienornament in der Treppenhalle des Folkwang-Museums (siehe Osthaus) wurde eine Ikone des Jugendstils. Ab 1902 mit der Gründung und Leitung einer Kunstgewerbeschule in Weimar betraut, für die er die Bauten der Kunstschule (1904–11) und die Kunstgewerbeschule (1905–06) entwarf. 1919 ging daraus unter der Leitung von Walter Gropius das Bauhaus hervor. Beim Werkbundstreit 1914 trat van de Velde für die Individualität der Kunst und gegen Hermann Muthesius’ Thesen zur Typenbildung und Industrialisierung ein. Spätwerk: Museum Kröller-Müller in Otterlo (1936–53). Lit.: Henry van de Velde, „Geschichte meines Lebens“, München/Zürich 1986; Klaus-Jürgen Sembach, „Henry van de Velde“, Stuttgart 1989. [26]
Viollet-Le-Duc, Eugène Emanuel (1814–79), französischer Architekt und Theoretiker, einflußreicher Forscher und Restaurator der französischen Romanik und Gotik. Sah in der Gotik eine rationale Bauweise, die aus dem Skelett der Rippen und den membranartigen Füllungen der Gewölbe bestehe. Dieses konstruktive Prinzip übertrug er auf die Eisenskelettkonstruktion seiner Zeit. Veröffentlichungen: „Entretiens sur l’architecture“ (1863/72). Seine theoretischen Überlegungen beeinflußten Antonio Gaudí. Lit.: Bruno Foucart u.a. (Hrsg.), „Viollet-Le-Duc“, Ausstellungskatalog, Galeries nationales du Grand Palais, Paris 1980.
Vitruv (Vitruvius Pollio) (ca. 84 v. Chr.), römischer Architekt und Ingenieur, Verfasser der „Zehn Bücher über Architektur“ (ab ca. 33 v. Chr.), einer Sammlung des technischen und ästhetischen Wissens über die Baukunst seiner Zeit und der griechischen Antike. Deren Wiederentdeckung (Gianfrancesco Poggio Bracciolini) und Drucklegung 1486 in Rom hatte eine nachhaltige Wirkung auf die italienische Renaissance. Lit.: Günther Fischer, „Vitruv NEU oder Was ist Architektur?“, Bauwelt Fundamente 141, Basel/Berlin/Boston 2008.
Wagner, Otto (1841–1918), österreichischer Architekt. Als künstlerischer Beirat beim Bau der Wiener Stadtbahn entstanden bis 1900 zahlreiche Stationsgebäude, Brücken und Viadukte nach seinen Plänen, u.a. das Stationsgebäude am Karlsplatz mit einer eleganten Eisenkonstruktion und Jugendstilornamenten. Beim Wiener Postsparkassenamt (1903–06) wird die sichtbare Montage der dünnen Natursteinplatten zum Fassadenornament (s. Semper: Bekleidungstheorie). Als Lehrer an der Wiener Akademie (1894–1915) war Wagner der einflußreichste Künstler in der Donaumonarchie. Werk: Otto Wagner, „Moderne Architektur. Seinen Schülern ein Führer auf diesem Kunstgebiete“, Wien 1896. Lit.: Otto Antonia Graf, „Otto Wagner, Das Werk des Architekten“, Wien/Köln/Graz 1985. [19, 20]
Wesnin, Alexander Alexandrowitsch (1883–1959), russischer Maler, Bühnenbildner, Architekt; Leitfigur des „russischen Konstruktivismus“, Professor an der WChUTEMAS. 1926–30 Mitherausgeber der Zeitschrift „Sovremennaja Architektura“ („Zeitgenössische Architektur“). Werke: Arbeiterklub- und Theaterhäuser, Warenhaus MOSTORG (1927), Dnjepr-Kraftwerk (1927–32). Wettbewerbsarbeiten: u.a. Palast der Arbeit, Sowjetpalast, Gebäude des Volkskommissariats für Schwerindustrie. Lit.: Selim O Chan-Magomedow, „Alexander Wesnin und der Konstruktivismus“, Stuttgart 1987. [46, 214]
Wright, Frank Lloyd (1867–1959), amerikanischer Architekt; 1888–93 bei Louis Sullivan. In Oak Park und River Forest, Chicago, entwickelte er bis 1910 Einfamilienhäuser für den Mittleren Westen, die er „Prairie Houses“ nannte, u.a. Robie House (1908–10). Während seines Europa-Aufenthaltes 1910 publizierte er bei Wasmuth in Berlin das Mappenwerk „Ausgeführte Bauten und Entwürfe von Frank Lloyd Wright“ (1910/11), das nachhaltigen Einfluß auf deutsche und niederländische Architekten haben sollte. Ab 1911 Aufbau seines Wohnhauses samt landwirtschaftlichem Betrieb in Taliesin, Spring Green, Wisconsin. Sein bekanntestes Meisterwerk: Haus Kaufmann (Fallingwater), Bear Run, Pennsylvania (1934–37). Lit.: Peter Gössel, Gabriele Leuthäuser (Hrsg.), „Frank Lloyd Wright“, Köln 1994. [36, 37, 174]
Yoshida, Tetsuro (1894–1956), japanischer Architekt. Er vertrat eine „moderate“ Moderne, die ihre Vorbilder in Paul Bonatz und Ragnar Östberg sah: Hauptpostämter in Tokio (1929–30) und Osaka (1939). Yoshida war gleichermaßen in der traditionellen japanischen Architektur versiert: Haus Baba in Tokio (1928). Er half Bruno Taut bei der Detaillierung der Gesellschaftsräume der Hyuga Villa in Atami (1935). Veröffentlichungen im Wasmuth Verlag: „Das japanische Wohnhaus“ (1935, 2. Aufl. 1954), „Japanische Architektur“ (1952), „Der japanische Garten“ (1957).
Zeppelin, Ferdinand Graf von (1838–1917), Begründer des Starr-Luftschiffes mit Ganzmetallgerüst. 1898 gründete er eine eigene „AG zur Förderung der Luftschiffe“ und errichtete bei Friedrichshafen am Bodensee eine schwimmende Halle als Zeppelinwerft. Das erste Luftschiff startete am 2.7.1900, insgesamt wurden etwa 100 gebaut. 1909 gründete er zusammen mit Maybach in Friedrichshafen eine Fabrik zur Herstellung von Motoren für Luftschiffe. Am 19.8.1929 landete Zeppelin in Japan.
ARCH+, Di., 2009.10.20
verknüpfte Zeitschriften
ARCH+ 194 Bruno Taut: Architekturlehre