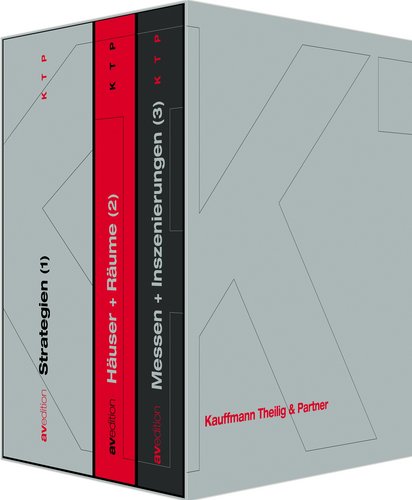Im Stuttgarts denkmalgeschützter Weißenhofsiedlung wurde erstmals seit Jahrzehnten neu gebaut. Werner Sobeks Haus „B10“ ist eine wahre Wundertüte an Ideen.
Im Stuttgarts denkmalgeschützter Weißenhofsiedlung wurde erstmals seit Jahrzehnten neu gebaut. Werner Sobeks Haus „B10“ ist eine wahre Wundertüte an Ideen.
Zur Mittagszeit wird in Stuttgarts berühmter Weißenhofsiedlung aus dem Jahr 1927 unter grauem Himmel ein neues Haus der Öffentlichkeit vorgestellt. Eine kleine Sensation, denn die wiederbelebte Adresse „Bruckmannweg 10“ ist eine alte, geheiligte Brache, erzeugt von einer Fliegerbombe des Zweiten Weltkriegs; die räumte ein Haus des Architekten Richard Döcker gründlich ab. Jahrzehntelang hatten die „Freunde der Weißenhofsiedlung“, die Denkmalpflege und die Kommunalpolitik jedes Neubauvorhaben in der begehrten, grün überwucherten Baulücke zum Sakrileg erklärt, wenn es nicht wenigstens originalgetreu sowohl die alte Wohnfunktion wie auch das verlorene Gebäude wieder herstellen würde.
Jetzt steht dort ein Fertighaus namens „B10“ in minimalistischem Design, entworfen auf der Grundlage eines modularen Systems, das ein schwäbisches Unternehmen als „Flying Space“ anbietet. Ein weißer Bungalow, zusammengefügt in einem Tag aus vorgefertigten Elementen, aber ausgestattet mit einer Menge technischer Features, die es in dieser Konfiguration noch nicht gab. Zur Straße hin ein offener, fließender, voll verglaster Raum; entlang der geschlossenen Rückfront reihen sich Funktionsbereiche mit geringer Tiefe auf: Haustechnik, digitale Gebäudesteuerung, Küchenzeile, Sanitärräume. Diese Box aus Holz, Glas, Metall und einer textilen Bespannung figuriert auch als Prototyp und Grundelement einer neuen Generation des verdichteten Wohnungsbaus. Eine Wohnmaschine? Nicht sofort. Zunächst wird „B10“ ein Jahr lang von jungen Kreativen als kleine Arbeitswelt getestet.
Das Haus ist im Weißenhof- Ensemble also nur Gast: ein „Living Lab“ auf Zeit, konzipiert zur Erforschung und Einübung ressourcenschonender Lebensstile in der Stadt. Ein weites Feld. Das Erscheinungsbild des Bungalows sagt deshalb wenig aus darüber, ob seine künftige Performance, die wissenschaftlich begleitet wird, wirklich die erhofften Impulse geben kann, die 2011 in Deutschland ausgerufene Energiewende endlich in die Städte und Ballungsräume zu bringen - dorthin, wo sie am dringendsten „greifen“ müsste und wo die Verschränkungen von Stadtwohnen und Mobilität nicht nur energetisch und unter dem Aspekt der (zu vermeidenden) Emissionen von größter Bedeutung sind.
Ein Kleinstkraftwerk
Nicht zuletzt ist das Haus ein Kleinstkraftwerk, das auch der Nachbarschaft dient. „Weltweit erstes Aktivhaus“ lautet die Schlagzeile der Pressemitteilung. Das Gebäude - finanziert aus gemeinnützigen und privaten Mitteln - erntet trotz seiner geduckten Position in der Siedlung voraussichtlich doppelt so viel Sonnenenergie, wie es selbst benötigt. Es verfügt über einen Eisspeicher im Boden, über ein automatisiertes, vernetztes, „selbstlernendes“ Gebäudemanagement, das sowohl auf Gewohnheiten der Nutzer reagiert als auch auf die Signale eines angeschlossenen virtuellen Kraftwerks und Prognosen der Wetterdienste. Die Photovoltaik auf dem Dach ist intelligent verschaltet und darüber hinaus kombiniert mit solarthermischen Modulen. Der gewonnene Überschuss an Strom wird einem kleinen Fuhrpark aus E-Mobilen und einem energetisch kaum zu ertüchtigenden Baudenkmal in der Nachbarschaft zugeführt - dem „Großen Corbusier“, jenem Doppelhaus, in dem heute das Weißenhofmuseum untergebracht ist.
Der Ingenieur-Architekt des Hauses „B10“, Werner Sobek, hat für diesen energetischen Altruismus in Stuttgarts bauhistorischem Edel-Kiez den Begriff der Schwesterlichkeit gewählt. Sein Ziel ist, der trägen europäischen Energie- und Umweltpolitik Beine zu machen - mit einem intelligenten Pilotprojekt, öffentlichkeitswirksam platziert an prominenter Stelle und in einem triftigen, aber reichlich komplexen Problemfeld: Man könne, sagt Sobek, weder Jahrzehnte warten, bis der Gebäudebestand unserer Städte energetisch komplett gedämmt sei (mit Materialien, die später als Sondermüll zur Last fallen); noch könne man zulassen, dass delikate Architekturen und schöne alte Quartiere durch isolierende Verpackungsorgien geschändet werden. Wenn aber Neubauten mit positiver Energiebilanz ihre älteren, energetisch schwächelnden Nachbarn „aktiv“ unterstützen, sei viel gewonnen.
Mit erneuerbaren Energien, wenn sie verfügbar sind, kann man großzügig umgehen. Sobeks Strategien sind systemkonform und subversiv zugleich: Am günstigsten, sagt er, seien erneuerbare Energien dort zu produzieren, wo sie gebraucht werden. In der Diktion des Ingenieurs klingt das ganz einfach und plausibel - und nicht wie eine verdeckte Kampfansage an große Energiekonzerne. Jene erkennen schon in der Perspektive einer dezentralisierten Energieversorgung einen Anschlag auf ihre Marktanteile.
Nachhaltigkeit ist ein Wort, das Sobek lieber nicht mehr benutzt. Längst ist es zur billigen Formel verkommen, die nur noch dem „Greenwashing“ fragwürdiger Konsumgewohnheiten und Produktionsweisen dient. Aber selbstverständlich hat Sobek das Haus „B10“ nachhaltig konzipiert - das war sich der Mitbegründer der „Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen“ (DGNB) schuldig.
Das Publikum schmunzelt, wenn jenes kleine E-Mobil, das leger in einem Winkel des Hauses mit dem Heck zur Straße geparkt ist und wie ein exzentrisches Möbelstück wirkt, auf einer Drehscheibe wendet: Eine kleine Aufmerksamkeit für ungeübte Fahrer, die befürchten, bei der Ausfahrt mit dem Auto noch im Wohnbereich anzuecken. Die Idee, dem Auto in der Wohnung ein Ruheplätzchen einzurichten, ist keine Schrulle: Mancher bequeme oder ältere Hausbewohner wird es schätzen, Einkäufe nur den kurzen Weg bis zur Küchenzeile tragen zu müssen. Wie kommt das Auto von der Wohnung auf die Straße und zurück? Über eine hydraulische Mini-Brücke. Der Bungalow ruht - mit Rücksicht auf die kargen Überreste des alten Döcker-Hauses im Untergrund, die als Bodendenkmal unter Schutz gestellt sind - auf einem Stahlrost über dem Boden, getragen von Punktstützen. An dem Rost sind hochklappbare Terrassenelemente aufgehängt, mit denen das Gebäude sich auch schließen lässt. Als geschlossene Box ist das Haus in Abwesenheit der Bewohner maximal wärmegedämmt.
Sobeks „B10“ ist ein wahre Wundertüte an Ideen, Konzepten und Funktionskreisläufen. Alle haben mit menschlichen Wohnbedürfnissen im weitesten Sinne zu tun - dem Wohnen zu Hause, dem Leben in der Nachbarschaft, dem Alltag in der Stadt. Und alle ordnen sich dem Prinzip Verantwortung unter: der Verantwortung, die jeder Einzelne für unsere gefährdete Lebenswelt mitträgt.
Parallel zu den Feierlichkeiten am Weißenhof zur Premiere von „B10“ macht die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in Peking das geschmeidige Wort „Nachhaltigkeit“ zum Thema eines Vortrags an der Tsinghua-Universität. Es bietet ihr die Chance, bei den chinesischen Studenten Reklame für etwas mehr Demokratie zu machen - diplomatisch und unverbindlich. Das konnte sie in den 90er-Jahren als Umweltministerin im Kabinett Helmut Kohls schon gut üben. Im „B10“ zu Stuttgart läuft derweil eine frohe, recht deutlich gesprochene Videobotschaft des schwäbischen EU-Kommissars für Energie, Günter Oettinger. Er war einst Ministerpräsident in Baden-Württemberg, dem seine Automobilindustrie besonders am Herzen liegt. Möglicherweise hat ihn am Haus „B10“ am meisten fasziniert, dass es Teil eines Forschungsprojekts „Schaufenster Elektromobilität“ ist.
Der Standard, Fr., 2014.08.08
![]()