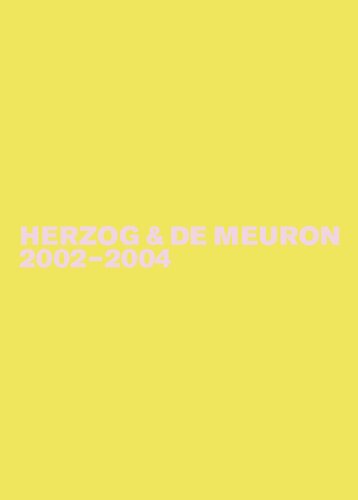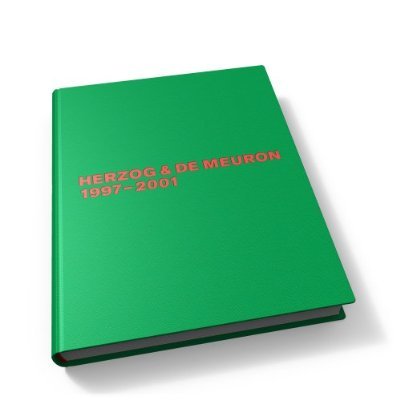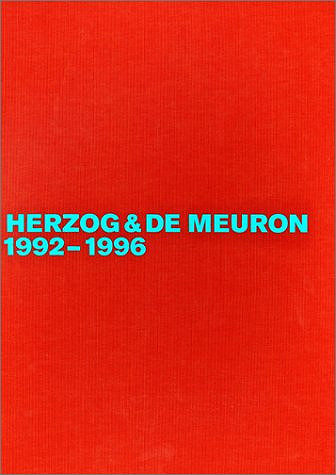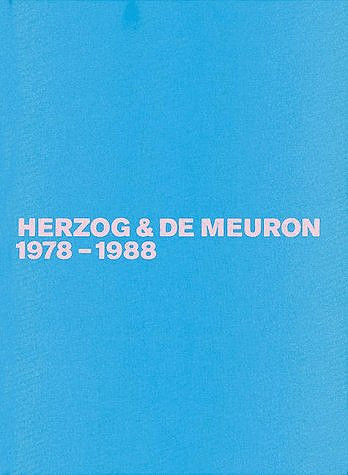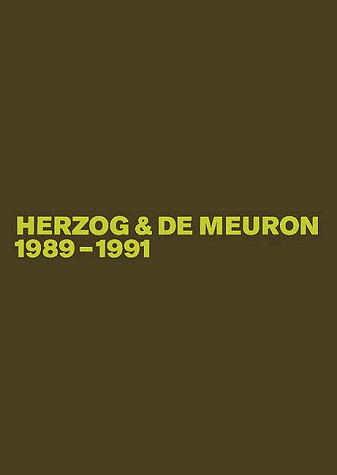Industrie – Kultur
Das neue Toni-Areal ist weit mehr als das dritte Hochschulzentrum in Zürich. EM2N Architekten haben den Koloss aus Beton und Stahl in ein offenes Kulturforum umgebaut.
Das neue Toni-Areal ist weit mehr als das dritte Hochschulzentrum in Zürich. EM2N Architekten haben den Koloss aus Beton und Stahl in ein offenes Kulturforum umgebaut.
Als die Toni-Fabrik 1977 in Betrieb genommen wurde, galt sie als modernste Molkerei Europas. Nur 22 Jahre später wurde sie wegen Überkapazität geschlossen, und die Anlagen wurden nach Osteuropa verkauft. Die Swiss Dairy Food ging in der Folge pleite, und die Zürcher Kantonalbank erwarb die Liegenschaft 2005. Eine Begutachtung ergab, dass ein Rückbau nicht sinnvoll gewesen wäre (vgl. «Tragendes Potenzial», S. 23). Das hielt auch eine Stellungnahme des Zürcher Stadtrats zum Gestaltungsplan für eine Umnutzung fest: Das Toni-Areal wurde als «Anker» für das boomende Zürich West bewertet, seine industrielle Erscheinung und die Volumetrie aus Hochhaus und Flachbau, Rampe und robuster Tragstruktur müssten auch künftig erkennbar bleiben.
Eine konkrete Lösung zeichnete sich ab, als der Kanton eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gab, um darin einen Teil seiner Hochschulen unterzubringen. Die Hochschule Musik und Theater Zürich und die Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich sollten zur Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) fusionieren. Bevor dies 2007 umgesetzt wurde, schrieb man einen Studienwettbewerb für das Toni-Areal aus, der 2005/06 durchgeführt und vom Zürcher Architekturbüro EM2N für sich entschieden wurde. Der lange Planungs- und Bauprozess widerspiegelt auch die Situation einer neuen Hochschule, die ihr Selbstverständnis erst noch entwickeln und darin lieb gewonnene Traditionen ihrer beiden Vorgängerinnen integrieren oder abstossen muss. Auch die Terrainkämpfe von Departementen und Fraktionen, die bei einem solchen Prozess kaum zu vermeiden sind, gehören dazu. Die Gewissheit, dass man sich zusammenraufen müsse, weil ein Umzug an einen einzigen Ort unausweichlich bevorsteht, dürfte diesen Prozess wesentlich mit vorangetrieben haben. Die Architekten und ihr Entwurf für die Umnutzung des Industriebaus spielten die Rolle eines Katalysators zum Selbstverständnis der neuen ZHdK. Dass auch Departemente der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), die fachlich nichts mit der Kreativschmiede zu tun hatten, ihren Platz darin finden sollten, machte die Planungsaufgabe nicht einfacher.
1400 Räume auf 108 000 m² Nutzfläche
Die planerischen Hürden sind überwunden, die Bauherrin Allreal, die die Liegenschaft 2007 von der ZKB übernahm, und der Kanton als Mieter haben hier samt Ausstattung 775 Mio. Franken verbaut. Der Koloss hat eine Haut aus gewellten und grüngrau getönten Streckmetallpaneelen erhalten, die seine Unförmigkeit zu einer Figur aus liegendem und stehendem Element vereinen, ansonsten aber auf künstliche Gestaltungselemente verzichtet. Mit dem neuen Studienjahr öffnen diesen September 2014 die beiden Hochschulen ihre Tore. Die ZHdK hat 37 Aussenstellen am neuen Hauptsitz zusammengezogen. Die ZHAW führt die beiden Departemente Soziale Arbeit und Angewandte Psychologie zusammen. 5000 Studierende und Lehrende werden in dem Bau ihrer Beschäftigung nachgehen. Das ist die Bevölkerungszahl einer nicht mehr ganz kleinen Ortschaft in der Schweiz. Dazu kommen die hundert Wohnungen, die auf das bestehende Volumen draufgepackt sind und von der Bauherrin Allreal bereits zum Grossteil vermietet wurden.
Die Architekten EM2N nutzen auch die Topografie der Stadt als naheliegendes Konzept, um den riesigen Gebäudekomplex organisatorisch in Griff zu bekommen. 108 000 m² Nutzfläche waren vom Parkdeck bis zu den Wohnungen im 22-geschossigen Turm unterzubringen. Ein spezifischer Industriebau musste für die Bedürfnisse von Hochschulen und ihnen angegliederten Werkstätten und Kulturinstituten vom Jazzkeller bis zum Sinfoniesaal umgebaut werden. Über 1400 Räume mussten so angeordnet werden, dass das Labyrinth auch bei Hochbetrieb leicht erschliessbar ist. Das geschieht mit einer Signaletik aus Buchstaben und Zahlen, die Biv & Hi teilplastisch auf die Wände aufgebracht haben. Vor allem aber macht die klare Struktur des öffentlichen Raums – das heisst die T-Form aus Halle und Kaskadentreppe sowie das angehängte äussere, rückseitige Boulevard in Form einer Rampe – den Bau übersichtlich.
Städtebauliche Anleihen im Innenraum
Wer aus dem Tram steigt und sich über eine Rampe mit Treppe zum Eingang begibt, betritt eine riesige Halle, die den Bau in seiner Breite über 90 m durchstösst. Hier befinden sich Mensa und Café, aber auch Hörsäle und der Zugang zum Ausstellungstrakt, den das Museum für Gestaltung im Toni-Areal betreibt. Mit der darunter untergebrachten Schausammlung von 500 000 Objekten vom Plakat zum Möbelstück und der darüber gelegenen Handbibliothek bildet sie im ehemaligen Trockenwerk einen sechsgeschossigen Informationscluster, der real und auch bildhaft die Basis für die Hochschultätigkeiten legt. Während diese Halle ein städtischer Platz ist, führt auf der gegenüberliegenden Seite des Ausstellungstraktes eine Kaskadentreppe über die ganze Länge des Flachbaus als Avenue in die oberen Stockwerke. Sie erschliesst die verschiedenen Bereiche der ZHdK, die hier andocken, und entfaltet einen eigenen Raumcharakter. Fünf Höfe, die in das Volumen eingeschnitten wurden, um Tageslicht ins Gebäudeinnere zu bringen, weiten den Blick. Die mittlere Etage ist als Plaza ausgeführt, die für Events und Ausstellungen genutzt werden kann. Eine Holzverkleidung macht die Treppenstufen zu Arena-Sitzplätzen. Am Semesterende werden die anliegenden Ateliers der Studierenden geöffnet, und der Bereich wird zu einer Ausstellungsszenerie für ihre Arbeiten. Brandschutztechnisch wurde die Lösung möglich, weil Fluchtwege von den angrenzenden Räumen nach hinten über separate Treppenhäuser geführt werden.
Wer diese Avenue verlässt, gelangt über Flure zu den Atelier- und Übungsräumen der Studierenden an den Aussenseiten des Baus und zu den funktionsgebundenen Räumen der Departemente im Innern. Diese wurden vertikal und horizontal nach funktionalen Verwandtschaften angeordnet. So bedient der Technikraum mehrere Tonstudios ebenso wie Konzerträume, Kino und Jazzclub auf verschiedenen Stockwerken. Solche Cluster für Ton, Fotografie, Ballett, Bühne sind wie Quartiere zusammengefasst. Die Flure, die sie umgeben, weisen leichte Knicke und Niveauunterschiede auf, die Quartierwechsel markieren und der besseren Orientierung dienen, ganz ähnlich wie man es von Strassen und Gassen kennt. Die Unterschiedlichkeit des Raums wird überdies durch ein Lichtkonzept betont, das eine Vielzahl von Stimmungen suggeriert. Die Beleuchtung der öffentlichen Zonen wechselt. Cafés und Mensa sehen von der Eingangshalle so aus, als ob man in einen geschlossenen Raum mit eigener Atmosphäre blicken würde, wie man es als Passant von der Strasse einer Stadt auch tut.
Von der Grossmolkerei zur Kulturfabrik
Diese Orientierung am grösseren öffentlichen Massstab findet sich auch in der Ausgestaltung des Gebäudes. Die Architekten suchen die industrielle Identität wachzuhalten, obwohl ausser der Tragstruktur nicht viel von der ursprünglichen Substanz bewahrt werden konnte: neue Industrieböden, zumeist aus Beton oder uni grauem Linoleum, aber auch aus Holz, wo Akzente gesetzt werden sollen, weiss oder hellgrau gestrichene Wände und Decken, an denen die massive Tragstruktur ablesbar bleibt und die Leitungen sichtbar montiert sind. Die überwiegende Zahl der Räume ist multifunktional angelegt und neutral gehalten. Das gelingt meistens, bedauerlich ist die planerische Zurückhaltung jedoch bei den Museumsräumen, die unentschieden bleiben zwischen White Cubes und blossen Containern. Hier wird spürbar, welche Begrenzungen die bestehende Tragstruktur und die Anforderungen der Haustechnik der Raumgestaltung setzten. Neu eingezogene Decken und verbreiterte Stützpfeiler, die nötig waren, um die zusätzlichen Geschosse für das ehrgeizige Raumprogramm zu tragen, ziehen enge Grenzen. Der neue Hochschulkomplex ist auch ein hervorragendes Beispiel für die Absurdität heutiger Baunormen, die zahllose Kabel- und riesige Lüftungsschächte erforderlich machen und damit beispielsweise Ausstellungsräume verunklärten.
Unübersehbar ist die Neugierde der Architekten auf die Stadt. Am auffälligsten wird sie bei der rückseitigen Anlieferungsrampe. EM2N haben sie in einen Kulturboulevard umfunktioniert, der das Rückgrat des neuen Zentrums bilden soll. Am hinteren Ende zur Förrlibuckstrasse gelegen, lädt er zum Flanieren ein. Die Strassenlampen, die man hier montierte, haben das Potenzial, den Ort in eine südländische Promenade zu verwandeln. Über die Rampe gelangt man zu den Kulturinstituten, die die Architekten so platziert haben, dass sie auch unabhängig vom Hochschulbetrieb funktionieren. Der Jazzkeller liegt unter der Erde, seine Bar leuchtet durch ein Fensterband unter der Rampe nach oben. Wer weiter hinaufgeht, trifft auf ein professionell ausgestattetes Kino, eine Etage weiter auf zwei kleinere Musiksäle für elektronische Musik und für Orgel, einen Ausstellungsraum und am Ende der Rampe auf den grossen Konzertsaal. Ihm ist ein gedecktes Foyer im Freien vorgelagert, von dem eine Treppe auch auf die Dachterrasse führt. Wie bedeutend dieses Rückgrat für das Konzept der Architekten ist, macht die edlere Gestaltung dieser Räume deutlich, etwa mit spiegelndem Chromstahl oder schwarzen Cupolux-Paneelen bei den kleinen Konzertsälen. Das neue Hochschulzentrum will auch eine Kulturfabrik sein und macht seine Tore weit zur Stadt hin auf.
TEC21, Fr., 2014.09.26
verknüpfte Zeitschriften
TEC21 2014|39 Toni-Areal Zürich