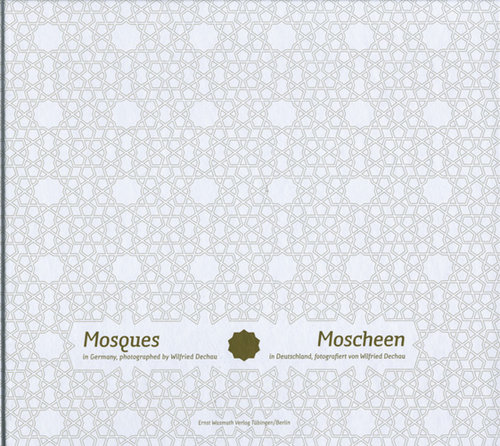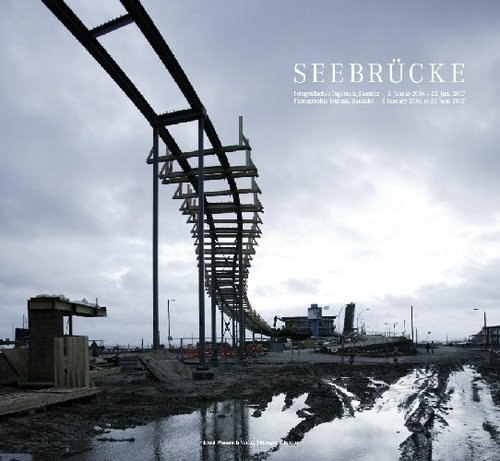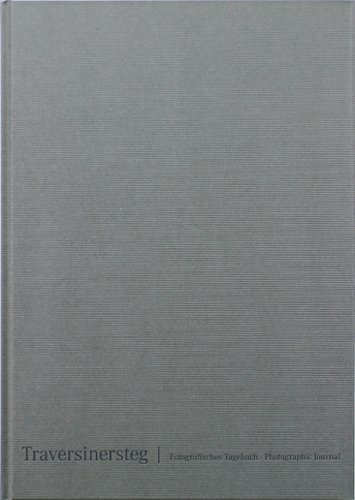Grazil übers Wasser
Für die Landesgartenschau Bamberg 2012 wurde eine ganze Familie konstruktiv ähnlich konzipierter, ungewöhnlich schlanker Brücken gebaut. Der jüngst mit dem Brückenbaupreis ausgezeichnete Erba-Steg wird hier pars pro toto vorgestellt. Er hat bei 48 m Spannweite in Feldmitte eine Bauteildicke von lediglich 37 cm.
Für die Landesgartenschau Bamberg 2012 wurde eine ganze Familie konstruktiv ähnlich konzipierter, ungewöhnlich schlanker Brücken gebaut. Der jüngst mit dem Brückenbaupreis ausgezeichnete Erba-Steg wird hier pars pro toto vorgestellt. Er hat bei 48 m Spannweite in Feldmitte eine Bauteildicke von lediglich 37 cm.
2002 bekam die Stadt Bamberg den Zuschlag für die Landesgartenschau 2012 – und damit die Chance, das seit Längerem brachliegende Gelände der Erlanger Bamberger Baumwollspinnerei und -weberei (Erba) zu revitalisieren. 2007 wurde ein Ideen- und Realisierungswettbewerb ausgeschrieben. Gewonnen hat ihn das Landschaftsarchitekturbüro Brugger. Nach deren Plänen durchschlängelt der »Fischpass« das Gelände – ein natürlich anmutender, de facto aber künstlich angelegter, der Rinne eines Regnitz-Altarms folgender Bach. Sechs von Johann Grad entworfene Brücken queren den Wasserlauf. Den eindrucksvollsten Auftritt hat der Erba-Steg. Nahe der Mündung in die Regnitz schwingt er sich mit einer Spannweite von 48 m über den Fischpass.
Mir ist nur eine Fußgängerbrücke bekannt, die im Scheitel ähnlich aufregend dünn ist: die Pont d'en Gómez in Girona, sie wurde 1916 (!) nach Plänen des Architekten Luis Holms in Stahlbeton errichtet. Sie ist allerdings so schmal, dass tatsächlich nur Fußgänger passieren können. Der Erba-Steg und die anderen Bamberger Gartenschaubrücken sind hingegen so bemessen, dass sie im Notfall auch von Einsatzfahrzeugen befahren werden können.
Der Landesgartenschau-Rummel (26. April bis 7. Oktober 2012) ist längst rum. Was blieb, ist ein erfolgreich zur Parklandschaft umgestaltetes Industriebrachland. Dass eine Gartenschau dafür instrumentalisiert wird, ist nichts Ungewöhnliches; dass dafür die Landschaft neu modelliert wird und einige anmutige Brücken gebaut werden, ebenfalls nicht (siehe LGA Pforzheim 1992, IGA Rostock 2003). Man könnte es abhaken, wären da nicht die drei Fußgänger- und drei Fahrbrücken, die – konstruktiv miteinander verwandt – als ganze Brückenfamilie entstanden sind. Allen voran der Erba-Steg, der – leicht modifiziert – bereits an anderer Stelle in Bamberg Brückenbaugeschichte schrieb.
Nämlich als Brückenprovisorium, das ab März 2009 benötigt wurde, um während der Bauzeit der Kettenbrücke wenigstens den Fußgängern die Überquerung des Main-Donau-Kanals zu ermöglichen. Normalerweise sieht so etwas so grobschlächtig aus, wie es das Wort Behelfsbrücke nahelegt. In diesem Falle nicht. Denn dem Architekten Matthias Dietz ist es gelungen, die Stadtväter davon zu überzeugen, den Behelf gleich mit Blick auf eine mögliche Zweitnutzung zu bauen. So kamen die Bamberger erstens zu einem ungewohnt eleganten Notbehelf und zweitens zu einer verblüffend schlanken Fußgängerbrücke zur Erschließung des ehemaligen Industrie-Areals. Als die Kettenbrücke (ebenfalls vom Ingenieur Johann Grad) fertig und für den Verkehr freigegeben war, musste die Hilfsbrücke nur noch in zwei Teile zerlegt, zum Erba-Gelände transportiert und dort von Autokränen aus wieder aufgebaut werden.
Dem Schiffsbau entlehnt
Die kleinen, feinen Brücken mögen auf den ersten Blick selbstverständlich und bescheiden wirken, und doch haben sie im Brückenbau neue Maßstäbe für Eleganz, Leichtigkeit und Grazilität gesetzt. Dabei wurde keineswegs mit High Tech Materialien gearbeitet – weder mit GFK noch mit Karbonfaserwerkstoffen, sondern, ganz ohne Tricks, mit ganz normalem Stahl. Das Prinzip seiner Konstruktion ist – wie alles Geniale – letztlich ganz einfach. Nummer eins: Man nehme zwei Auflager und spanne das Tragwerk fest ein. Dass sich die Schlankheit dadurch signifikant beeinflussen lässt, weiß man noch aus der Statikvorlesung (q·l2/8 versus q·l2/24). Nummer zwei: Man füge das Tragwerk – wie beim Schiffbau – aus Schotten, Spanten und Planken zusammen und verschweiße den Korpus.
Das Prinzip, eine Konstruktion durch Einspannen zu verschlanken, hat auch Calatrava bei seiner anfangs so hoch gelobten Brücke in Venedig zu nutzen gewusst. Leider am falschen Ort. Denn als Nummer drei muss der Vollständigkeit halber angefügt werden: Der Baugrund sollte mitspielen. Und da darf man im Falle Venedigs so seine Zweifel haben.
Die Bamberger Gartenschaubrücken sind einander vom Typus her sehr ähnlich, sie unterscheiden sich lediglich hinsichtlich ihrer Dimensionen, der Tragfähigkeit und einiger Details der Ausführung. Daher der Begriff: Brückenfamilie. Der von Johann Grad entwickelte Prototyp so eines integralen Systems mit beidseitiger Volleinspannung quert als Fußgängerbrücke die Altmühl in Eichstätt. Der Altmühlsteg geht auf einen 2007 gewonnenen Wettbewerb zurück und war beim Brückenpreis 2010 unter den Nominierten.
Die Volleinspannung wird durch schräg gestellte Stabverpresspfähle gewährleistet, die auf Zug und Druck beansprucht werden. Die statisch wirksame Höhe des im Schnitt dreieckigen Brückentragwerks kann durch die Einspannung in Feldmitte extrem gering gehalten werden. Entsprechend dem Zuwachs der Biegemomente nimmt die Brückendicke zum Auflager hin kontinuierlich zu. Für die Fußgängerbrücken wurden Stahlelemente mit einer Blechdicke von 12 mm luftdicht zu einem torsionsfreien Tragwerk verschweißt. Die äußerlich ebenso aussehenden Fahrbrücken unterscheiden sich durch eine verborgen bleibende statische Besonderheit von den Fußgängerbrücken: Sie wurden als Stahlverbundbrücken ausgeführt. Die in diesem Fall 20 mm dicken, seitlichen Flanken des Tragwerks werden mit aufgeschweißten Kopfbolzen zur Verbundwirkung herangezogen. Das V-förmige Stahlelement wird im Werk hergestellt. Es dient zugleich als Schalung für den Aufbeton. Kombiniert mit beidseitiger Volleinspannung ermöglicht der Flächenverbund sogar für eine 60-t-Belastung, das heißt, für die höchste Brückenklasse, eine extrem schlanke Ausführung. Die 16 m überspannende Straßenbrücke hat in Feldmitte z. B. eine Bauteildicke (Stahlblech plus Beton) von 25 cm, das heißt, sie ist mit l/64 ungewöhnlich schlank. Für Bauwerke dieser Art waren früher Zulassungen im Einzelfall erforderlich, aber inzwischen ist die Bauweise in den DIN-Fachberichten geregelt und zugelassen.
So lassen sich auch Straßenbrücken mit deutlich größerer Spannweite realisieren. Ein Musterbeispiel konnte Johann Grad in Vohburg realisieren. Leider kann er die Erfolgsgeschichte seiner innovativen Bauweise nicht mehr persönlich weiter vorantreiben. Er ist am 18.6.2013 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.
db, Mo., 2014.05.19
verknüpfte Zeitschriften
db 2014|05 Ingenieurbaukunst