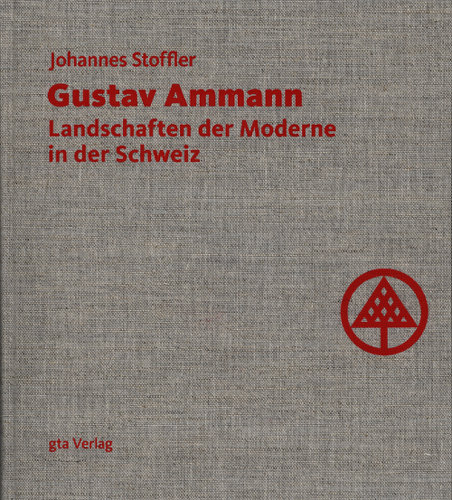Unbequemes Erbe
Die Feindbilder von einst sind inzwischen Gegenstand der Denkmalpflege. Doch die zeugnishafte Bedeutung der Aussenanlagen von Grosssiedlungen ist bisher nur ungenügend gewürdigt worden. Wir brauchen qualifizierte Entwicklungskonzepte, Garteninventare und mehr Forschung.
Die Feindbilder von einst sind inzwischen Gegenstand der Denkmalpflege. Doch die zeugnishafte Bedeutung der Aussenanlagen von Grosssiedlungen ist bisher nur ungenügend gewürdigt worden. Wir brauchen qualifizierte Entwicklungskonzepte, Garteninventare und mehr Forschung.
«Eine Zukunft unserer Vergangenheit!» lautete das Motto des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975. Unter der Schirmherrschaft des Europarats hatte sich erstmals auf internationaler Basis eine gesellschaftlich breit abgestützte Protestbewegung formiert, welche die Städtebaupolitik der Nachkriegszeit lautstark kritisierte. Statt Flächensanierung forderte man eine bewahrende Stadterneuerung. Die Politik griff den Protest auf und erliess die bis heute bestehenden Denkmalschutzgesetze.
Wirft man einen Blick in den Katalog der zum Denkmaljahr gehörigen Ausstellung, so tritt vor Augen, woran sich der Unmut vor fast 40 Jahren entzündete. In plakativen Bildern waren hier die Grosssiedlungen der Nachkriegsmoderne mittelalterlichen Altstädtchen wertend gegenübergestellt. Nicht ohne Polemik wurden Grosssiedlungen als Produkte einer entgleisten Moderne dargestellt, die regionale Bezüge und Traditionen, aber auch die Menschen selbst aus dem Auge verloren hatten. Dieses Verständnis traf nicht nur den Nerv der Mehrheit der Denkmalpfleger, sondern bediente auch die sentimentalen und bisweilen heimattümeligen Sehnsüchte der breiten Öffentlichkeit.
Inzwischen ist die Auslegeordnung unübersichtlicher und der Denkmalbegriff erweitert worden. Die schmucken mittelalterlichen Riegelhäuschen sind Bestandteil von komplexen Denkmallandschaften geworden, die zeitlich weit in das 20. Jahrhundert reichen und nun auch Zeugen der Moderne und der Industriekultur umfassen. Die Ironie der Geschichte will es, dass inzwischen ausgerechnet die Feindbilder von damals – die Grosssiedlungen der Nachkriegsmoderne – zu potenziellen Schutzobjekten der Denkmalpflege avanciert sind. Während aus fachlicher Sicht die zeugnishafte Bedeutung mancher dieser Ensembles im wahrsten Sinne des Wortes kaum übersehbar sind, halten die breite Öffentlichkeit und auch die Politik mit dieser Entwicklung nur mühsam Schritt. Umso wichtiger wird es, die Bedeutung dieser Siedlungen verständlich zu erklären und aktiv Aufklärungsarbeit zu betreiben.
Sorgfältige Entwicklung
Grosssiedlungen sind oftmals multifunktionale Kleinstädte im Grünen. Während manche mit banalem Abstandsgrün aufwarten, finden sich auch gestalterisch herausragende Beispiele. So bietet der Koloss Liebrüti in Kaiseraugst bei Basel (1966–1979) neben verschiedensten Wohntypen und Gemeinschaftseinrichtungen auch eine ungewöhnliche Vielfalt an Aussenräumen an. Gemeinsam mit den Architekten Schachenmann & Berger schuf hier Helmut Vivell einen Stadtplatz, Spiel- und Ruheplätze, Einzelgärten, Gartenhöfe und Parkflächen in kluger Kammerung. Wie Liebrüti bildet auch bei der Wohnsiedlung Grünau in Zürich (1972–1977) der Park das eigentliche Zentrum der Anlage. Auch hier wurde der Aushub nach Entwürfen von Willi Neukom zu einer expressiven Topografie aufgetürmt – ein kunstvolles und nutzbares Gegenüber der Grossbauten.
Doch längst haben sich bauliche Mängel bei den Siedlungen bemerkbar gemacht. Während energetische Sanierungen nur die Gebäude betreffen, stellen statische Probleme bei Tiefgaragen mancherorts ganze darüberliegende Parklandschaften in Frage.
Hinzu kommen veränderte Nutzungsgewohnheiten der Bewohner im Aussenraum, heruntergekommene Möbel und Infrastrukturen und ein Pflanzenbestand, der von jahrzehntelanger Totalpflege durch Hauswartungsfirmen arg gezeichnet ist. Um verloren gegangene gestalterische Qualitäten wiederzugewinnen, wären Entwicklungskonzepte notwendig, die – einem Parkpflegewerk vergleichbar – auf der Basis des historisch Gewachsenen und aktueller Nutzungsbedürfnisse eine Perspektive für den dauerhaften Erhalt des wertvollen Zeugen eröffnet.
Wissen aufbauen
Dass aber auch Grosssiedlungen und insbesondere ihre Aussenräume Denkmale sein können, ist ihren Eigentümern nur mit Mühe plausibel zu machen. Wenig förderlich dabei ist, dass gartendenkmalpflegerisches Fachwissen in den zuständigen Denkmalpflegeämtern der Schweiz immer noch die Ausnahme ist – und dies, obwohl Garten und Grünfläche die massgeblichen Leitmotive für die letzten 100 Jahre im Städtebau des Landes waren.
Auch können Planer bisher wenig auf Erfahrungen und fast gar nicht auf Grundlagenforschungen zum Thema aufbauen. Es existieren bisher nur wenige substanzielle gartenhistorische Arbeiten zur Epoche und fast gar keine Beiträge zur angewandten Forschung in diesem Bereich. Wer ernst genommen werden will, muss mehr vorzuweisen haben.
Mit der Erweiterung des Bau- und Garteninventars um die Epoche 1960 bis 1980 hat sich die Stadt Zürich vergangenes Jahr (2013) den anstehenden Problemen gestellt. Wegweisend war dabei die gemeinsame Inventarisierung der Ensembles durch Bau- und Gartendenkmalpflege, zumal erfahrungsgemäss der Aussenraum ohne die Gebäude nicht erhalten werden kann. Zugleich beteiligt man sich an anwendungsorientierter Forschung. Gemeinsam mit der Hochschule Rapperswil und dem Verfasser dieses Artikels erarbeitet die Stadt den Leitfaden «Fliessendes Grün» zur Wiederbepflanzung von Grünflächen des organischen Städtebaus 1940 bis 1970, unterstützt von der Stiftung zur Förderung der Denkmalpflege.
Ob die im Inventar verankerten Bemühungen um den Erhalt der neuen Denkmalgruppe der Stadt Zürich erfolgreich sein werden, bleibt abzuwarten. Die Stadt hat sich der Problematik des sperrigen Erbes jedoch fachübergreifend gestellt.
anthos, Mo., 2014.02.24
verknüpfte Zeitschriften
anthos 2014/1 Grosssiedlungsgrün