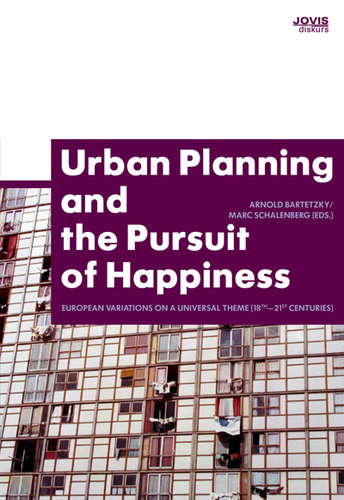Johanna-Moosdorf-Schule in Leipzig
Neue Schulen entstehen oft ohne Bezug zum baulichen Kontext. Anders die Johanna-Moosdorf-Schule in Leipzig, deren Architektur aus dem städtebaulichen Zusammenhang entwickelt ist. Ein wegweisender Ansatz für eine wachsende Stadt.
Neue Schulen entstehen oft ohne Bezug zum baulichen Kontext. Anders die Johanna-Moosdorf-Schule in Leipzig, deren Architektur aus dem städtebaulichen Zusammenhang entwickelt ist. Ein wegweisender Ansatz für eine wachsende Stadt.
Plötzlich steht da dieser voluminöse Neubaukomplex an der Kreuzung der Philipp-Rosenthal- und Prager Straße im Südosten Leipzigs, an der ich öfters vorbeifahre. Dass ich seine Errichtung bisher kaum wahrgenommen habe, liegt wohl zum einen an der für heutige öffentliche Projekte dieser Größenordnung geradezu sensationell kurzen Bauzeit – gut zwei Jahre nach dem ersten Baggerstich wurde die für bis zu 1 400 Schüler geplante Johanna-Moosdorf-Schule im Sommer 2024 fertiggestellt. Zum anderen vielleicht auch an der unmittelbaren Nachbarschaft eines geschützten Biotops mit einem dichten Knäuel aus Bäumen und Sträuchern, das die Sicht auf den Hauptbaukörper etwas einschränkt. Trotzdem ist der kantige Siebengeschosser, das höchste Schulgebäude Leipzigs, nicht zu übersehen, wenn man vom Süden auf die Stadt zufährt.
Harte Kanten, lebendige Oberflächen
Ein Blickfang der beiden der Kreuzung zugewandten Fassaden sind große, mittig unter der Dachkante angebrachte Uhren. Ihre runden Zifferblätter wirken wie ein Gruß aus der Vergangenheit, in der die Information über die Uhrzeit noch als öffentliche Fürsorgeaufgabe galt. Sonst ist der Bau aber – wie von seinen für rationale Lösungen bekannten Entwerfern nicht anders zu erwarten – ziemlich unnostalgisch, auch wenn er mit dem Raster horizontal angeordneter großer Fenster Assoziationen an die frühere Leipziger Industriearchitektur wecken kann. Die stellen sich besonders beim Anblick der langen, in der Höhe um zwei Geschosse reduzierten Front an, die der Bauflucht der Prager Straße folgt.
Auf der gegenüberliegenden Seite des spitzwinkeligen Grundstücks schließt sich an der Philipp-Rosenthal-Straße ein Baukörper von ähnlichen Dimensionen an, in dem zwei Dreifeld-Sporthallen übereinandergestapelt sind. Die Verbindung stellt ein dreigeschossiger Brückenbau her, der den Hauptzugang ins Gebäude und zum Innenhof überfängt. Mit ihren Dimensionen behauptet sich die Schule im städtebaulichen Umfeld, das vor allem von den Großhallen des früheren Messegeländes und ihren Nachfolgebauten geprägt ist. Zu dieser Nachbarschaft passt auch die formale Strenge des Neubaukomplexes. Besonders der Sporthallen-Kubus lässt an einen Gewerbebau denken.
Die Härte der Baukörper wird durch das Fassadenmaterial gemildert. Klinker in verschiedenen Gelbtönen – ein in der Leipziger Bautradition heimisches Material – beleben die Mauerflächen der Obergeschosse. Die Sockelzonen an den Straßenfronten sind mit Travertin verkleidet. Das bringt Abwechslung, geht aber etwas zulasten der gestalterischen Kohärenz, zumal die Natursteinplatten entgegen der Intention der Entwerfer nicht verfugt sind und deshalb appliziert wirken, statt den Eindruck von Massivität zu erzeugen.
Wie einige andere Schönheitsfehler der Ausführung ist dieser Makel eine Folge des Verfahrens. Das im Schulbau erfahrene Leipziger Architekturbüro Schulz und Schulz, das den Zuschlag in einem Vergabeverfahren erhalten hatte, war nur für die Planungsaufgaben der Leistungsphasen I–IV verantwortlich, während die Ausführung in den Händen eines Generalübernehmers lag. Damit sollte die Einhaltung des Zeit- und Kostenrahmens sichergestellt werden – eine naheliegende Idee in Anbetracht der Zeitnot, unter der in Leipzig Schulen gebaut werden müssen, die allerdings die Gefahr birgt, dass manch ein gutes Detail des Entwurfs auf der Strecke bleibt.
Wohnliche Lernlandschaften
Dennoch ist der Bau insgesamt auch materiell und bautechnologisch von einer Qualität, die einen Standard für künftige Schulen setzen sollte. So hat die Stadt als Bauherrin zum Glück die (moderaten) Mehrkosten für das zweischalige Mauerwerk mit Vollziegeln akzeptiert. Das ist nicht nur schöner, sondern auch nachhaltiger als mit Styropor verpackter Beton. Die soliden Holzfenster setzen einen wohnlichen Akzent im Innern, ebenso wie die mit Holz verkleideten Sitznischen. Schallschluckende Holzdecken kamen nicht nur in Klassenräumen, Mensa und Aula, sondern, über die Norm hinausgehend, auch in den Verkehrsbereichen zum Einsatz.
Bei unserem Besuch besteht ein zu einer Aufenthaltszone geweiteter Flur den Lärm-Stresstest in der Pause. Während Kindergruppen fröhlich kreischend um uns herum ihren Bewegungsdrang ausleben, entspinnt sich ein Gespräch mit dem Schulleiter über den Einfluss von Raumtypen auf Lernverhalten und Persönlichkeitsbildung. Sein Ideal ist die »Clusterschule« mit flexiblen, miteinander verschränkten Räumen für verschiedene Lernformen und Pausenaktivitäten. Die noch im Aufbau befindliche Johanna-Moosdorf-Schule ist zwar noch dem traditionellen Typ der »Flurschule« mit aneinandergereihten, für frontalen Unterricht konzipierten Klassenräumen verhaftet, sie bietet aber auch »offene Lernlandschaften«. Beklemmend lange, trübe Flure findet man hier nicht. Die Nutzfläche von 12 500 m² ist so geschickt in dem winkelförmig angeordneten Komplex verteilt, dass keine monotonen Raumfolgen entstehen. Durchgehende Lichthöfe führen auch den Treppen und Fluren in den unteren Geschossen Tageslicht zu. Die Verkehrsbereiche, in denen weiße Flächen mit verschiedenen Abstufungen von Grün als verbindende Leitfarbe alternieren, haben eine angenehme, ruhige Atmosphäre, ohne dabei eintönig zu wirken. Zur Großzügigkeit der Innenräume trägt auch bei, dass eine der beiden Sporthallen als paralympische Wettkampfstätte konzipiert und mit dementsprechend geräumigeren Zugängen und Nebenräumen ausgestattet ist.
Je weiter man im Schulgebäude hinaufsteigt, desto heller und schöner wird es. So wird der Aufstieg über die beiden Scherentreppen belohnt. Mehr als fünf Etagen muss dabei aber kein Schüler bewältigen, denn das sechste Obergeschoss nimmt die Gebäudetechnik auf. So wird die gewünschte städtebaulich gebotene Höhe des Baukörpers an der Straßenkreuzung erreicht, und zugleich bleibt den Dächern der übliche Wildwuchs aus entstellenden gebäudetechnischen Installationen erspart. Das Dach über den Sporthallen, das die größte Fläche bietet, dient der Energieerzeugung durch – von der Straße aus unsichtbare – Solarpaneele.
Baustein der Stadtreparatur
Im Unterschied zu den meisten Schulen der Gegenwart, die vorzugsweise auf Freiflächen ohne stadträumlichen Zusammenhang errichtet werden, ist der Komplex der Johanna-Moosdorf-Schule aus dem Städtebau entwickelt. Architekt Benedikt Schulz bringt die Grundidee des Entwurfs so auf den Punkt: sich im Stadtraum behaupten, viel Freiraum erzeugen und den ökologischen Fußabdruck begrenzen.
Beim Blick auf den Innenhof wird deutlich, dass die Höhe der Bauten nicht nur auf das städtebauliche Umfeld reagiert, sondern auch eine außergewöhnliche Großzügigkeit der Freiflächen ermöglicht, die für den Schulalltag ebenso wichtig ist wie die Güte der Innenräume. Der vom Dresdner Büro r+b landschaft s architektur gestaltete Hof bietet Sport- und Spielflächen inmitten von Baumgruppen, der Bodenbelag ist wasserdurchlässig und sparsam eingesetzt, der Grünanteil dafür umso höher. Da im Erdreich keine Tiefgarage steckt, werden die Bäume ungehindert in die Höhe wachsen, sodass sich hier eine grüne Oase entwickelt – ein Gewinn für den Schulalltag ebenso wie für das Stadtklima. Zugleich erhalten die benachbarten Wohnbauten an der verkehrsbelasteten Prager Straße eine grüne Rückseite und werden damit attraktiver.
Wenn in Zukunft auch die leeren Flächen an der Nordseite des weitläufigen Grundstücks bebaut werden, entsteht hier die in Leipzig besonders bewährte städtebauliche Figur der Blockrandbebauung mit einem großen geschützten Innenhof, die dem nach Abrissen der DDR-Zeit und der Folgejahre zerfledderten Stadtraum wieder eine Fassung gibt. Die Johanna-Moosdorf-Schule initiiert damit die Entwicklung einer Brachfläche für eine Nutzungsmischung mit viel Freiraum. Das ist der richtige Ansatz für die Innenentwicklung einer Großstadt, die ihr rapides Wachstum ohne ungehemmte Zersiedelung und Flächenversiegelung bewältigen will.
db, Fr., 2025.08.29
verknüpfte Zeitschriften
db 2025|09 Sachsen