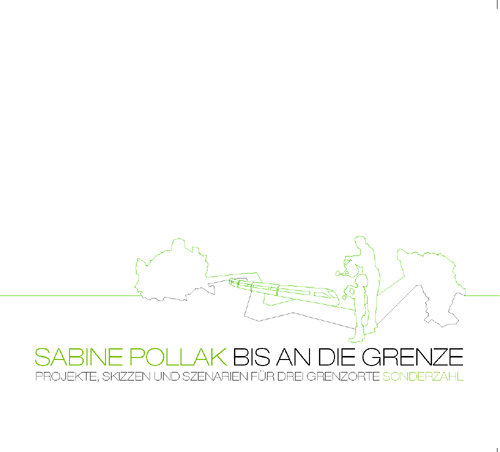Der falsche Platz
Pflanzt Bäume, entsiegelt, und lasst Wasser spritzen! Aber bitte dort, wo Menschen wohnen. Der Aufstand gegen die Umgestaltung am Michaelerplatz greift nicht: Ihm fehlt die revoltierende Substanz.
Pflanzt Bäume, entsiegelt, und lasst Wasser spritzen! Aber bitte dort, wo Menschen wohnen. Der Aufstand gegen die Umgestaltung am Michaelerplatz greift nicht: Ihm fehlt die revoltierende Substanz.
Die Diskussion rund um die Neugestaltung des Michaelerplatzes ist festgefahren. Die Stadt argumentiert mit dem Klima, Expertinnen argumentieren mit der Wirkung des historischen Ensembles. Und es wird kräftig polemisiert. Professorinnen werden gegen Nutzerinnen, Klimafitness wird gegen Geschichte und Grün gegen Grau ausgespielt. Ich kann die Kritik an der vorwiegend akademisch geführten Diskussion nachvollziehen. Das „subtile und zugleich labile Gleichgewicht des Platzes“ werde durch die neue Gestaltung gestört, liest man etwa. Was genau ist mit der Subtilität des Platzes gemeint? Die Starbucks-Filiale? Das ehemalige Café Griensteidl, heute nichtssagendes Modegeschäft? Luxusgeschäfte am Kohlmarkt? Fiakerpferde, die in der Stadt nichts zu suchen haben?
Die Debatte greift nicht, weil es ihr an revoltierender Substanz fehlt. Es gibt keine Betroffenen (außer den Pferden), keine Grün erhoffenden Anrainerinnen, keine Spielplatz suchenden Kinder, keine Seniorinnen, die sich um Hochbeete kümmern würden. Von allen inneren Bezirken Wiens hat der erste Bezirk die geringste Dichte. In Margareten ist sie fünfmal so hoch, ähnlich in Favoriten, Ottakring und Hernals. Dafür ist im ersten Bezirk die Dichte an SUVs am höchsten, gekoppelt an das höchste Einkommen in Wien. Und nun baut man für diese wenigen Leute mit einem klimatisierten Geländewagen in der Größe einer Kleinwohnung einen begrünten und bewässerten Erholungsraum mitten in der Stadt? Oder ist es doch nur eine Maßnahme für Touristinnen und Airbnb-Bewohnerinnen?
Coole Straßen
Straßen in Wien, in denen wirklich Leute wohnen, sehen anders aus. Niemand käme auf die Idee, anhand einer Straße in Favoriten oder einer Kreuzung in Hernals über ein labiles und zugleich subtiles Gleichgewicht zu sprechen. Das würde dort auch niemanden interessieren, denn die Probleme der Anwohnenden sind viel pragmatischer und schwerwiegender. Für Familien sind die Wohnungen zu klein, Balkone sind im Wiener Altbestand nicht vorhanden, und jeglicher private Rückzugsraum wird in heißen Monaten gezwungenermaßen in den Außenraum verlegt. Ich empfehle den paar Leuten, die im ersten Bezirk wohnen, an einem heißen Julitag mit Temperaturen über 37 Grad Celsius einen der wenigen Parks in Margareten oder Ottakring zu besuchen. Mehr Belegung der Bänke und Wiesen wäre schlicht unmöglich. Wenn die Wohnung unerträglich wird, muss man hinaus. Da platzen Freiräume aus allen Nähten, was bleibt, sind die viel zu heißen Wohnungen und Straßenräume, in die man abends zurückkehrt.
2023 wurden in Wien die „Coolen Straßen“ wieder eingeführt, ein Projekt aus der grün-roten Stadtregierung von vor einigen Jahren. Sie sollen bei Hitze Abhilfe schaffen. Der Durchzugsverkehr wird kurzfristig gestoppt, Rollrasen wird ausgelegt, Sitzbänke werden aufgestellt, und Sprühnebelduschen versprühen Wasser. Coole Straßen sind eine tolle Sache und vor allem bei Kindern beliebt, lösen aber das Problem nicht, sondern behandeln nur das Symptom. Denn Asphalt bleibt auch unter dem Rollrasen bestehen. Zudem ist Rollrasen keine nachhaltige Methode, um Grün zu produzieren. Seine Herstellung verbraucht Unmengen von Wasser, er wird meist weit transportiert und ist die Antithese zur Biodiversität. Und das Versprühen von Trinkwasser durch Nebelduschen ist ohnehin das falsche Signal, vor allem für Kinder, die zukünftig mit Wasser anders haushalten sollten, als wir es heute tun.
Mehr Kreativität
In dicht verbauten Wiener Bezirken leben vor allem Personen, die unter der Hitze besonders leiden, Ältere und Kinder. Für sie wären kühlende Maßnahmen dringend notwendig. Das können leere, von der Stadt anzumietende Erdgeschoßräume sein, Parkplätze, die in Wiesen umgewandelt werden, beschattende großflächige Markisen über Gehsteigen und engmaschig verteilte Trinkbrunnen. Mit einem Sprühnebel können Kinder spielerisch wenig anfangen. Wenn es einen Brunnen gibt, dessen Wasser man stauen und umleiten kann, ist schon mehr Kreativität gefragt. Im Vergleich zu Kindern in anderen Großstädten sind jene in Wien ja gschamig. In Paris und Rom werden kleine urbane Wasserstellen von Kindern ganz anders genutzt. Sie reißen sich sehr schnell die Kleider vom Leib und stürzen sich sofort in jedes Nass, das angeboten wird. Beneidenswert. Nun sollen am Michaelerplatz in einem „großen Wasserspiel“ 50 Wasserfontänen in die Höhe spritzen. Sind diese für die Fiakerpferde gedacht, die sich so den Bauch kühlen können? Oder sollen Touristinnen hier aus den teuren Schuhen vom Kohlmarkt schlüpfen und durchstapfen?
Der Michaelerplatz war für mich bislang ein hübscher, historisch beachtenswerter Kreisverkehr mit einem tieferliegenden Monument in der Mitte. Die Pflastersteine waren beim Radfahren eine Tortur, bewirkten jedoch, dass man langsam fuhr und Fußgängerinnen den Platz queren konnten. Was ist nun genau besser an der neuen Gestaltung? Der motorisierte Verkehr wird zukünftig als Einbahnregelung geführt? Das klingt nicht nach einer Vision wie jener einer autofreien Stadt. Die Fiakerstände werden reduziert, die anderen in eine Seitengasse verlegt? Das klingt nach einem Scherz, es kann nicht ernst gemeint sein. Die 50 vertikal in die Höhe spritzenden Wasserfontänen? Da empfehle ich den Kindern aus Margareten, Favoriten und Hernals: Kommt alle jedes Sommerwochenende zum Michaelerplatz, passt allerdings bitte auf, dass ihr nicht von einem SUV überrollt werdet. Kommt in Badehosen, schmeißt euch voller Lust ins Wasser, ohne Rücksicht auf Verluste. Es ist eure Stadt, nehmt sie euch.
Das Projekt ist nicht mehr zu stoppen? Irrtum, man kann alles stoppen. Stecker raus, Zündschlüssel umdrehen, Schaufeln zur Seite stellen. Nehmt alle eure Geräte, und fahrt mit den Baumaschinen in einen Bezirk, in dem wirklich Leute wohnen. Macht es dort.
Sabine Pollak leitet die Abteilung raum&designstrategien an der Kunstuniversität Linz und ist Partnerin im Büro Köb&Pollak Architektur. Im Text wurde das von der Autorin gewählte generische Femininum übernommen.
Der Standard, Sa., 2024.05.25