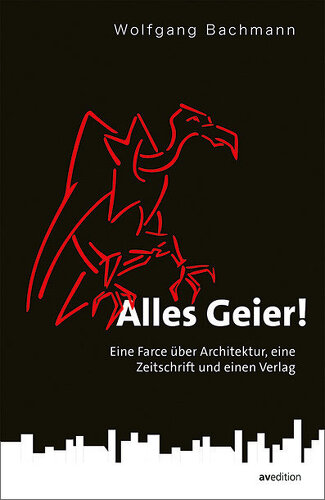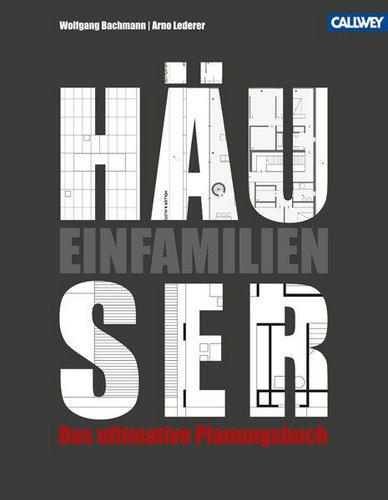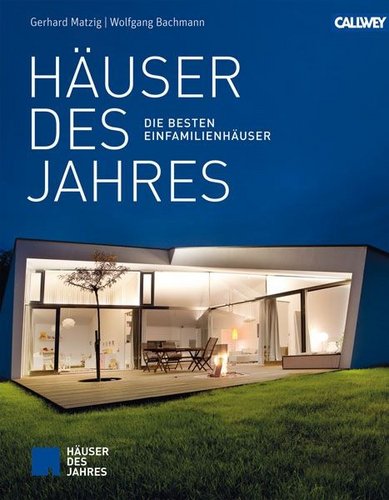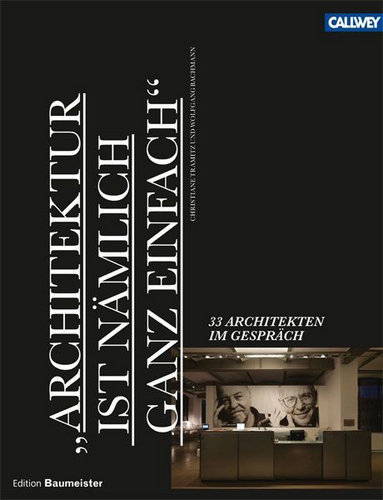Ein halbes Jahr ist die neue Wiener Messe alt. Ihre verwurstelte Baugeschichte ist noch ein paar Jahre älter. Anmerkungen zu einem wienerischen Tohuwabohu.
Ein halbes Jahr ist die neue Wiener Messe alt. Ihre verwurstelte Baugeschichte ist noch ein paar Jahre älter. Anmerkungen zu einem wienerischen Tohuwabohu.
Die Lachse kommen, rufen die Fischer, wenn der Salm zum Laichen flussaufwärts zieht und fette Beute verspricht. Ähnlich ist es mit Städten, zu deren Fremdenverkehr Kongresse, Tagungen und Incentives beitragen. Internationale Messen sind nicht nur ein Imagefaktor, sondern die umsatzträchtigste Art des Tourismus. Für Wien, das in Europa eine Vorzugslage einnimmt, endete das Jahr 2003 mit einer Rekordbilanz. Erstmals hat der Kongress- und Tagungssektor eine zweistellige Zuwachsrate erzielt. Pro Kopf und Nacht ließen die Gäste durchschnittlich 435 Euro in der Stadt, unberücksichtigt, was davon geschäftlich investiert wurde und was die Begleitpersonen bei Knize, Schullin und Palmers, bei Sacher, Demel und Hawelka gelassen haben. Zu den Mega-Events zählte der im Sommer 2003 veranstaltete Kardiologenkongress mit knapp 29.000 Teilnehmern. Als sich die European Society for Cardiology im Jahr 2000 für Wien entschieden hatte, war dies Anlass, die unentschiedene Planung für die Neue Messe vehement voranzutreiben. Die Lachse wollte man sich nicht entgehen lassen.
1992 hatte man zum letzten Mal in das Quartier am Prater investiert, aus dieser Neuentwicklung von Heinz Neumann und Partner sind noch zwei 130 mal 130 Meter große Hallen erhalten. Ende der Neunzigerjahre gediehen jedoch Überlegungen, das Gelände zu verkleinern und sich mit Neubauten als überschaubare, moderne Messe aufzustellen. Martin Schwarz und Günther Sallaberger sollten dazu einen Masterplan erarbeiten. Die beauftragten 1999 die Architekten Franz Kuzmich und Gerhard Kleindienst mit einer städtebaulichen Studie, die die Stadt überzeugte, nur die Nordhälfte des Areals für die Messe vorzusehen.
Inzwischen war entschieden, das Gelände von der Bank Austria zurückzukaufen und eine Betreibergesellschaft für die Messeaktivitäten zu suchen. Die Bank engagierte das Ingenieurbüro FCP (Fritsch, Chiari und Partner), die die Architekten Gerhard Moßburger und Norbert Erlach für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie dazuholten. Von Architektur war noch keine Rede, allerdings entstand ein Bebauungsvorschlag, der im Norden entlang der Straßenbahn und künftigen oberirdischen U-Bahn-Trasse die Anlieferung von vier Hallen vorsah, die sich in Größe und Ausrichtung an der vorhandenen Halle 25 orientierten. Südlich davon war in Ost-West-Richtung eine Erschließungspromenade geplant, sodass keine Entwicklung verbaut würde, jedenfalls ein attraktiver, parkartiger Weg für Nichtmessebesucher möglich sein sollte. Der Vorschlag ist einleuchtend: Die Hallen hätten eine individuelle Andienung von der Straße her erhalten, gleichzeitig wären neben der umtriebigen Bahntrasse die weniger ansehnlichen Nutzungen konzentriert gewesen.
Dieses Konzept fand bei der Stadtverwaltung keinen Anklang. Man drang auf eine Änderung der städtebaulichen Studie: die Andienung sollte anstelle der Promenade im Süden, also in der Mitte des Geländes stattfinden, im Norden, entlang der U-Bahn, wünschte man sich eine gedeckte „Mall“ als Erschließungselement der Hallen. Es heißt, die Stadt hatte für die Grundstücke an der Bahn bereits Investoren gefunden, deren geplanten Wohnungen sie nicht die Aussicht in einen Ladehof bieten wollte.
Vor allen Dingen ging es jetzt um die Lachse, den Kardiologenkongress. In solchen Fällen muss die Architektur zurückstehen und kann nicht über lästige Wettbewerbe entschieden werden. Die Errichtung der Gesamtanlage übernahm die Chefren-Leasing GmbH der Bank Austria, FCP als Generalplaner und die Arbeitsgemeinschaft Moßburger und Erlach als Architekten begannen mit der Gesamt- und Objektplanung auf Grundlage ihrer geänderten Studie. Im November 2000 reichten sie das Baugesuch für die beiden Hallen A und C ein. Dafür wurde aber keine Baugenehmigung erteilt. Moßburger und Erlach berichten, man habe ihnen als „unbekannten Architekten“ keine Chancen im Gestaltungsbeirat, dem Hans Hollein vorsitzt, eingeräumt. Man wollte vor allem keine Animositäten der „Kronen Zeitung“ riskieren, denn damit wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt gewesen. Als Kontraindikation schlug die Stadt vor, einen starken Partner ins Boot zu holen, einen, der überregional einen Namen hat. Man suchte und fand - Gustav Peichl. Es sollte nur um eine „städtebauliche Begleitung“ gehen, wohl um so eine Art Patenschaft. Darüber will sich Christoph Lechner vom Büro Peichl nicht verbreiten, lässt aber durchblicken, dass die beiden Kollegen mit dem Auftrag überfordert gewesen seien. Messeplanung sei eben ein kompliziertes Geschäft, „in München war es doch ähnlich“. Richtig. Da hatte im Wettbewerb das dänische Büro Erik Bystrup den ersten Preis gewonnen, und gebaut hat die Messe das Büro des damaligen Kammerpräsidenten, Peter Kaup, weil es keine hinderlichen Ideen für kommerzielle Bauaufgaben mitbrachte.
Alles, was fortan passierte und das Aussehen der Messe letztlich bestimmt hat, geht auf die veränderlichen Kräfteverhältnisse innerhalb der unübersichtlichen Architektengespanne zurück. Als Betreiber hatte man mittlerweile Reed Exhibitions gefunden, während die Stadt sich nur noch um die Liegenschaft kümmerte. Als Gesprächspartner für die Planer gab es nun die Chefren-Leasinggesellschaft der Bank für die Errichtung, die Stadt als Grundeigentümer, Reed Exhibitions als Mieter, dazu noch die Juristen des Magistrats, die die Finanzierung begleiteten. Dass dies keine glückliche Versuchsanordnung war und jeder der Beteiligten die Verantwortung auf den gerade nicht erreichbaren Partner schieben konnte, kann man sich vorstellen.
Den Messebesucher interessiert heute nur das gebaute Ergebnis. Die unsichtbare, vertrackte Planung dagegen ist eine Erfahrung, die möglicherweise noch anwaltlicher Regelungen bedarf. Nach dem von Markus Kristan herausgegebenen Buch „Messe Wien/Vienna Fair“ (Springer Verlag, Wien) ist sie Peichls Werk. Wiedererkennbar ist seine Handschrift jedenfalls überall.
Wenn man die Straßenbahn nimmt, fährt man bis zur Haltestelle „Messeplatz“. Nur: Da ist kein Platz, bloß ein verbreiterter Gehsteig, den Paul Katzberger mit dynamischen Schlieren onduliert hat. Entlang der betonierten Lärmschutzwand der künftigen U- Bahn quetscht sich eine Erschließungsstraße, deren Krümmung die Rückseite des von Peichl entworfenen Kongresszentrums folgt. Um den Eingang zu erreichen, muss man die Gleise zurücklaufen und trifft auf die schneidige Ecke des vollständig verglasten Foyers West. Das ist der Auftakt der von der Stadt gewünschten 450 Meter langen Mall, die hier unsichtbar zwischen Kongresszen-trum und Hallen beginnt und erst allmählich als transparente Passage erkennbar wird. Fahnenschmuck und signalrote Trommeln lassen ahnen, dass hier der Eingang liegen könnte.
Das Foyer selbst gefällt durch seine lichte Größe, emporgestemmt von weiß lackierten Stahlrohren, die einen Gitterrost mit rautenförmigen Feldern tragen. Das Glasdach wird durch blaue Punkte verschattet, warum man dazu keine Solartechnik nutzte und lediglich ein paar Fassadenlamellen damit ausgestattet hat, ist fragwürdig. Ein rotes Portal, das als Passepartout vor der Stirnfassade schwebt, dient als Auftakt der Mall, die sich im Querschnitt wie eine Basilika mit zwei angedeuteten Seitenschiffen geriert. Sie entspricht Peichls Koketterie mit der Postmoderne. Dazu passt der runde Messeturm, der sich zwischen Foyer und Kongresszentrum drängt und ein weithin sichtbares Zauberhütchen aus Stahlstäben trägt. Hier liegt der Eingang des Kongresszentrums, nach außen ablesbar durch ein textiles Vordach wie man es von Autohäusern in Gewerbegebieten kennt.
Unmittelbar gegenüber, im Abstand der Servicegasse, sieht man auf die Betonwand der U-Bahn - ein Hinweis, welches Verhältnis Funktion und Design bei diesem Projekt spielen. Die Säle unterschiedlicher Größe, innen liegende, mit heller Esche verkleidete Boxen, mögen für die beliebten Firmen-Workshops ihren Zweck erfüllen. Es gibt sie auf zwei Ebenen, flankiert von Lokalen, und ihre Teilbarkeit lässt auch eine kleine Teilnehmerzahl problemlos umschließen. Ein Aha-Erlebnis bieten sie nicht. Da wünschte man sich mehr Größe und eine strapazierfähige Infrastruktur. Auch ist es ungewöhnlich, dass sich kein Foyer an die Säle anschließt, sondern nur die endlose Mall.
Gegenüber dem Kongresszentrum liegen die vier Hallen, deren letzte mit dem grün verglasten Ostfoyer gleichzeitig den Kopf der Passage bildet. Die Zwillinge A und C bestehen aus einer gewaltigen Betonkonstruktion mit vier innen liegenden Stützen-Kernen, so dass eine Teilung in neun Felder möglich ist. Während man Messehallen gemeinhin als funktionale Kisten ohne architektonischen Anspruch erwartet, hat Peichl ihnen ein unterspanntes Dachtragwerk mit plastischen Laternenöffnungen gegeben. Dennoch ist das Innere kein leuchtender Kristallpalast, wie in dem erwähnte Band gezeichnet, und auch die statischen „Oberleitungen“ erfreuen nicht jeden Messebauer. Zwischen den Hallen liegen als Pavillons zwei Cafés, die auch von der Mall erreichbar sind, ein Kiosk wirbt am östlichen Zugang um Aufmerksamkeit. Ein einladendes Vordach gibt es auch hier nicht.
Diese vierte Halle mit 80 Meter Stützweite und einer ebenen Deckenuntersicht sowie die zwei separaten Parkhäuser haben Moßburger und Erlach entworfen. Bei den übrigen Bauwerken hatte sich die Urheberschaft allmählich zugunsten des Büros Peichl verschoben. Von dort kamen Skizzen und Strichzeichnungen, die die Projektarchitekten auf ihre Realisierung überprüfen sollten. Die Ausführungsplanung übernahmen später Vasko und Partner. Dennoch sind Peichls Leitdetails unübersehbar. Es ist sein Drang zu Eleganz und Spaß, der sich überall Geltung verschafft. Einmal sind es die Luftauslassöffnungen in den Hallen, die die Panzerkreuzermotive seiner ORF-Studios wiederholen, dann die Art, wie er die roten Hallenstützen beiläufig zum Thema ordnet, in der Mall die Betonsäulen mit Edelstahlmanschetten vom Granitbelag trennt, darüber auf dem Satteldach Laternen entwickelt und die Technik über dem Kongresszentrum zu zwei silbernen Waggons formt - Anklänge an die Sechzigerjahre, die mit Walter Pichlers Fauteuils Galaxy1 authentisch hereinschauen dürfen.
Vor allem dieser Zugabenteil nördlich der Hallen, der auf den Grundrisszeichnungen an ein heimtückisches Nagetier erinnert (und an Peichls Karikaturisten-Existenz), prägt sich von dieser Messe ein. Sie ist nett, als wollte man ihre verklemmte Monumentalität nicht unbehübscht dem Publikum anbieten. Man kann sagen, avantgardistischen Anfechtungen ist sie nicht erlegen. Aber sie wirkt auch nicht zeitlos. Sie zeigt die Zeit Peichls.
Spectrum, Sa., 2004.07.24
verknüpfte BauwerkeWiener Messe Neu
![]()