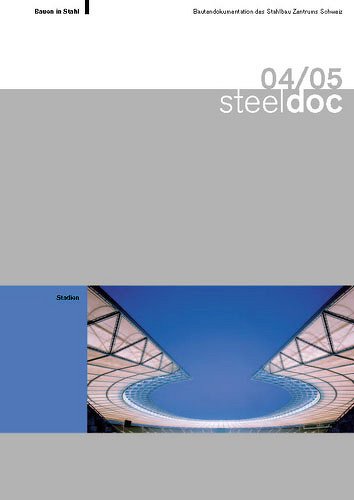Editorial
Seit der Antike dienen Stadien der Kontrolle und der Selbsterfahrung der Massen. „Brot und Spiele“ brauchte Rom, um beherrscht zu werden. Die römischen Stadien fassten denn auch grosse Volksmassen, die gelenkt, kontrolliert und durch das Ereignis beeindruckt werden sollten. Eine Renaissance des Stadionbaus bewirkte Ende des 19. Jahrhundert die Wiederbelebung der Olympischen Spiele durch die Ausgrabung eines Hippodroms in Athen. In den Olympiastadien wetteiferten Athleten im Streckenlauf, Turnen oder Radfahren. Fussball spielte noch keine grosse Rolle. An den Olympischen Spielen 1936 im Berliner Olympiastadion kam als Weltpremiere die Fernsehübertragung ins Spiel und damit der Sport in die Wohnzimmer der Welt.
Seither sind Stadien auch Projektionsflächen für die Kommerzialisierung des Sports durch die Medien. Stadien müssen allen Konsumentengruppen gerecht werden und werden immer mehr zu multifunktionalen Gebäuden. Während die Athleten und Sportler unter Umständen noch den Witterungen der Natur ausgesetzt bleiben, bietet man den Sportkonsumenten und Sponsoren Schutz vor Regen und Hitze. Deshalb kommt der Überdachung auch von bestehenden Arenen zunehmend Bedeutung zu. Der Bau von Stadien war seit jeher eine faszinierende architektonische Herausforderung. Sportereignisse sind auch heute noch Anlass für Masseneuphorie und grosse Nationalgefühle, die durch räumliche Grösse und Virtuosität der Konstruktion unterstützt werden. Im vorliegenden Steeldoc behandeln wir das Thema Stadien aus dem Blickwinkel des Stahlbaus. Dabei ist der Fokus auf faszinierenden Dachkonstruktionen gelegt, bei denen der Stahlbau die tragende und formgebende Rolle spielt.
Den Anfang macht das Olympiagelände von Athen, das der Architekt Santiago Calatrava für die Sommerspiele 2004 in einen skulpturalen Garten Eden verwandelt hat. Der Meister der Schwerelosigkeit hat hier einen markanten und unverkennbaren städtebaulichen Akzent gesetzt. Das Olympiastadion Berlin erlebte 1936 einen Höhepunkt als Tempel der Körperkultur. Das denkmalgeschützte Bauwerk wurde nun modernisiert und mit einem Dach versehen, das sich der imposanten Gebäudetypologie entsprechend anpasst. Die Münchner Allianz-Arena der Architekten Herzog & de Meuron ist ein konstruktives Glanzstück. Der bombastische Leuchtkörper besteht aus drei Tragwerksschichten, darüber wölbt sich ein mit Luft gefülltes Rautennetzwerk. Wie ein Spinnennetz überspannt ein vollständig schliessbares Dach die Arena Frankfurt, welche im Hinblick auf die Fussball-Weltmeisterschaft 2006 aufgerüstet wurde. Schliesslich dokumentieren wir das Schweizer Nationalstadion „Stade de Suisse“ in Bern, das mit einem schwebenden Flugzeugflügel überdacht ist.
Wir wünschen viel Freude und Erkenntnis beim Studium der
nachfolgenden Seiten - und werfen Sie während der Fussballweltmeisterschaften auch mal einen Blick nach oben. Evelyn C. Frisch
Inhalt
3 Editorial
Olympiagelände OAKA, Athen
4 Sinnliche Hommage an die Schwerelosigkeit
Olympiastadion, Berlin
12 Grosses Himmelszelt über Berlin
Allianz Arena, München
18 Leuchtendes Luftschiff
Waldstadion, Frankfurt
22 Filigranes Spinngewebe
Stade de Suisse, Bern
26 Aalglatter Flugzeugflügel
31 Impressum
Aalglatter Flugzeugflügel
Auf dem Areal des ehemaligen Fussballstadions Wankdorf ist ein multifunktionales Gebäude errichtet worden, das unter anderem dem Schweizer Fussballverband als Nationalstadion dient. Das Spielfeld ist mit einer leichten Stahlkonstruktion überdacht, die an einen schwebenden Flugzeugflügel erinnert. Umhüllt wird die Fassade mit einem halbtransparenten Stahlgewebe.
Bekannt wurde das ehemalige Wankdorfstadion aus dem Jahre 1954 durch das „Wunder von Bern“ - das denkwürdige Weltmeisterschafts-Final Ungarn gegen Deutschland. Doch der Zustand des Stadions genügte den Sicherheits- und Komfortanforderungen von heute nicht mehr. Treibende Kraft für einen Neubau war der Bauunternehmer Bruno Marazzi, der schon seit Ende der achtziger Jahre ein Konzept für ein neues Wankdorf Stadion entwickelte. Klar war, dass ein reiner Sportbau sich nicht finanzieren las-sen würde. Um Rendite zu erzielen, musste das Volumen des Stadions mit anderen Nutzungen aufgeladen werden - man entschied sich für ein Multiplexkino mit zehn Sälen, ein Hotel, 500 Büroarbeitsplätze und schliesslich das obligatorische Einkaufszentrum, um das alltägliche Besucheraufkommen zu garantieren.
Im Jahre 1998 wurde unter zwölf Architekturbüros ein Wettbewerb durchgeführt: der Entwurf des Zürcher Teams Rebmann, Rebmann, Meier landete auf dem ersten Rang. Die Stadt Bern verlangte jedoch 1999 einen neuerlichen Wettbewerb der fünf Preisträger auf Basis des Rebmann Entwurfs. Nunmehr erhielt die im Vorjahr zweitplacierte Arbeitsgemeinschaft von Rodolphe Luscher aus Lausanne und dem Berner Partnerbüro Schwaar & Partner den Zuschlag, das Büro Rebmann wurde ins Team integriert. Im Jahr 2000 lag ein baureifes Projekt vor - doch das Multiplexkino führte zu Einsprachen, so dass eine Umplanung mit mehr Bürofläche anstelle von Hotel und Kinos nötig wurde. Die Gesamtanlage wurde Mitte 2005 eröffnet und vom Schweizerischen Fussballverband zum „Nationalstadion“ – dem „Stade de Suisse“ erklärt.
Zeigten die Entwurfspläne zu Beginn noch ein spannungsreiches Arrangement von Stadionoval und Baukörpern für die Nebennutzungen, das von einem schwebenden Dach überfangen wurde, ist das ausgeführte Projekt deutlich kompakter. Stahlbetonstützen im regelmässigen Rhythmus tragen den viereckigen Dachkranz, der konstruktiv aus weit in Richtung Spielfeld vorkragenden Fachwerkträgern von 30 Metern Länge besteht und ursprünglich von innen verschiedenfarbig beleuchtet werden sollte. Ein auf der Südseite in die Arena hineingedrücktes Volumen enthält im vierten Obergeschoss an Firmen vermieteten Logen. Zwei Tribünen, die den strengen FFIFA und UEFA Richtlinien genügen müssen, fassen rund 32'000 Sitzplätze - wie heute üblich, wurde dabei auf grösstmögliche Nähe zum Spielfeld
Wert gelegt. Für Festanlässe wie Konzerte und Events sind bis zu 40'000 Besucher zugelassen.
Schwebendes Stahldach
Das Stadiondach dient in erster Linie dem Zuschauerkomfort. Sämtliche Sitz- und Stehplatztribünen sind überdacht. Daneben bietet das Dach die Möglichkeit für verschiedene Zusatznutzungen. So wird
auf einer Fläche von 5'300 m² das grösste schweizerische Sonnenkraftwerk errichtet. Interessierte Besucher werden die Anlage von einer erlebnisorientiert ausgestalteten Plattform über dem Dach besichtigen können. Ausserdem dient das Stadiondach zur Aufnahme einer Vielzahl von Betriebseinrichtungen wie Anzeigetafeln mit LED-Technik, Beleuchtung und Flutlichter, Lautsprecher und Mikrofone sowie Videokameras. Im Innern des Dachs befinden sich weitere technische Installationen wie Kabelkanäle und Dachwasserleitungen sowie ein Servicesteg.
Neben den statisch-technischen Anforderungen hat das Dach auch die gestalterische Idee der Architekten zu tragen. Es soll wie ein Flugzeugflügel über dem Stadion schweben. Daraus entstand die Konzeption der Dachhaut, welche die Konstruktion einfasst, wie auch das Tragkonzept mit der 29 m grossen stützenfreien Auskragung. Die Unterseite des Daches wird mit Metallkassetten verkleidet. Der Dachrand auf der Innenseite wird auf einer Breite von rund 8 m mit Mehrstegplatten aus Polycarbonat transparent gehalten, um harten Schattenwurf auf dem Spielfeld zu vermeiden.
Tragkonzept
Die Tragkonstruktion des Daches besteht aus 40 Stahlfachwerk-Hauptträgern im Abstand von 16.0 m bzw. 17.16 m. Diese 40 m langen, 29 m auskragenden Fachwerke mit 5.10 m Scheitelhöhe sind innen auf Stahlrohrstützen Æ 813 mm abgestellt und aussen mit Stahlrohren (Durchmesser 457 mm) zugverankert. Um die Spannweite zwischen zwei Hauptträgern zu halbieren, wurden diese mit Fachwerk-Querträgern verbunden, welche als Auflager für die Sekundärträger dienen. Dadurch konnte die Spannweite für die Pfetten auf 8 m bzw. 8.58 m reduziert werden. Die für die Dimensionierung massgebenden Einwirkungen ergeben sich aus Schnee und Wind.
Zur Aussteifung der Dachkonstruktion werden sowohl in der oberen wie auch in der unteren Dachebene Verbände angeordnet. Die Horizontalstabilisierung des Daches gegen Wind- und Erdbebenkräfte erfolgt über die inneren Stahlstützen, die in 11 m Höhe - bei einer Gesamtlänge von 15 m - durch die vorfabrizierten Beton-Tribünenträger horizontal gehalten sind. Dabei ist zu beachten, dass die Steifigkeit der Tribünenträger in Querrichtung zehnmal grösser ist als in Längsrichtung.
Montage
Trotz der weitgespannten Tragkonstruktion beträgt der Stahlverbrauch nur etwa 75 kg/m2 (ohne Stützen). Bei einer Dachfläche von rund 24'000 m² ergibt dies dennoch ein Gesamtgewicht von 1'800 t sowie zusätzlich 500 t für die Stahlstützen und weitere 500 t für eine Stahlverbunddecke. Das Montagekonzept wurde bestimmt durch die Transportmöglichkeiten vom Werk auf die Baustelle, den Platzverhältnissen für die Lagerung vor Ort und den zur Verfügung stehenden Hebezeugen. In einem ersten Umgang wurde zuerst der äussere Kranz - der so genannte „Rucksack“ - montiert und in einem zweiten Umlauf folgte dann der nach innen auskragende Teil. Die Konstruktion wurde jeweils auf dem Spielfeld vormontiert und dann in Elementen mit einer Länge von zwei Stützenfeldern auf die vorgängig gestellten Stützen gesetzt.Steeldoc, Sa., 2006.01.28
28. Januar 2006 Evelyn C. Frisch
verknüpfte Bauwerke
Stade de Suisse
Sinnliche Hommage an die Schwerelosigkeit
Die Rückkehr der Olympischen Spiele in deren Ursprungsland hat Athen architektonisch beflügelt. Unverkennbar und meisterhaft hat der Architekt und Ingenieur Santiago Calatrava das Olympiagelände für die Sommerspiele 2004 ins kollektive Bewusstsein gerückt und der Stadt damit einen ersten Schimmer weltstädtischer Eleganz geschenkt.
Athen ist keine Metropole der Superlative. Trotz Lärm, Abgasgestank und öden Vorstädten hat sich dieser Stadtmoloch jedoch einen eigenen Charme des Unvollkommenen und Lebendigen bewahrt. Nun hat Athen die Herausforderung gemeistert, auch zeitgenössische Architektur von Weltformat zu schaffen. Gerade die bisherige Unberührtheit von internationalen Architekturgrössen, hat dem Werk des Architekten Santiago Calatrava eine so imposante Wirkung verschafft.
Drei Jahre vor der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele hatte Santiago Calatrava anlässlich einer Ausstellung seiner Skulpturen in der Nationalgalerie in Athen den griechischen Kulturminister von seinem Genie überzeugt. Im gleichen Jahr erhielt er den Auftrag für den Ausbau und die Erneuerung des Olympiageländes. Die Zeit war knapp berechnet. Bis Juni 2002 dauerte die Entwurfsphase, Anfang 2003 begannen die Bauarbeiten und rechtzeitig zur
Eröffnung 2004, waren die Arbeiten abgeschlossen.
Byzantinische Formsuche
Der Planung zugrunde liegt ein klassisch anmutender Masterplan, dessen Rückgrad eine Achse zwischen den beiden Wahrzeichen, dem Olympiastadion und dem Velodrom, bildet. Die Agora ist ein schattenspendender Wandelgang, der halbkreisförmig entlang einer Wasserfläche verläuft. Sie besteht aus 99 hohen und niedrigeren Bogen aus Rundrohrstahl. Die Agora begrenzt die zentrale „Plaza of the Nations“, eine Art halbrundes, offenes Amphitheater. Den Platz schliesst die „Nations Wall“ ab, eine bewegliche Raumskulptur aus frei schwebenden, weissen Rechteckstahlrohren. Eine Mechanik versetzt die Wand in stetige Wellenbewegungen.
Das Olympiastadion
Wie eine zarte Handbewegung legt sich das grösste Glasdach der Welt, die Überdachung des Olympiastadions, über eine Arena, die 80'000 Besucher fasst . 17'000 Tonnen Stahl schweben mit einer selbstverständlichen Leichtigkeit über den Köpfen der Zuschauer. Die Kräfte scheinen sich in einer kühnen Bewegung gegenseitig aufzuheben – das perfekte Gleichgewicht, Schwerelosigkeit, soweit das Auge reicht. Das Dach hat die Form von zwei Blättern und überspannt die bestehende Arena aus den 80er-Jahren ohne sie zu berühren. Die Auflager befinden sich ausserhalb der Arena. Es sind insgesamt vier gelenkige Gussteile aus Stahl.
Die Tragstruktur besteht aus zwei Bogenpaaren aus Rundrohr-Stahl, die an ihren Schneidepunkten aufliegen. An den hohe Bögen sind Stahlseile befestigt, welche die abgehängten Dachflächen aus Polykarbonat-Paneelen tragen. Die Dachflächen liegen auf den tiefer liegenden Druckbögen auf, von welchen aus in einem Abstand von 5 Metern Sekundärträger auskragen. Die Dachflächen werden zusätzlich von sekundären Abspannseilen gehalten. Die zwei blattförmigen Dachflächen kommen an deren Ende zusammen und formen ein Oval, das der ganzen Dachkonstruktion Stabilität verleiht. Diese beiden Blätter weisen ebenfalls eine leichte Schwingung auf und spenden den wohltuenden Schatten, den die Zuschauer im heissesten Monat des Jahres bitter nötig haben - überdeckt sind rund 10’000 Quadratmeter, was 95 Prozent der Sitzplätze entspricht. Die beiden Dachhälften wurden aus vorgefertigten Elementen auf Hilfskonstruktionen neben dem Stadion erreichtet und hydraulisch an ihre endgültige Position verschoben. Dafür wurden die Auflager aus Stahl mit Teflon beschichtet und in Führungsschienen gesetzt.
Das Velodrom
Der kleine Bruder des Olympiastadions ist das Velodrom. Hier ist das Dach vollständig geschlossen, vor allem für optimale Lichtverhältnisse für die Fernsehübertragung. Am Scheitel verläuft ein Lichtband aus Sonnenschutzglas. Aus akustischen Gründen wurde die Innenseite des Gewölbes in Holz ausgekleidet, im Aussenbereich mit Stahlblech gedeckt. Die Tragstruktur wird aus zwei geneigten Bogenpaaren aus Stahl gebildet, an denen wiederum Kabel zur Befestigung der Dachmuschel befestigt sind. Die ganze Konstruktion wurde aus vorgefertigten Stahlelementen errichtet und anschliessend auf Schienen über die Arena geschoben. Das Dach liegt nur an vier Punkten auf, wo die Bogen aufeinander treffen.
In der Einmaligkeit der Architektur von Santiago Calatrava kulminieren die technischen Möglichkeiten unserer Zeit und die Essenz einer seit Jahrtausenden sedimentierenden schöpferischen Formensprache. Unverkennbar bleibt die Anlehnung an vegetabile Formen und die Ausreizung der Gesetzen der Schwerkraft. Manche Kritiker mögen ihm die Überformulierung der Kraftverläufe vorwerfen – doch wer sonst kann der Funktionalität von Räumen so viel Seele einhauchen? Es ist, als ob Santiago Calatrava jedem Ort, und sei er noch so düster, eine ihm innewohnende sinnliche Intimität entlockt und sie den Menschen zugänglich macht. Fassungslos steht der Betrachter vor der Kraft und schlichten Schönheit dieser Räume.Steeldoc, Sa., 2006.01.28
28. Januar 2006 Evelyn C. Frisch
verknüpfte Bauwerke
Olympiagelände OAKA