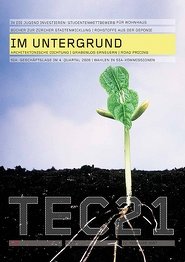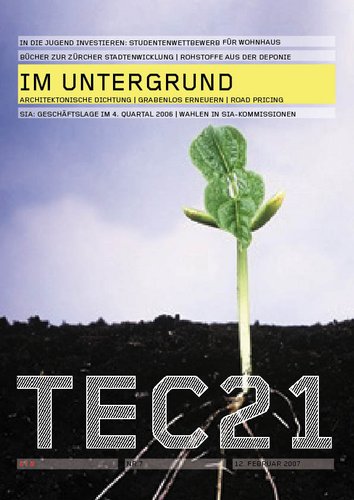Editorial
Editorial
Mit spitzer Feder leitete Jürg Meyer in der NZZ vom Dezember 2006 seinen Artikel über das Ende der Bauarbeiten an der Erweiterung des Museums Rietberg ein: «Wer sagt denn immer, Grossprojekte hätten es in Zürich schwer? Solange untertags gebaut wird, läuft alles prächtig.»[1] Erweiterungen bestehender Bauten aus Rücksicht auf diese in den Untergrund zu «verbannen», ist bei vielen Architekten unbeliebt. Es gilt ihnen als duckmäuserisch. Aber verwechseln sie damit nicht einfach Demut mit Unterwürfigkeit, Respekt mit (Kadaver-)Gehorsam, Rücksicht mit Selbstaufgabe?
Ein nicht autistischer Bau, einer, der dem Bestand die Reverenz erweist – und nicht nur, weil er mehrheitlich «untertage» angelegt ist –, muss keine Selbstverleugnung sein. Das haben Alfred Grazioli und Adolf Krischanitz bewiesen. Sie haben das Museum Rietberg nicht nur mit einem neuen Baukörper – einem Single gewissermassen – ergänzt, sondern eine Beziehung geschaffen: eine ausgewogene «ménage à trois».
Und dann hat das unterirdische Bauen noch eine ganz andere Dimension. Eines der grössten «unsichtbaren» Bauwerke der Schweiz verbirgt sich nämlich im Untergrund: 53 000 km Frischwasserleitungen, 16 000 km Gasleitungen, 40 000 km öffentliche Abwasserkanäle und rund 80 000 km private Abwasseranschlüsse.[2] Das Leitungsnetz wird kaum wahrgenommen, obwohl es einen enormen finanziellen Wert darstellt. Grossen statischen und chemischen Belastungen ausgesetzt, hat es eine Lebensdauer von 50–80 Jahren.
Vor allem die Kanalnetze sind heute in einem kritischen Zustand. Doch nicht nur damit die Erneuerung, die bisher sehr sichtbar im offenen Graben stattfand, wieder im Untergrund verschwindet, werden Verfahren wie Berstlining und TIP immer beliebter. Unter welchen Voraussetzungen diese Techniken angewendet werden können, beschreibt der Artikel «grabenlos erneuern».
Rahel Hartmann Schweizer, Daniela Dietsche
Inhalt
WETTBEWERBE
In die Jugend investieren
MAGAZIN
Bücher zur Zürcher Stadtentwicklung / Rohstoffe aus der Deponie / Korrigenda
SIA
Geschäftslage im 4. Quartal 2006: Erfreuliche hohe Auftragsbestände / Wahlen in SIA-Kommissionen im 2. Semester 2006
PRODUKTE
ARCHITEKTONISCHE DICHTUNG
Rahel Hartmann Schweizer
Vertonte Wagner die Gedichte der Hausherrin der Villa Wesendonck, so haben die Architekten Alfred Grazioli und Adolf Krischanitz die Lyrik nun in die Architektur der Erweiterung des Museums Rietberg übersetzt.
GRABENLOS ERNEUERN
Daniela Dietsche
Der Sanierungs- und Erneuerungsbedarf der Kanalnetze wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Vor allem im dicht bebauten innenstädtischen Bereich sind grabenlose Verfahren eine interessante Alternative zum offenen Graben.
ROAD PRICING GEGEN ZERSIEDELUNG
Hans-Henning Von Winning
Staus vermeiden durch eine Strassenbenutzungsgebühr: Wäre das ein Neuanfang für die Raumplanung?
IMPRESSUM
VERANSTALTUNGEN
Architektonische Dichtung
Der «Baldachin», mit dem der Neubau des Museums Rietberg in Zürich oberirdisch in Erscheinung tritt, reflektiert die bestehende Villa. Als Hommage an die einstigen Protagonisten des Hauses ist er auch in Architektur übersetzte Lyrik.
Von der Gablerstrasse durch eine hohe Mauer abgeschirmt, lassen sich die Villa , die Leonhard Zeugheer in den Jahren 1855–1857 für Otto und Mathilde Wesendonck im neoklassizistischen Stil erbaute, und der Park, den Theodor Froebel gestaltete, eigentlich erst in den Blick nehmen, wenn man bereits bei der Pergola angelangt ist. Diese fasst den Raum zwischen der Villa und dem ehemaligen Ökonomiegebäude, vermittelt zwischen den beiden Bauten, bindet sie aneinander und verleiht dem Raum dazwischen Intimität: Er ist nicht mehr Park und noch nicht Haus. Auf der Westseite der Villa, der bisherigen Eingangssituation, fehlte ein Gegenstück. Erst jetzt, da der schmale Glasbau, der sich über der unterirdischen Erweiterung erhebt, sie gleichsam wie eine Laterne bekrönt, zeigt sich, dass da bisher eine Leerstelle war. Der «Baldachine von Smaragd» – die schon im Wettbewerb verwendete Bezeichnung verweist auf eine Zeile aus dem von Wagner vertonten Gedicht «Im Treibhaus» Mathilde Wesendoncks (siehe «Wesendonck-Lieder») – bildet nun gleichermassen das Gegenstück zur Villa wie das Pendant zu deren vorgelagertem Baldachin. Er ist ein zweites Gesicht, ein Alter Ego.
Dreierbeziehung zu Dreigestirn
Auf diesen Ensemblecharakter berufen sich die Architekten auch: Die Zweierbeziehung von Villa und Ökonomiegebäude wurde zu einer Dreierbeziehung, die das Ensemble ausgewogener erscheinen lässt. Alfred Grazioli und Adolf Krischanitz verstehen das Glashaus aber auch als jene vierte Fassade der Villa, die durch den Wintergarten verdeckt wird und daher gleichsam «herausgezogen» werden musste. Die Dreierbeziehung mag als Analogie zum Dreigestirn Wagner, Nietzsche und Semper gelesen werden: Wagner gastierte in der Villa Wesendonck, Nietzsche war Bibliothekar Wagners und las in dessen Bibliothek die Bücher Sempers.
Nun ist denn auch der Raum vor der Villa definiert, sodass man vom pergolagesäumten «Vestibül» ins Atrium zwischen Villa und Neubau gelangt, der oberirdisch äusserst bescheiden in Erscheinung tritt – zumindest was die Baumasse betrifft. Optisch dagegen hat der schmale Glasbau – konstruktiv ein statisches Gebilde (siehe Kasten «Glasbau»), funktional ein Portikus, ästhetisch ein Baldachin – magnetische Ausstrahlung. Und er ist nicht nur der Antipode zur Villa, sondern auch Reflexion der Geschichte des Hauses.
Gehüllt in eine mit abstrahierten Smaragdkristallen in einem Emailverfahren tätowierte Draperie aus Glas, ist er kaum noch (Bau-)Körper, eher Tüll, Vorhang, Schleier. Das passt zur Konzeption des Platzes, der sich zwischen der Villa mit deren bestehendem und dem neuen Baldachin aufspannt: Mit seinem feingliedrigen Parkett aus Akazienholz suggeriert er einen Innenraum, ein «Wohnzimmer unter freiem Himmel», wie ihn die Architekten beschreiben.
Der Glasbau ist Hülle für das Foyer. Dieses wird von zwei sich kontrastierenden Materialien dominiert: dem brasilianischen Schiefer der Bodenplatten und dem durchscheinenden, hinterleuchteten Onyx der Decke. Der Schiefer verweist auf den steinernen Untergrund, in den der grösste Teil der neuen Ausstellungsflächen eingetieft ist. Der Onyx, als Vermittler zum Aussenraum, evoziert Bilder von Stellschirmen und Fensterfüllungen der traditionellen ostasiatischen Architektur. Die Schieferplatten sind von mit Vlies gedeckten Lüftungsrinnen durchzogen, deren Pendants an der Decke – Schlitze zwischen den Onyxplatten – die Luft absaugen. Die mit zweiflammigen Leuchten, rötlich und gelb, hinterleuchteten Onyxplatten unterspannen die Deckenfelder, die von den Unterzügen gebildet werden, welche die Decke des Erdgeschosses tragen und ein Lichtrasterfeld von 3.40 × 10.20 m – ein Verhältnis von 1 : 3 – bilden.
Die Eingangshalle beherbergt Kasse, Garderobe, Shop und Lift. Die Rückwand wird beherrscht von einem Relief des Künstlers Helmut Federle, das an jenes an der Schweizerischen Botschaft in Berlin erinnert. Der in roher Holzschalung geformte Beton wirkt aber archaischer als das Botschaftsrelief. Es kommt dem Charakter eines «Tors zur Unterwelt» (Architekten) näher – der Pavillon greift zwölf Meter tief in eine Endmoräne ein und unterhöhlt sie – und evoziert vor allem Bilder von asiatischen Grottentempeln.
Von der Eingangshalle führt der Weg über eine Treppe hinunter in die beiden je 1300 m² grossen Untergeschosse. Beide unterirdischen Räume sind über eine zweite Treppe mit der Villa Wesendonck verbunden. Die Architekten verstehen diese Erschliessungen als Möbelstücke. Ihrer aufwändigen Gestaltung und ihrer Dimensionierung wegen wirken sie aber schon eher wie mobile Kabäuschen. Es sind Architekturen für sich. Denn die Wände, ein Gitterwerk aus Eichenholz, die in die Treppen hineingestellt sind (tatsächlich sind sie aufgehängt), lassen, obwohl durchbrochen, keinen Zweifel an ihrer Stabilität.
Unterbaut
Die Decken der Untergeschosse werden, ebenso wie jene des Foyers, von Unterzügen getragen (Kassettendecke). Z-förmig gefaltete Polycarbonatplatten sind in die Felder (von 10.4 × 3.6 m) der Kassettendecke eingelegt. Ästhetisch verleiht die Z-Form ihnen einen papierenen Charakter, konstruktiv wirkt sie versteifend, was erlaubte, sie ohne Sprossen anzubringen. Der Boden in den Räumen ist analog zu dem auf dem Platz draussen in Eichenstirnholzverbund verlegt.
Nicht nur erschliessungstechnisch, sondern auch konstruktiv besteht eine Verbindung zwischen oberirdischen und unterirdischen Räumen, indem Decken und Wände einem geschossübergreifend wirksamen, komplementären Tragsystem «unterworfen» sind, das aus einer massiven Stahlbetonkonstruktion besteht. Im 1. UG ist ein zentraler Raum eingestellt, dessen Scheiben nicht nur das darüber liegende Geschoss, sondern auch die an ihnen aufgehängte Decke des 2. UG tragen. Dieses weist – komplementär zum 1. UG – zwei Raumgevierte aus tragenden Wänden auf, die gleichzeitig die Treppenhäuser bergen. Der zentrale Raum im 1. UG und die beiden Gevierte im 2. UG haben nur an vier Stellen gemeinsame Auflager. Die Komplementarität des Systems gewährleistet einerseits die Abtragung der Deckenlasten und gewährt andererseits grösstmögliche Freiheit in der Bespielung der grossen freien Flächen. Für deren Unterteilung haben die Architekten 40 cm starke und dennoch verstellbare Wände konzipiert.
Um nicht nur die Statik der Villa nicht zu «untergraben», sondern auch Schäden am Terrazzoboden des einstigen Wintergartens zu vermeiden, musste sie aufwändig abgefangen werden. Bei allem Respekt gegenüber dem Bestand – Villa und Ökonomiegebäude wurden renoviert – haben die Architekten in die Farbgebung eingegriffen und das Weiss der Wände, Fensterleibungen und Profile durch dunkle Töne ersetzt. Um ihnen etwas Körperhaftes zu verleihen, verwendeten sie lasierende Keimfarben, die in drei Schichten auf Weissputz aufgetragen werden, aber erst bei der letzten Schicht ihren definitiven Farbton erhalten. Das Licht wird nun nicht an der Oberfläche reflektiert, sondern dringt erst tief in die Schichten ein und wird erst auf der Grundierung bzw. auf dem Weissputz zurückgeworfen und «durchläuft» erneut drei Schichten, ehe es abstrahlt. Der Effekt ist frappierend. Die Wände gewinnen Plastizität, Körperhaftigkeit.
Architektonische Lyrik
Grazioli / Krischanitz haben einen Bau geschaffen, der den Bestand respektiert, ohne sich ihm anzubiedern. Sie nehmen Bezug ohne platte Reverenzen und Äusserlichkeiten. Sie würdigen die Architektur, ohne sie bloss zu zitieren, wenn sie etwa die Erschliessung als Übersetzung der räumlichen Enfilage der Villa interpretieren. Sie erweisen den kabinettartigen Räumen der Villa die Reverenz, wenn sie den Hallencharakter mit bordeaux, olivgrün, grau, aubergine und anthrazit bemalten Raumkompartimenten brechen. Und sie betreiben Archäologie, wenn sie den Textilkünstler Gilbert Bretterbauer im ehemaligen Wintergarten bewegliche Screens entwerfen lassen mit einer Bespannung, die Pflanzenmotive aufweist. Mit der Gestaltung des Glasbaus als smaragdenen Baldachin aber transponieren sie nicht nur die Geschichte des Hauses und ihrer Bewohner. Wenn Wagner Mathilde Wesendoncks Gedichte vertonte, so haben Grazioli / Krischanitz ihre Lyrik in Architektur verwandelt.TEC21, Mi., 2007.02.14
14. Februar 2007 Rahel Hartmann Schweizer
verknüpfte Bauwerke
Museum Rietberg
Grabenlos erneuern
Versickerndes Abwasser oder entweichendes Gas stellen ein hohes Risiko im Untergrund dar. In beschädigte Kanäle eindringendes Grundwasser führt zu einer unnötigen hydraulischen Belastung der Kläranlagen. Die Techniken der grabenlosen Erneuerung von Rohrleitungen haben sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Die Funktionsweisen von Berstlining- bzw. TIP-Verfahren sind weitgehend bekannt. Dennoch gibt es Fragen, die sich Ver- und Entsorger bei der Wahl des Verfahrens stellen.
Eine Strasse wird aufgegraben. Die Zufahrten zu den Häusern sind sowohl für Anwohner als auch für Rettungsdienste erschwert. Eltern jonglieren Kinderwagen über die provisorische Fussgängerführung. Parkplätze sind weit und breit keine in Sicht. Und dann noch dieser Lärm den ganzen Tag. Eine Linienbaustelle im offenen Graben fordert Geduld und Verständnis von Anwohnern und Verkehrsteilnehmern. Um die negativen Begleiterscheinungen des klassischen Werkleitungsbaus zu vermindern, werden grabenlose Verfahren immer interessanter. Soll zum Beispiel ein Kanal unter einer stark befahrenen Strasse erneuert werden, kann diese Arbeit ohne aufwändige Umleitungen ausgeführt und der Verkehrsfluss weitgehend aufrechterhalten werden. Interessant ist der Einsatz der grabenlosen Technik speziell bei engen Platzverhältnissen oder bei schützenswerten Oberflächen, zum Beispiel einer historischen Pflästerung, bei Grünanlagen oder Bauwerken in der Altstadt. Tief liegende Leitungen können ersetzt werden, ohne darüber liegende Leitungen zu gefährden bzw. solche im Voraus verlegen zu müssen. Neben diesen Vorteilen versprechen die Unternehmer Kostenersparnis und eine erhebliche Verkürzung der Bauzeit.
Kosten- und Zeitersparnis
Um welchen Faktor verringern sich Bauzeit und Kosten beim Einsatz von Berstlining im Vergleich zu konventionellen Methoden in städtischen Verhältnissen tatsächlich? Nach Aussage von Fachpersonen[1] kann die Bauzeit um ca. 50 % verkürzt werden. Bei den Kosten zeigt die Erfahrung, dass das Einsparpotenzial bei rund 30 % der Gesamtkosten liegt. Dabei erhalte die Bauherrschaft eine neue Leitung mit entsprechender Lebensdauer.
Bei einer Erneuerung von zwei oder mehreren Leitungen im Kombigraben ist die Situation schwieriger zu beurteilen. Die Wirtschaftlichkeit der Methode muss unter Berücksichtigung anderer Kriterien von Fall zu Fall eingeschätzt werden.
Eine Beurteilung der Situationen und eine seriöse Arbeitsvorbereitung sind bei den grabenlosen Bauverfahren besonders wichtig: Wie ist die Qualität des Bodens? Welche Fremdleitungen sind vorhanden? Oft überschätzten Unternehmen ihre Fähigkeiten und unterschätzten die Risiken: «Sie können mit diesen Verfahren nicht den ganzen konventionellen Tiefbau ablösen», sagt Werner Zimmer[2]. Als wichtigen Teil der Qualitätssicherung beim Ersatz von Kanalisationsleitungen sieht er eine Videobefahrung vor Baubeginn. Denn die Situation in der Leitung kann sich seit der letzten Befahrung verändert haben. Ausserdem sollte der Rohrmeister die Verhältnisse im zu erneuernden Kanal im Voraus kennen, um auf eventuelle Hindernisse (Versatz, Muffen, Fremdkörper, Anschlüsse) mit Erhöhung der Zugkraft reagieren zu können.
Einbau und Qualitätssicherung
Da die neue Leitung in der bestehenden Trasse eingebaut wird und dort die Funktion der alten übernimmt, ist die Anwendung der Verfahren bei allen Böden möglich. Die Geologie ist in der Regel bekannt. Beim Berstlining werden die Scherben des Altrohrs in die Umgebung verdrängt. Durch die Verdichtung des Bodens seitlich und nach oben bleibt die Lage der ursprünglichen Sohle erhalten. Eine Gefällekorrektur ist nicht möglich. Versätze können jedoch ausgeglichen werden. Grundsätzlich kann das Verfahren bei allen Schadensbildern bis hin zum Totaleinsturz eingesetzt werden. Vorbereitende Massnahmen an der Altleitung, zum Beispiel Ablagerungen beseitigen oder Hindernisse abfräsen, sind noch nötig.
Wie wird nun aber eine Beschädigung des einzuziehenden Rohrs durch scharfkantige Bruchstücke des geborstenen Altrohrs vermieden? Die Scherben des Altrohres und die mit Bentonit verfüllten Zwischenräume bilden einen vollflächigen Verbund des neuen Rohres mit dem umgebenden Erdreich. «Bei den bisher ausgeführten Erneuerungen konnten noch keine Schäden an der Aussenhülle der Rohre erkannt werden. Zwar entstehen Schleifspuren am Aussenmantel. Riefen, deren Tiefe die zulässigen zehn Prozent der Manteldicke überschritt, sind aber noch nie vorgekommen», sagt Zimmer.
Die maximale Leitungslänge hängt vom Verfahren ab: Wird das TIP-Verfahren im städtischen Bereich angewendet, gibt die Haltungslänge die Strecke vor. Die Erfahrung zeigt, dass es sinnvoll ist, pro Tag eine Haltung zu erneuern. Somit beschränkt sich auch der Aufwand für das Stilllegen der Hausanschlüsse auf diesen Zeitraum.
Abhängig von den Bodenverhältnissen und der Grösse der Zugkraftmaschine sind beim Berstlining-Verfahren weitere Distanzen möglich. Die maximal zulässige Zugkraft hängt vom eingesetzten Rohrmaterial ab. Beispielsweise wurden in Hivange (Luxemburg) Stahlrohre DN 300 auf 1.5 km eingezogen. Die Haltungslänge betrug 240 m.
In der Regel liegt die Rückverformung von gespanntem Erdreich bei 12 bis 20 Stunden. Das heisst, nachdem die Aufweitung ausgeführt wurde, stellt sich eine Gewölbewirkung ein, und es ist notwendig, das Rohr innerhalb eines Tages einzuziehen. Denn schon einen Tag später wäre die Mantelreibung so gross, dass das Rohr beim Einbauen zerstört würde. Die Mantelreibungskräfte können durch glatte Oberflächen verringert werden. Um die Reibung bei schwierigen Böden herabzusetzen, wird in der Praxis ein umweltverträgliches Gleitmittel aufgetragen.
Fremdleitungen und Material
Begleitende Deformationsmessungen an der Oberfläche sind nicht notwendig. Wenn sich die Oberfläche heben würde und keine anderen Leitungen beschädigt wurden, kann man davon ausgehen, dass sich der Boden rückverformt.
Um negative Einwirkungen auf Fremdleitungen mit Sicherheit ausschliessen zu können, wird eine Distanz von mindestens 25 cm empfohlen. Die Festlegung der Abstände ist im Merkblatt 8 des RSV geregelt.[3] Da der Durchmesser der Leitung mit den grabenlosen Verfahren um bis zu zwei Nennweiten vergrössert werden kann, sind Voruntersuchungen unbedingt notwendig und die Pläne des Rohrleitungsnetzes sorgfältig zu prüfen.
Im Berstlining-Verfahren können alle Rohrmaterialien erneuert werden. Altrohre aus Steinzeug, Beton etc. werden zertrümmert und verdrängt. Altrohre aus Stahl, Kunststoff oder defekte Inliner werden aufgeschnitten und aufgeweitet. Das klassische Rohr für die Leitungserneuerung im Kanalbau ist das PP-Rohr oder ein PE-Rohr mit einem aufextrudierten, patentierten Schutzmantel aus mineralverstärktem Polyolefin. Die Rohre müssen zugfest oder verspannt sein, um die Kraft zu übertragen, die gebraucht wird, um das Rohr nachzuziehen.
Als das derzeit am besten geeignete Rohr für die grabenlose Erneuerung gilt das Dreischichtrohr «wavin TS». Das Rohr setzt sich aus einer innen und aussen liegenden Schutzschicht aus widerstandsfähigem PE-100-Werkstoff und einem Kern aus PE 100 zusammen. Die Schichten sind homogen miteinander verbunden und mechanisch nicht trennbar. Die äussere Schutzschicht ist widerstandsfähig gegen Kerben und Riefen, die beim Einziehen entstehen können. Die Innenschicht wirkt Punktlasten entgegen, die durch Scherben des Altrohres auftreten können.[4] Ein wichtiger Qualitätsaspekt beim Rohreinzug liegt in der Messung der Zugkräfte am Rohrstrang. Beim Einziehen können unvorhergesehene Kräfte auf das neue Rohr wirken. Wird eine permanente Zugkraftmessung im Inneren des Neurohrs installiert, kann auf die gelieferten Daten sofort reagiert werden. Übersteigt die Kraft die zugelassenen Werte, wird der Vorgang durch den Rohrmeister gestoppt. Die Verwendung des Zugkraftmessgeräts ist nicht zwingend vorgeschrieben, doch die Sicherheit eines fachgerechten Einbaus erhöht sich dadurch.
Bisher konzentriert sich die grabenlose Erneuerung auf Kreisprofile. Doch auch für alte gemauer-te Eiprofile wäre die Anwendung der Verfahren interessant. Die vorhandenen Zugkräfte würden ausreichen. Es gibt allerdings noch keinen Kaliberkopf, um diese Kanäle zu erneuern. Die Frage der Lagegenauigkeit beim Einzug eines Kreisprofils in die Bettung ist ebenfalls noch nicht geklärt.
Hausanschlüsse
Beschäftigt man sich mit dem Berstlining- oder dem TIP-Verfahren, stellt sich die Frage, wie der Anschluss bzw. die temporäre Ableitung von Seitenanschlüssen erfolgen. Da die Behinderung in der Regel nur einen Tag dauert, genügt der Stauraum im Kanal für das anfallende Abwasser. Ist hingegen ein Hochhaus betroffen, werden gesonderte Massnahmen wie das Bereitstellen eines Pumpwagens empfohlen. Beim TIP-Verfahren werden die Hausanschlüsse nicht mehr aufgegraben, sondern von innen per Robotertechnik angeschlossen. Die Anschlüsse werden im Voraus vermessen. Der Vorteil von Kaliber-Berstlining- oder TIP-Verfahren ist, dass, sobald das Rohr im Boden liegt und die Maschine abgekoppelt ist, ein funktionstüchtiges Rohr zur Verfügung steht. Nach der Druckprobe werden die Hausanschlüsse aufgefräst. Den Übergang bildet ein Sattelstück, das durch Injektionsverfahren mit Epoxidharz an das Anschlussstück des Übergangs zum Hausanschluss verspachtelt wird. Da das Rohr im Anfangsstadium leicht hinterläufig ist und erst später zusandet, ist der Übergang absolut trocken. Die Lagesicherheit des Rohres wird durch die Biegesteifigkeit des neuen Rohres und den geringen Ringspalt von ca. 4 mm gewährleistet. Pro Hausanschluss wird mit Kosten von 1000–1200 Franken gerechnet.
Durch das Öffnen von Hausanschlüssen, die aus dem Rohrinneren eingesetzt wurden, konnte man nachweisen, dass die Anschlüsse dicht sind. Langfristige Erfahrungen fehlen jedoch.
Für Ralf Escher[5] ist die zentrale Frage im innerstädtischen Bereich, bis zu welchem Verhältnis Leitungslänge/Anzahl Seitenanschlüsse das Verfahren wirtschaftlicher ist als der konventionelle Leitungsersatz im offenen Graben. Als Faustregel gilt: Bei mehr als 5 bis 7 Anschlüssen bei einer durchschnittlichen Haltungslänge von 50 m sind grabenlose Verfahren nicht mehr wirtschaftlich.
Ausblick
Rohrleitungsnetze stammen in der Regel aus unterschiedlichen technischen Entwicklungsstufen. Die Lebensdauer der Leitungen liegt zwischen 50 und 80 Jahren. Das Problem der defekten Rohrleitungen betrifft ganz Europa. Auch die Schweiz investiert jährlich Millionen, um die Wasserver- und -entsorgung sicherzustellen. Die gesetzliche Grundlage zur Kontrolle der bestehenden Abwasseranlagen ist im Gewässerschutzgesetz[6], Artikel 15, festgehalten. Öffentliche wie private Inhaber von Abwasserleitungen sind zur Überprüfung und Wartung aufgefordert. Der Überwachungsauftrag liegt beim Kanton. Jeder Kanalbetreiber muss heute davon ausgehen, dass nicht alle seine Kanäle dicht sind und er mit dem Betrieb seiner Kanalisation gegen das Gewässerschutzgesetz verstösst.TEC21, Mi., 2007.02.14
Anmerkungen und Literatur:
[1] Erstes Schweizer Symposium «Nachhaltige Rohrerneuerung von Ver- und Entsorgungssystemen», 30.11.2006, an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Windisch
[2] Werner Zimmer, Geschäftsführer, karo-san, www.karosan.ch
[3] Rohrleitungssanierungsverband e.V., www.rsv-ev.de
[4] www.wavin.de
[5] Ralf Escher, Bereichsleiter Projektierung, Tiefbauamt Stadt Zürich
[6] www.admin.ch
14. Februar 2007 Daniela Dietsche