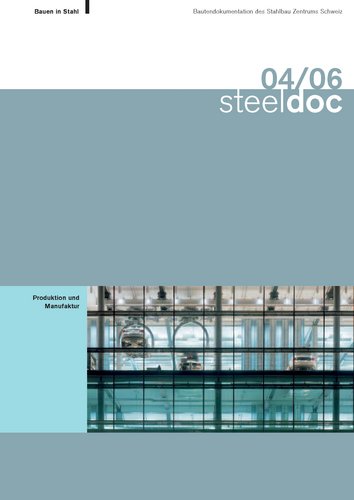Editorial
Stahl ist prädestiniert für den Industrie- und Hallenbau. Schon seit der frühen Industrialisierung wurden die Vorteile der grosse Stützenabstände und Spannweiten im Stahlbau für Fabrikationshallen genutzt. Ein Industriebau muss auch heute kostengünstig und praktisch sein. Produktionsgebäude sind aber auch Imageträger der Firmenphilosophie und der Marke. Die Manufakturen der grossen Autohersteller vor allem in Deutschland sind aktuelle Beispiele dafür, wie auch Produktionsabläufe öffentlich zur Schau gestellt werden, um die Effizienz und Ästhetik der Fertigung zu inszenieren.
Angesichts der in unseren Vorstädten wild wuchernden Industriezonen ist es erstaunlich, dass es für den Industriebau noch keine städtebaulichen Gestaltungsrichtlinien gibt. Umso wichtiger scheint es, Bauherren und Planer für die Qualität von Industriebauten zu sensibilisieren. Die Geschichte zeigt denn auch, dass sich die Qualität von Industriebauten langfristig auszahlt: Attraktive Industriegebäude aus früheren Jahrhunderten werden heute zu Kulturdenkmälern erhoben und in teuren Wohn- und Lebensraum umgenutzt. Die Gestaltung von Industriegebäuden richtet sich dennoch in erster Linie nach praktischen Parametern. Die Nutzung eines Gebäudes für die Fabrikation – sei es mit Maschinen oder von Hand – bedingt die Berücksichtigung von Lasten, Ausmassen und Produktionsabläufen. Die Wahl der Tragstruktur hat also direkte Auswirkungen auf die Raumdimension, die Leitungsführung für technische Installationen und die langfristige Nutzbarkeit der Geschosse. Es werden deshalb meistens Struktur-Typen gewählt, die sich additiv oder modular erweitern lassen, was letztlich auch die Langlebigkeit des Gebäudes ausmacht.
Im vorliegenden Steeldoc zeigen wir Beispiele von industriellen Bauwerken, bei denen sich Form und Funktion die Waage halten und die das Image der Bauherrschaft bewusst prägen. Der Essay stammt von Fritz Haller, dem Mitbegründer des ersten und wohl erfolgreichsten Bausystems der Schweiz: dem System USM Haller, das heute vornehmlich als System für Möbel in der ganzen Welt bekannt ist. Wie immer geht die Dokumentation bis ins Detail, so dass sie praktische Anregung und Planungshilfe bietet. Wir wünschen viel Vergnügen beim Studium der folgenden Seiten von Steeldoc.
Inhalt
03 Editorial
04 Bauen mit System
Essay von Fritz Haller
08 Produktionsgebäude Gira, Radevormwald
Stilvolle Hülle – funktionaler Kern
12 BMW Trainingsakademie bei München
Akademie des Automobils
16 Automobilmanufaktur Volkswagen, Dresden
Die gläserne Manufaktur
22 Wischerfabrik Valeo, Bietigheim-Bissingen
Produktion als Repräsentation
28 Bugatti Automobile, Molsheim
Die heilige Halle
31 Impressum
Industriebau aus dem Baukasten
Stahlprofile eignen sich für modulare und flexible Bausysteme. Seit den frühen 60er Jahren wurde in der Schweiz an solchen Systemen gearbeitet, um sie für die Nutzung und die Anforderungen des Industriebaus zu optimieren. Einer der Pioniere des Systembaus in Stahl ist Fritz Haller, der mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Schweizer Stahlbaukultur geleistet hat.
Fritz Haller gehört zu den Vertretern der so genannten «Solothurner Schule» – ein Begriff, den die Architekturkritik für eine Gruppe von Architekten verwendet, die sich in den 50er und 60er Jahren der Verwirklichung eines funktionalen und pragmatischen architektonischen Konzeptes verschrieben hatte. Die geografische Zuordnung war eher zufällig, als dass sich daraus eine Zugehörigkeit hätte ableiten lassen. Nebst Fritz Haller zählt man Namen dazu wie Alfons Barth, Franz Füeg, Max Schlup und Hans Zaugg. Sie bauten Schulen, Kirchen, Verwaltungsgebäude und Produktionshallen – losgelöst von der Idee der Anpassung an den historischen Kontext. Charakteristisch für ihre Arbeit war das Zusammenfügen vorgefertigter Teile und das Denken in «mechanischen Systemen», die auf die Optimierung konstruktiver Lösungen abzielten.
1963 realisierten der Architekt Fritz Haller und der Ingenieur Paul Schärer ein Fabrikationsgebäude für Fensterbeschläge, sowie ein dazugehöriges Bürogebäude in Münsingen im Kanton Bern und die passenden Büromöbel dazu. Es entstanden die Baukastensysteme MAXI, MIDI, MINI und das Möbelsystem unter dem Namen USM Haller. Noch heute, über 40 Jahre später, ist das Möbelsystem USM Haller unverändert und eines der weltweit erfolgreichsten Beispiele des Systemmöbelbaus. Die Stahlbau-Systeme sind modular aufgebaut und berücksichtigen Installationsführung, Nutzungsfreiheit und Erweiterbarkeit. Seit den 60er-Jahren werden damit Schulen und Produktionsgebäude gebaut, wie beispielsweise das Ausbildungszentrum der SBB in Murten oder der Naturwissenschaftstrackt der Kantonsschule in Solothurn. Die Weiterentwicklung eines System-Modells für hochinstallierte Gebäude blieb über Jahrzehnte eine Herausforderung für den Architekten Fritz Haller, die er in seinem Büro in Solothurn und in Zusammenarbeit mit dem Institut für Industrielle Bauproduktion der TU Karlsruhe zu einer lebendigen Forschungsarbeit machte. Er erhielt 1992 den Ehrendoktor der Ingenieurwissenschaften der Universität Dortmund.
Im nachfolgenden Beitrag schildert Fritz Haller seine Überlegungen und Beweggründe, die zur Entwicklung der Stahlbausysteme führten und welche Grundsätze auch heute für das industrielle Bauen gültig sind. Wir danken Fritz Haller für die Autorschaft.Steeldoc, Fr., 2007.02.09
09. Februar 2007 Evelyn C. Frisch
Stilvolle Hülle – funktionaler Kern
Im deutschen Radevormwald steht diese Produktionshalle für Kunststoff. Sie ist ein Erweiterungsbau, der durch seine schöne Form und Transparenz zum neuen Gesicht der Firma Gira geworden ist. Die Bogenkonstruktion erinnert an die erste Turbinenfabrik von Peter Behrens – ein Bau der wegweisend war für die Entwicklung des repräsentativen Industriebaus.
Als führender Hersteller von Elektro-Installationssystemen mit hohem Anspruch an Technik und Design hat GIRA auch an die Architektur ungewöhnliche Anforderungen gestellt. Das modulare Konzept sieht insgesamt vier zweigeschossige Gebäuderiegel vor, wobei die langfristige Nutzung offen bleiben sollte. Das Zusammenführen von kaufmännischer und gewerblicher Tätigkeit durch die Schaffung von gleichwertigen und humanen Arbeitsplätzen sollte ein sichtbares Zeichen der Unternehmerkultur sein: Transparenz und Innovation, Technik und Ästhetik. Die grossen Stützenweiten des Stahlbaus und damit stützenfreie Arbeitsflächen kamen diesem Konzept sehr entgegen. Die Räume können sukzessiv verändert, angepasst und erweitert werden. Bisher wurden zwei der geplanten vier Einheiten realisiert.
Im Erdgeschoss beider Gebäudeteile wird Kunststoff produziert, alle Räume sind natürlich belichtet. In den Obergeschossen befinden sich Büros sowie Prüflabors und die Werkzeugherstellung. Trennwände können leicht verschoben oder entfernt werden. Zwischen den Beiden Bogenhallen spannt sich ein begrünter Verbindungsbereich auf, der für die Treppenanlagen und die Erschliessung genutzt wird.
Die Tragstruktur besteht aus zwei praktisch unabhängigen Systemen: einer inneren Struktur als Tragwerk für die Produktion und einer äusseren für die Gebäudehülle. Die innere Struktur dient vor allem der Leitungsführung für die Produktion und der Deckenausbildung. Die schlanke Decke, teilweise aus Fertigelementen, wirkt durch Kopfbolzen mit den darunter liegenden Trägern im Verbund. Träger und Stützen sind aus Walzprofilen gefertigt und an hoch beanspruchten Stellen durch zusätzliche Stahlbleche verstärkt. Die Stützen sind gelenkig gelagert. Die Horizontalkräfte werden durch Decken und durch die Wandscheiben der Treppenhäuser aufgenommen. Zur Gewährleistung Feuerwiderstandes sind Träger und Stützen zwischen den Flanschen mit Stahlbeton verstärkt. Zur Führung von Installationen gibt es in den Trägern eine Vielzahl von Aussparungen.
Die Gebäudehülle bildet eine unabhängige Tragstruktur. Sie besteht aus geschweissten Stahl-Hohlkastenprofilen, die als Zweigelenkrahmen ausgebildet sind. Ihr Querschnitt variiert entsprechend dem Momentenverlauf. An den Fusspunkten sind die Rahmenstiele gelenkig gelagert. Auf den Rahmenriegeln liegen durchlaufende Dachpfetten aus Walzprofilen. Sie dienen als Unterlage für die Dacheindeckung und verbinden die Rahmen mit den Aussteifungen an den Stirnseiten des Gebäudes. Die tragende Dacheindeckung besteht aus Stahl-Trapezprofilen.
Die Fassade mit Stützenabständen von 6,5 Metern ist aus Stahl-Rechteck-Hohlprofilen gefertigt. Die Pfosten-Riegel-Konstruktion ist an die Zwischendecke angeschlossen. Im Dachbereich ist die Medienführung und die Technik für das Obergeschoss untergebracht: Licht, Sprinkler, Rauchmelder und Lautsprecher. Die Steuerung von Sonnenschutz, Beleuchtung, Heizung und Kühlung funktioniert über ein Leitsystem der Firma Gira, das auch mechanische Be- und Entlüftung zulässt. Wasserführende Rohrsysteme in den Massivdecken tragen zur Klimatisierung bei.
Das Brandschutzkonzept folgt den Gebäudefunktionen: im Erdgeschoss R 90 (Verbundkonstruktion), im Obergeschoss ein Brandschutzanstrich der Stahlkonstruktion R 30. Das ganze Gebäude ist darüber hinaus mit einer Sprinkleranlage ausgestattet. Vergleichsweise wäre hier in der Schweiz lediglich ein Feuerwiderstand R 30 für das Erdgeschoss gefordert.Steeldoc, Fr., 2007.02.09
09. Februar 2007
verknüpfte Bauwerke
Produktionsgebäude Gira
Bauen mit System
Am Anfang eines Projektes steht die Neugierde. Unsere Arbeit gleicht einem schmalen Pfade in einem Wald unbeschränkter Möglichkeiten. Denken in Systemen entspricht dem Wesen der menschlichen Natur. Es zielt auf Erkennen, Durchdringen und Ordnen und darauf, Gesetzmässigkeiten zu begegnen und ihnen im Modell zu folgen. System-Entwicklungen sind für unsere Epoche ein unentbehrliches Instrumentarium, Voraussetzung für freies mobiles Leben und globale Kommunikation. Sie ermöglichen die Teilhabe aller an allem.[1]
Wegweisende Systeme, im Speziellen auch Bausysteme, müssen offen sein für unterschiedliche Aufgaben und veränderte Nutzungen, für Verbesserungen und Weiterentwicklungen. Unsere Arbeit führte uns von den Baukastensystemen zu einer Art Systematik für das Bauen. Sie entwickelte sich zu einem Regelwerk für Bauabläufe und Bauwerke, zu Vorschlägen, wie Einzelteile zueinander in Beziehung treten und modular aufeinander abgestimmt werden können. Im Vordergrund stand nicht die Herstellung eines Produktes, sondern der Weg zur Lösung der gestellten Aufgabe.
Bei der Suche nach Lösungen für Bauaufgaben kristallisierte sich der Wunsch heraus, allgemein gültige Ordnungsprinzipien zu finden, die im Laufe unserer Arbeit wieder verwendbar sein sollten. Wir lösten uns von der Vorstellung, wie ein Haus entsteht, und versuchten unter dem Begriff «allgemeine Lösung» übergeordnete Zusammenhänge zu verstehen. Der Schritt vom Original hin zur allgemeinen Lösung hat mich ein Leben lang beschäftigt. Auch die natürliche Umwelt kennt solche Geheimnisse, übergeordnete Gesetze und Strukturen, die wir noch nicht begreifen und mit denen wir noch nicht umgehen können.
Baukastensysteme
Die Suche nach allgemein gültigen Ordnungsprinzipien führte zur Entwicklung von Baukastensystemen. Daraus erstellte Objekte besitzen eine spezielle Qualität des Gebrauchs und der Erscheinung. Sie sind Variationen von Anordnungen der Bausteine eines allgemeinen Systems. Solche Objekte sind umbaubar und können entsprechend dem Wandel ihrer Nutzung den neuen Anforderungen angepasst werden. Dabei verändert sich die Erscheinung des Objektes. Sein Wert wird bestimmt durch die Qualität des Baukastensystems und durch die Anordnung der Bausteine. Die Baukastensysteme «MAXI, MIDI, MINI und Möbel» sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit USM, Ulrich Schärer Söhne AG in Münsingen.
Das Stahlbausystem MAXI wird verwendet zum Bau von eingeschossigen Hallen mit grossen Spannweiten. Es besteht aus den Elementgruppen Tragwerk, Dachhaut, Aussenwand und Innenwand. Fundamente, Bodenkonstruktion und haustechnische Anlagen werden objektspezifisch erstellt. Das Tragwerk aus Stützen und Fachwerkträgern kann horizontal in alle Richtungen erweitert werden. Die Elemente der Aussen- und Innenwände sind demontierbar und im Rahmen der Modulordnung austauschbar. Das Stahlbausystem MAXI ist geeignet zum Bau von Produktionsanlagen, bei denen die Möglichkeit zum einfachen Um- und Anbau gegeben sein soll.
Das Stahlbausystem MIDI ist ein Baukastensystem zum Bau mehrgeschossiger, hochinstallierter Gebäude. Alle Bauteile werden in ihren Wechselbeziehungen zu einem modularen Gesamtsystem geordnet. So ist es möglich, auch objektspezifische oder vom Baumarkt angebotene Bauteile in den Gesamtbaukasten zu integrieren. Auch die geometrischen Ordnungen der Leitungssysteme für haustechnische Anlagen sind Teil der Gesamtordnung. Sie werden im Rahmen des Installationsmodells «Armilla» koordiniert.
Das Stahlbausystem MINI wird verwendet zum Bau von ein- bis zweigeschossigen Gebäuden mit Spannweiten bis 8.40 Meter. Es besteht aus den Elementgruppen Tragwerk, Boden, Dachhaut und Aussenwand. Fundamente, Untergeschoss und Innenausbauteile werden objektspezifisch erstellt. Das Tragwerk aus Stützen und Trägern aus kaltverformten Blechprofilen kann horizontal in alle Richtungen erweitert werden. Die Elemente der Aussenhaut sind demontierbar und im Rahmen der Modulordnung austauschbar. Mit dem Stahlbausystem MINI werden Bauten für unterschiedliche Nutzungen erstellt, Ateliers, Büro-, Schul-, Verkaufsbauten, Ausstellungs-Pavillons, Wartehallen und Wohnhäuser. Kurze Bauzeiten und rasche und einfache Um- und Anbaumöglichkeiten sind Vorteile dieses Bausystems.
Das USM Haller Möbelbausystem ist ein Baukastensystem mit den Baugruppen Traggerüste, Verkleidungen, Einbauten und Zubehör, sowie den Baugruppen Tische und Displaywände. Das Möbelbausystem ist ein kompletter Baukasten oder ein geschlossenes System. Es umfasst alle notwendigen Elemente zum Bau der unterschiedlichsten Objekte, wie offene oder geschlossene Akten- und Geräteschränke, Korpusse, Rollboys, Empfangstheken und Pflanzenkübel. Diese Objekte lassen sich zerlegen und erneut zu anderen Objekten zusammenbauen.
Forschungsarbeiten
Oft folgt man einer Idee, ohne zu wissen, wohin sie führt. Oft verliert man sich dabei und kehrt enttäuscht zurück. Gelegentlich aber führt uns das Gefühl zu Lichtpunkten, die das Wort Erfindung auslösen. Nur wenige solcher Lichtpunkte halten der Zeit stand. Es scheint, als ob die Dinge dieser Welt immer neu erfunden werden müssten, als sei Erfinden eine Art Wiederfinden. Am Anfang ist das Gefundene nur ein Teil des Ganzen. Dieser gefundene Teil bewirkt das Finden anderer Teile, bis letztlich das Ganze gefunden ist. Das heisst, wenn ein Teil eines Ganzen wirklich erfunden ist, dann ist der Weg zum Ganzen erschlossen. Der erfundene Teil trägt das Bild des Ganzen in sich. Man sollte sich nicht fürchten einen Teil eines komplexen Problems zu lösen, denn wenn diese Teillösung eine wirkliche ist, wird der Weg zum Ganzen geöffnet. Aber man muss vorsichtig sein beim Beurteilen seiner Arbeit, denn man erfindet auf Grund bestimmter Annahmen. Mit diesen hat man den Bereich der möglichen Lösungen festgelegt. Falsche Annahmen können eine taugliche Lösung verunmöglichen. Dieser Gefahr ist jeder ausgesetzt.
Die Forschungsarbeiten «geometrische Koordination », «Probleme des Fügens» und «Armilla» sind aus der Hoffnung entstanden, beim Suchen von Lösungen anstehender Probleme mehr Klarheit zu erhalten. Sie lieferten die Grundlage für die Entwicklung der Baukastensysteme und führten hin zu einer allgemein anwendbaren Systematik für das Bauen. Die theoretischen Studien wurden an konkreten Bauaufträgen in der Praxis getestet. Die einzelnen Bauwerke sind prototypische Anwendungen, Feldversuche in einem Prozess hin zur «allgemeinen Lösung».
Geometrische Koordination und modulare Ordnung
Die geometrische Koordination umfasst die Abstimmung der einzelnen Bauteile untereinander und im Zusammenspiel mit der Umwelt. Die technischen Möglichkeiten der Zeit, die gegebenen örtlichen Strukturen und insbesondere die Bedürfnisse der Menschen werden in die Entwicklung der modularen Ordnung aufgenommen. Ausgangspunkt ist die Analyse der bestehenden Randbedingungen und der funktionalen Zusammenhänge. Bei der Planung von Gebäuden hat sich für die Grundrisse eine Modulordnung mit einem quadratischen Raster von 1.20 Meter bewährt. Jede orthogonale Struktur lässt sich zurückführen auf quadratische Felder innerhalb eines Bandrasters. Dadurch wird es möglich, auch bestehende und konventionell erstellte Bauten mit der später beschriebenen Methodik von «Armilla» zu bearbeiten. Nicht orthogonale Strukturen lassen sich durch eine Anzahl identischer Standardflächen darstellen und mit analogen Regelwerken beplanen.
Probleme des Fügens: Form, Bewegung, Kräftefluss
Ziel der Arbeit war, ein Modell zu entwickeln, welches Bauteile von Bausystemen so beschreibt, dass die Eigenschaften ihrer Verbindungselemente in den Wechselbeziehungen von Form, Bewegung und Kräfteschluss erkennbar werden. Sie befasste sich mit den wesentlichen Problemen bei der Entwicklung von Bausystemen, der geometrischen Koordination der Systembausteine, der Ausbildung ihrer Verbindungen, der Kontrolle der Kräfteflüsse im statischen System und der Sicherung der Bewegungsräume, durch die die Elemente in ihre geplante Position gebracht werden.
Armilla: Operations- und Installationsmodell
«Armilla» ist das Resultat einer über vier Jahrzehnte gehenden Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Büro in Solothurn, am Institut für industrielle Bauproduktion der Universität Karlsruhe und der Zusammenarbeit mit «digitales bauen engineering gmbh» in Karlsruhe. Ausgangspunkt der Überlegungen war das Ziel, Nutzflächen von Gebäuden konfliktfrei und flächendeckend mit den benötigten Medien zu versorgen, Leitungssysteme mit EDVUnterstützung zu entwerfen, Leitungsteile als Elemente von Baukästen industriell zu fertigen und Montage, Umbau und Unterhalt von Leitungssystemen zu rationalisieren. Im Laufe der Arbeit hat sich «Armilla» zu einem Netzwerk von Methoden und Hilfsmitteln entwickelt, ganz allgemein geeignet zur Organisation kinetischer Systeme und Funktionen. Wir erwarten weitere interessante Anwendungsmöglichkeiten sowohl bei kleinsten Bauteilen als auch im Städtebau.
Operationsmodell
Das Operationsmodell ist ein Leitfaden für den Planungsprozess. Es beschreibt Inhalte und Abfolgen der einzelnen Planungsschritte. Die Baupläne der verschiedenen Gewerke werden zusammen mit den Fachplanern stufenweise als Baukästen generiert.
Installationsmodell
Das Installationsmodell «Armilla» ordnet die Installationsräume eines Gebäudes in all seinen Wechselbeziehungen. Es ist ein Modell für die modulare Koordination und den kooperativen Entwurf der technischen Systeme eines Gebäudes. Die Anordnungsregeln des Installationsmodells «Armilla» gewährleisten, dass bei einem Nutzungswandel das Gebäude zerstörungsfrei umgebaut werden kann – der Neubau ist ein Sonderfall des Umbaus.
Das allgemeine Installationsmodell ist eine Idealstruktur, in der das Verlegen von Leitungen ohne einschränkende Bedingungen geregelt ist. Die Installationsgeometrie baut auf einem orthogonalen Planungsraster auf. Die Modulordnung der verschiedenen Bauteilsysteme ist aufeinander abgestimmt und mit dem Muster potentieller Anschlussorte koordiniert. Der Deckenhohlraum wird in übereinander liegende Ebenen und horizontale Bänder gegliedert. Das allgemeine Installationsmodell kann durch Modifikation in ein spezielles Objektmodell überführt werden. Dieses ist gekennzeichnet durch die Eigenheiten der jeweiligen Bauteilsysteme.
EDV-Unterstützung
«Armilla» überträgt Begriffe und Methoden der Informationstechnologie auf die Architektur und ihre Planungs-, Bau- und Betriebsprozesse. Damit lassen sich geplante Gebäude ideal in Softwarestrukturen abbilden. Durch die kompakte Beschreibung in einer objektorientieren Datenbank entsteht der «Gen-Code» eines Gebäudes. Aus ihm heraus können alle Nutzungs- und Umnutzungsprozesse abgeleitet und gesteuert werden. Gegenüber herkömmlichen Planungsverfahren führt «Armilla» zu wesentlichen Verbesserungen der Qualitäts-, der Kosten- und der Terminkontrolle. Gebäude werden nicht mehr gezeichnet, sondern programmiert. Durch die EDVUnterstützung erschliessen sich neue Betätigungsfelder, insbesondere die industrielle Vorfertigung, die Unterstützung der Logistik und Montage, die Gebäudeautomation und das Facility Management. Mit der Methodik von «Armilla» kann ein Bauwerk in all seinen Abhängigkeiten von der Planung bis hin zu seiner Entsorgung erfasst, kontrolliert und betrieben werden. Dadurch werden die Kriterien für nachhaltiges Bauen in hohem Masse erfüllt.
Stimmen
Es geht immer ums Stimmen: ob etwas stimmt oder nicht stimmt. Je näher wir an den Punkt gelangen, an dem alles zum Stimmen kommt, desto feiner wird das, was wir tun. Stimmen hat zu tun mit Wahrhaftigkeit, Ethik, Ästhetik. Und es hat auch zu tun mit Stimme, mit Kommunikation und Begegnung. Auf einmal ist eine Stimmung da, durch die etwas ausgelöst wird, das vorher nicht ausgelöst werden konnte. In der Musik lernt man mit Stimmen und Stimmungselementen umzugehen. In diesem Sinne hat Architektur mit Musik zu tun. Pläne sind Partituren.
Das Bauwerk ist ein Regelwerk, vergleichbar einem Instrument, das ein System von Werten und Beziehungen vorgibt und zugleich fast unendlich viele unterschiedliche Spiele möglich macht. Erfolgreiches Spielen heisst Meditieren.Steeldoc, Fr., 2007.02.09
[1] Vgl. System-Design Fritz Haller: Bauten-Möbel-Forschung,
Hrsg. von Hans Wichmann, Verlag Birkhäuser Basel, 1989
09. Februar 2007 Fritz Haller