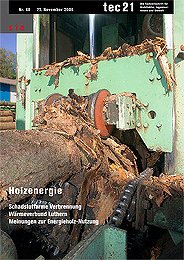Editorial
Holzenergie: Fluch oder Segen?
Die Wärmegewinnung aus Holz ist weitgehend klimaneutral und darum wichtig für die Energieversorgung der Zukunft. Die Holzverbrennung ist ein komplexer Prozess, der zwangsläufig zu mehr oder weniger hohen Schadstoffemissionen führt. Zwei Feststellungen, ein Dilemma.
Wie aus jedem Dilemma gibt es Auswege. Zuerst stellt sich die Frage nach dem Stand der Technik. Bei Grossanlagen ist es klar: Wer Kehricht mit Emissionen von weniger als 1 Milligramm Staub pro Kubikmeter verbrennen kann, könnte das mit Holz sicher auch. Automatische Steuerungen sorgen für optimale Verbrennungsbedingungen. Eine moderne Holzfeuerung mit Elektro- oder Gewebefilter erreicht bereits Werte von 20 Milligramm. Auch die Stickoxidemissionen können mit geeigneten Methoden um die Hälfte reduziert werden. Zweifellos werden diese Abgasreinigungssysteme noch weiter entwickelt in Richtung «mehr Leistung zu einem günstigeren Preis». Da in der Schweiz rund 40 Prozent des Brennholzes in grossen Anlagen verfeuert werden, kann die Schadstofffracht aus der Holzverbrennung bereits in naher Zukunft deutlich gesenkt werden.
Wie sieht es nun aus bei kleineren Anlagen? Technologien für optimale Verbrennung und Abgasreinigung wurden auch in diesem Segment entwickelt, sind aber bisher nicht vorgeschrieben worden und darum auch noch wenig verbreitet. Dazu kommt im Gegensatz zu Grossanlagen oder auch zu Öl- und Gasfeuerungen der Faktor Mensch. Wird in einem nicht idealen Gerät auf nicht ideale Weise gefeuert, so steigen die Partikelemissionen schnell auf das Hundertfache. Noch kritischer wird es, wenn das Holzfeuer gleichzeitig dazu benutzt wird, Abfälle loszuwerden.
Obwohl sie viel kleiner sind und kürzere Einsatzzeiten aufweisen, sind die privaten Kleinfeuerungen unter dem Strich deshalb genauso wichtig. Zur Lösung der lufthygienischen Probleme in diesem Bereich ist deshalb eine Doppelstrategie nötig: einerseits eine Festlegung von Abgasstandards, wie sie mit der Revision der Luftreinhalteverordnung und dem Qualitätssiegel von Holzenergie Schweiz vorgesehen ist. Und anderseits eine verbesserte Instruktion des Betreibers, gekoppelt mit einer einfachen Feuerungskontrolle, wie sie bei Ölheizungen schon seit 30 Jahren üblich ist. Dabei darf die Anfeuerphase keinesfalls vergessen gehen; sie macht bei Holzfeuerungen fast die Hälfte der Emissionsfracht aus. Wenn Ofen, Brennstoff und Bedienung den Anforderungen der Luftreinhaltung entsprechen, können auch kleine Anlagen mit Partikelemissionen von 50 Milligramm pro Kubikmeter oder weniger betrieben werden. Das ist bis zehnmal weniger als heute.
Fazit: Die Holzverbrennung fordert uns auf allen Ebenen. Wenn wir die Herausforderungen annehmen, lässt sich der lufthygienische Fluch beseitigen und der Segen der einheimischen Holzenergie nutzen, vom CO2-Vorteil bis zur Cheminéefeuer-Atmosphäre. Und nur das kann unser Ziel sein.
Hansjörg Sommer, Leiter Abteilung Lufthygiene, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich