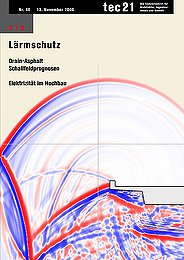Editorial
Lärm ist fast überall
Die aktuelle Mediendominanz der Kontroversen um den Fluglärm, insbesondere im Umfeld des Flughafens Kloten, hat die Öffentlichkeit beinahe vergessen lassen, dass ein grosser Teil der Menschen in der Schweiz primär unter den Lärmemissionen des Landverkehrs zu leiden hat. Angesichts des emotionalen Gesprächsklimas ist es deshalb angebracht, sich die gesamtschweizerisch relevanten Verhältnisse bezüglich Lärmbeanspruchung in Erinnerung zu rufen:
Gemäss den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation WHO sind rund 30 % der Schweizer Bevölkerung, in fast allen besiedelten Gebieten, heute immer noch übermässigen Lärmemissionen des Strassen- und Eisenbahnverkehrs ausgesetzt. Viele davon rund um die Uhr, andere mit extremen tageszeitlichen oder saisonalen Schwankungen, und in vielen Fällen in nachgewiesenermassen die Gesundheit schädigendem Ausmass. Es besteht heute weiterhin dringender Handlungsbedarf für Lärmschutzmassnahmen an Verkehrsachsen, nicht an einzelnen Stellen mit Spitzenwerten, sondern landesweit, entlang der Hautverkehrsachsen flächendeckend.
Im Unterschied zur Situation beim Fluglärm sind beim Strassen- und Eisenbahnlärm die technischen Mittel für eine wirksame Reduktion der Emissionen bekannt und erprobt. Und der politische Wille zu ihrer Umsetzung ist im Prinzip überall vorhanden und breit abgestützt: Die Grundlage für Massnahmen zum Lärmschutz in der Schweiz ist die 1986 erlassene Lärmschutz-Verordnung (LSV) mit Immissionsgrenzwerten (IWG), unter anderen für den Lärm von Strassenverkehr und Eisenbahnen.
Durch die 1987 in Kraft gesetzte LSV besteht für die Strasseneigentümer der gesetzliche Auftrag, ihre übermässig lärmigen Strassenabschnitte zu sanieren. Für Strassenverkehrsanlagen wird heute geschätzt, dass rund 550 000 Personen Lärmbelastungen über dem für Wohnzonen festgelegten IGW von 60 db A ausgesetzt sind. Die lärmtechnische Sanierung dieser Gebiete, die gemäss LSV ursprünglich bis 2002 hätte abgeschlossen werden sollen, ist gegenwärtig, meist als Folge von Sparmassnahmen, erst zu rund einem Drittel realisiert worden. Im Jahr 2004 sind die Sanierungsfristen für Nationalstrassen bis 2015 und für Haupt- und übrige Strassen bis 2018 verlängert worden. Die Gesamtkosten der anfallenden Sanierungen wurden 2004 auf rund 3.4 Mia Franken geschätzt, die aktuellen Kosten dürften erheblich höher sein. Hier bieten neue technologische Ansätze, wie lärmreduzierende Beläge, ein zukunftsträchtiges Sparpotenzial.
Bei der Eisenbahn ist die Lärmsanierung vor einigen Jahren angelaufen, um die rund 265 000 Personen zu schützen, die über dem IGW belastet sind. Die Sanierung des Rollmaterials sollte bis 2009, die Erstellung der baulichen Lärmschutzmassnahmen bis 2015 abgeschlossen sein.
Nach Abschluss der Lärmsanierungen wird die Schweiz nicht frei von (Land)verkehrslärm sein. Wenn dieser für die gesamte Bevölkerung ein erträgliches Ausmass aufweist und keine lärmbedingten gesundheitlichen Störungen mehr auftreten, wird das Ziel der Lärmschutzplanung erreicht sein. Wenn es möglich wird, dieses Schutzziel ohne Hunderte von km Lärmschutzmauern zu erreichen, wenn die unumgänglichen Lärmschutzbauten polyvalent nutzbar sind und wenn sie auch architektonisch innovativ sind, können die leisen Verkehrswege der Zukunft vielleicht auch unerwartete, positive soziale und wirtschaftliche Entwicklungen auslösen. (Daten: Bundesamt für Umwelt BAFU, www.umwelt-schweiz.ch)
Aldo Rota
Inhalt
Lärmschutz mit Drain-Asphalt
Thomas Hirt, Andreas Steiger
Im Urner Reusstal wird die Betonfahrbahn der A2 aus den 1970er-Jahren durch einen «Flüster-Belag» ersetzt. Lärmschutzwände sind nur lokal vorhanden, teilweise haben sie eine Zweitfunktion als Hochwasserschutz.
Schallfeldprognosen bei Lärmschutzbauten
Kurt Heutschi
Durch Labormessungen mit verkleinerten Modellen kann die Schallausbreitung an Verkehrsbauten untersucht werden. Eine rechnerische Simulation veranschaulicht die Schallemissionen einer geplanten neuen Tramlinie in Zürich.
Elektrizität im Hochbau
Martin Lenzlinger
Die revidierte Norm SIA 380/4 «Elektrische Energie im Hochbau» soll zu einer rationellen Verwendung von Elektrizität in Bauten und Anlagen beitragen. Neue SIA-Tools helfen bei der Anwendung.
Wettbewerbe
Dem Kanal entlang: Am aargauischen Wasserschloss soll gebaut werden. Ein privater Grundeigentümer führte in Gebenstorf einen Studienauftrag durch
Magazin
Ausstellung: Jean Prouvé / Strom aus Wasserkraft / Davos setzt auf Erdwärme / Beschwerderecht der Umweltorganisationen / Publikation: Haustechnik-Planung / Denkmalpfleger befürchten Sanierungsmoratorium / Korrigenda
Aus dem SIA
Geschäftslage im 3. Quartal: unvermindert steigender Auftragseingang / Umsicht: zehn Auszeichnungen / Präsidentenkonferenz: Fokus für 2007 und Budget
Produkte
Impressum
Schallfeldprognosen bei Lärmschutzbauten
Für die Lärmbekämpfung stehen heute experimentelle und rechnerische Methoden zur Verfügung, die auch in komplexen Geometrien eine zuverlässige Prognose der Schallfelder erlauben. Dies ermöglicht die wirtschaftliche Optimierung von baulichen und materialtechnologischen Schallschutzmassnahmen, beispielsweise im Umfeld von Eisenbahnen.
Zur Verminderung von Strassen- und Eisenbahnlärm werden vielgestaltige Lärmschutzbauten eingesetzt. Am weitesten verbreitet sind Lärmschutzwände, welche die direkte Sichtlinie von der Quelle zum Empfänger unterbrechen und damit bedeutende Dämpfungen erzielen. Im Unterschied zum optischen Fall gelangen aber in abgeschirmte Bereiche, d.h. in die «Schattenzonen», immer noch Schallanteile. Dafür verantwortlich ist das Beugungsphänomen als direkte Konsequenz des Wellencharakters von Schall und den Grössenverhältnissen von Wellenlängen und geometrischen Dimensionen. Obwohl der dahinterstehende Mechanismus relativ kompliziert ist, kann die lärmmindernde Wirkung einer einfachen Wand mit bewährten empirischen Handformeln schnell und zuverlässig berechnet werden.1 Sobald die Geometrien komplizierter werden, sei es durch komplexere Lärmschutzbauten wie Galerien oder durch reflektierende geometrische Elemente in der Umgebung, versagen die Handformeln. Hier kommen aufwändigere Verfahren wie Massstabsmodell-Experimente oder wellentheoretische Schallfeldsimulationen zum Einsatz.
Massstabsmodell-Experimente
In vielen Fällen stellen sorgfältige Messungen eine genaue Methode zur Charakterisierung der Schallausbreitung in einer komplexen Geometrie dar. Da oft die Originalsituation nicht zur Verfügung steht, behilft man sich mit einem Nachbau im Labor. Hierbei bedient man sich der Längenskalierbarkeit von Schallfeldern. Wenn Geometrie und Schallwellenlängen um den gleichen Faktor verkleinert werden, ändert sich an der Schallausbreitung nichts. Im Vergleich zum Original ist die Frequenz aber um den gleichen Faktor höher. In der im Modellmassstab von z.B. 1:16 nachgebauten Geometrie können Messungen der Schallausbreitung mit speziellen Lautsprechern und Mikrofonen durchgeführt und so Ausbreitungsdämpfungen zu interessierenden Empfängerpunkten bestimmt werden. Zwei Aspekte sind allerdings besonders zu beachten: Die Materialwahl im Modell muss so erfolgen, dass die Oberflächen im transformierten Frequenzbereich die gleichen Reflexionseigenschaften aufweisen wie das Originalmaterial im Originalfrequenzbereich. Die andere Schwierigkeit ergibt sich aus der extrem starken Zunahme der Luftdämpfung gegen hohe Frequenzen. Bei den Modellexperimenten ist deshalb diese (im Originalmassstab nur stark abgeschwächt auftretende) Dämpfung abzuschätzen und abhängig vom Schalllaufweg zu kompensieren.
Über den erfolgreichen Einsatz der Modellmesstechnik bei der Überdeckung und Teilüberdeckung der A1 bei Neuenhof wurde in tec21 bereits berichtet.2 Die Bilder 1 und 2 zeigen aktuelle 1:16-Laboraufbauten zur Untersuchung der Schallausbreitung in Eisenbahneinschnitten und an Eisenbahntunnelportalen im reflexionsarmen Raum der Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa). Obwohl in gewissen Fällen keine direkte Sicht auf den Zug besteht, können durch Reflexionen an den Einschnittwänden bzw. am Zugskörper bedeutende Schallanteile den Weg zu einem Empfängerpunkt finden. Die vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) finanzierte Untersuchung stellt ein Element zur genaueren Prognose der Schallausbreitung im überbauten Gebiet dar.
Simulation von Schallfeldern
Die aktuell verfügbare Rechenleistung ermöglicht mittlerweile numerische Simulationen, die direkt auf den physikalischen Schallfeldgrundgleichungen basieren. Dazu werden der interessierende Feldbereich mit einem Gitter überzogen und für die Gitterpunkte die entsprechenden Differenzialgleichungen durch Differenzengleichungen angenähert. Bei der Untersuchung von Lärmschutzbauten ist eine Simulation im Zeitbereich günstig,3 da als Resultat eine Impulsantwort bestimmt werden kann. Die Analyse der Laufzeit einzelner Anteile ermöglicht Rückschlüsse auf den Laufweg und damit ihre Herkunft. Bei dieser Modellierung wird die Schallausbreitung exakt nachgebildet, d.h., es sind keinerlei empirische Näherungen mit nachträglichen Parameteranpassungen notwendig.
Ein Beispiel für die Anwendung einer rechnerischen wellentheoretischen Simulation zeigt Bild3. Für eine neue Tramlinie, die unter dem Brückendach verlaufen soll, interessierten die Immissionspegel an den Hausfassaden. Aufgrund der Geometrie ist von «raumakustischen» Verhältnissen auszugehen, d.h., das Schallfeld setzt sich nebst dem Direktschall aus einer Vielzahl von Ein- und Mehrfachreflexionen zusammen. Da mit konventionellen Berechnungsmodellen hier keine zuverlässigen Prognosen möglich sind, wurden durch die Empa numerische Simulationen durchgeführt. Bild 4 zeigt das sich einstellende Schallfeld in der zeitlichen Evolution, wenn an der Quelle im Radbereich des Trams ein Impuls emittiert wird. Durch Aufsummation der Beiträge aller Wellenfronten, die einen Empfängerpunkt überstreichen, kann schliesslich auf den zugehörigen Immissionspegel geschlossen werden.
Aus derartigen Simulationen lassen sich zuverlässige Prognosen der Schallfelder in Lärmschutzbauten bzw. in der nahen Umgebung gewinnen. Damit können bei hohem Kosteneinsparungspotenzial wirtschaftliche Optimierungen hinsichtlich der geometrischen Gestaltung von Bauwerken oder der Oberflächenbelegung mit schallabsorbierenden Materialien durchgeführt werden.TEC21, Mo., 2006.11.13
13. November 2006 Kurt Heutschi