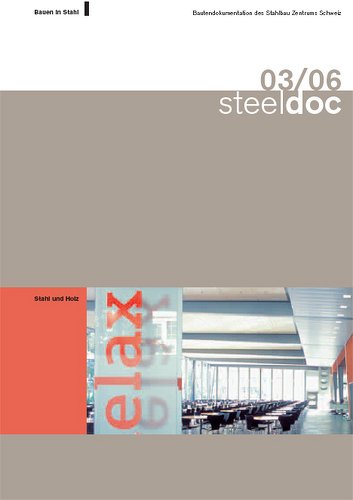Editorial
Holz und Stahl haben sehr unterschiedliche Eigenschaften. Kurz gesagt: Stahl ist hart und kalt, Holz ist warm und weich. Diese Eigenschaften werden in der chinesischen Philosophie als die Kräfte Yin und Yang bezeichnet. Im Zusammenspiel ergänzen sich beide Elemente und garantieren die ständige Erneuerung, die Dauerhaftigkeit im Wandel und somit die Lebenskraft. Auch wenn der Vergleich mit Yin und Yang etwas weit hergeholt scheint, so bietet die Kombination von Stahl und Holz tatsächlich viele Vorteile. Der Stahlbau produziert leichte, schlanke und hochbelastbare Bauteile für das Tragwerk, der Holzbau flächige und multifunktionale Elemente für Decken und Wände. Gemeinsam ist beiden Bauweisen der hohen Vorfertigungsgrad, die kurzen Montagezeiten und die Umweltfreundlichkeit. Nicht zu vergessen ist nämlich, dass Stahl die höchste Recyclingquote aller Baustoffe hat und meisterhaft sparsam im Materialverbrauch ist. Stahl und Holz bieten im Doppel also mehr als nur ihre Summe.
Das vorliegende Steeldoc zeigt Lösungen, die technisch und wirtschaftlich interessant sind und die architektonisch überzeugen. Der einführende Artikel geht auch auf konstruktive und physikalische Aspekte der Baustoffkombination ein. Hierfür haben wir Martin Mensinger, Professor für Bautechnik, und Ralph Schläpfer von der Holzbaufirma Lignatur um fachlichen Input gebeten. Insgesamt werden fünf Projekte aus der Schweiz und dem umliegenden Ausland bis ins Detail vorgestellt und erläutert. Der Restaurant-Komplex der Firma Siemens in Zürich nutzt die Vorteile beider Baustoffe in exemplarischer Weise. Nicht ganz neu, aber noch selten im Detail publiziert, ist die Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen in Berlin. Hier hat sich das von der Industrie gezeichnete Ruhrgebiet mit einem Manifest der Nachhaltigkeit profiliert – nicht nur durch die Wahl der Baustoffe Stahl und Holz, sondern auch durch innovative Bautechniken. Eine kleine Kapelle in Stahl und Holz zeugt von der poetischen Interpretation beider Materialien und eine grosse Schulanlage im deutschen Augsburg von den rationellen und kostensparenden Aspekten der hybriden Bauweise. Zum Schluss stellen wir zum Thema Behaglichkeit ein aussergewöhnliches Wohnhaus in Wien vor, bei dem nicht nur Stahl und Holz zur Anwendung kamen.
Entstanden ist eine lehrreiche Dokumentation für Planer und ein erster Versuch, die beiden Baubranchen einander näher zu bringen. Denn die Zusammenarbeit zwischen Holz- und Stahlbau-Unternehmen sowie der Rückgriff auf spezialisierte Ingenieure beider Richtungen führen zweifellos zu einer inspirierenden und innovativen Entwicklung der Leicht- und Trockenbauweise. Diese Entwicklung ist sowohl für die Umwelt und die Gesellschaft als auch für die beiden Baubranchen Holz und Stahl von nachhaltigem Nutzen. Wir wünschen viel Vergnügen und Inspiration beim Studium der nachfolgenden Seiten von Steeldoc. Evelyn C. Frisch
Inhalt
03 Editorial
04 Einführung
Gemischtes Doppel: Stahl und Holz im Verbund
08 Siemens Restaurants, Zürich
Geschliffene Eleganz aus Stahl und Holz
14 Landesvertretung Nordrhein-Westfalen, Berlin
Kathedrale der Nachhaltigkeit
18 Schulkapelle Gymnasium Bad Münstereifel, D
Die Stahlschleife
22 Realschule Augsburg, D
Klare Strukturen für den Schulalltag
26 Wohnhaus, Wien
Ein gläsernes Baumhaus
31 Impressum
Gemischtes Doppel: Stahl und Holz im Verbund
Leicht, ökologisch, montagefreundlich – Holz- und Stahlbau haben viele gemeinsame Stärken. Und wo sie sich unterscheiden, lassen sie sich ideal ergänzen. Ist der Stahlbau für eine flexible und schlanke Tragstruktur geeignet, bietet ihm der Holzbau flächige und leistungsfähige Decken- und Wandelemente, welche die gewünschte Behaglichkeit der Räume mit sich bringen.
Für viele Bauherren und Investoren ist die umweltfreundliche und schonende Bauweise heute zu einem Image-Faktor geworden. Der Holzbau gewinnt in der Schweiz an Terrain – auch bei öffentlichen und mehrgeschossigen Bauten. Der Stahlbau macht mit ausserordentlichen Tragstrukturen, mit leichten und filigranen Überdachungen und Brückenbauten von sich reden. Im angelsächsischen Raum ist der Stahlbau auch im Geschossbau und oft im Wohnungsbau die führende Bauweise. Schlank, leicht und umweltfreundlich zu bauen hat Zukunft. Angesichts der sich rasant entwickelnden Nutzungsanpassungen von Gebäuden und der Belastung durch Baulärm, Staub und Behinderungen bei Bauvorhaben, sollte die schnelle, effiziente und praktisch fehlerfreie Leichtbauweise aus Holz- und Stahlelementen als Standard gelten. Warum heute der Grossteil der Bausubstanz noch aus Beton gebaut wird, liegt wohl am vermeintlichen Planungsaufwand, den Architekten und Ingenieure fürchten, wenn sie sich an eine Bauweise wagen, deren Lösungen ihnen weniger geläufig sind.
Gemeinsame Stärken Für die gemeinhin angenommenen Schwächen wie Schallschutz, Brandschutz und Korrosions- bzw. Holzschutz kommen heute bewährte Lösungen und Konstruktionsprinzipien zur Anwendung, deren Bekanntheitsgrad zugunsten der hybriden Bauweise gefördert werden sollte. Holz ist atmungsaktiv und gleicht den Feuchtigkeitshaushalt der Räume aus, was sowohl im Winter als auch im Sommer eine angenehme Klimati- sierung der Raumluft bewirkt. Holz wächst nach und bindet CO2. Der Stahlbau glänzt mit den höchsten Recyclingwerten aller Baustoffe, hat eine lange Lebensdauer und lässt sich umweltschonend und sparsam montieren und demontieren. Beide Bauweisen garantieren kürzeste Bauzeiten und grosse Flexibilität in der Erweiterung, Ergänzung oder Umnutzung von Bauten. Im Doppelpack ist also die Stahl-Holzbauweise punkto Nachhaltigkeit kaum zu übertreffen.
Verbindung von Holz und Stahl Holz und Stahl sind seit jeher Zweckgemeinschaften eingegangen – gerade bei Verbindungen. Einer der ersten Stahlbauten der Geschichte ist die Brücke von Coalbrookdale in England aus dem Jahr 1779. Während sie sich formal an den Bogenbrücken aus Mauerwerk orientiert, ist ihre Verbindungstechnik aus dem Holzbau entlehnt. Da zum Zeitpunkt des Baus weder das Nieten, das Schrauben noch das Schweissen erfunden waren, sind die Verbindungen wie im Holzbau «verzapft».
Die Entwicklung der verschiedenen Verbindungstechniken verhalf dem Stahlbau zu seiner Stellung als schnelle und industrielle Bauweise, sie ermöglichte indirekt auch den Erfolg des modernen Holzbaus. Ohne die leistungsfähigen Verbindungselemente aus Stahl wären die heute realisierten Holzbauten praktisch undenkbar, denn mit den traditionellen Verbindungstechniken lassen sich nur relativ geringe Kräfte übertragen. Stahl dient dem Holzbau zudem zur Aussteifung und Stabilisierung und zur Überbrückung grosser Spannweiten. Wird Stahl generell für die Tragstruktur und Holz für die flächigen Elemente eingesetzt, kommen die Stärken beider Materialien sinnvoll zum Tragen.
Vorfabrikation und Modularisierung Sowohl der Stahlbau als auch der Holzbau beruhen auf der industriellen Vorfertigung. Dies bedingt eine präzise Planung und legt die Standardisierung und Modularisierung von Bauelementen nahe. Im Stahlbau wurde die Idee der Modularisierung bereits an der Londoner Weltausstellung 1851 im Kristallpalast von Paxton unter Beweis gestellt. Mit einer Gesamtfläche von rund 93’000 m² ist er bis heute wahrscheinlich der grösste Modulbau. Die Idee des modularisierten Bauens ist dem Stahlbau in vielfältiger Form erhalten geblieben: Der Stahlbaumarkt bietet unzählige Systeme für unterschiedlichste Zwecke an. Auch im Holzbau wird im Werk vorfabriziert, oft kommen ganze Hausteile mitsamt Isolation, Installationen und Öffnungen auf die Baustelle und werden dort nur noch zusammengefügt. Gerade bei mehrgeschossigen Bauten ist die Modularisierung der Decken- und Wandelemente ein entscheidender Kostenfaktor. Bei der Kombination beider Bauweisen kann auf ähnliche Fertigungs- und Montagetechniken zurückgegriffen werden, was die Schnittstellen vereinfacht.
Flächenelemente aus Holz Im Holzbau stehen eine Vielfalt von flächigen Decken- und Wandelementen als ausgereifte Produkte zur Verfügung. Hohlkastenelemente, Brettstapeldecken oder massive Brettschichtholzplatten usw. bieten sich als schlanke Deckenkonstruktionen an. Viele dieser Produkte haben gute bis sehr gute Trittschallwerte und eignen sich teilweise auch als Akustikdecken. Die Installationsführung kann durch die Hohlkastenelemente gezogen werden, so dass die Untersicht der Decken und somit die Holzsstruktur sichtbar bleibt. Sind die Stahlträger in die Decke integriert, so ist der Deckenquerschnitt erheblich schlanker, was Raum spart und eine flächige Wirkung der Deckenuntersicht ermöglicht. Unter Umständen kann beim Brandschutz des Stahlträgers auch die Holzüberdeckung berücksichtigt werden. Hohlkasten- oder Massivholzdecken sowie beplankte oder Massivholzwände erreichen je nach Abmessungen ohne weiteres einen Feuerwiderstand von 30 bis 60 Minuten.
Brandschutz Holz brennt, aber isoliert, und Stahl brennt nicht, aber erwärmt sich rasch. Beide Baustoffe haben also ein spezifisches Brandverhalten. Im Holzbau wie im Stahlbau sind in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte im Brandschutz gemacht worden. Die neuen Brandschutzvorschriften berücksichtigen standardmässig bauliche und technischen Massnahmen (Sprinkleranlagen). Drüber hinaus kann ein objektbezogenes Konzept mit technischen und organisatorischen Massnahmen weitergehende Erleichterungen bringen, wenn das Schutzziel gleichwertig erreicht wird.
Massgebend für den Brandschutz von Tragstrukturen ist grundsätzlich die Dauer des Feuerwiderstandes (R) eines Bauteils, zudem ist bei flächigen Bauteilen die Fähigkeit zur Bildung von Brandabschnitten, d.h. die Dichtigkeit (E) sowie die Isolationsfähigkeit (I) zu berücksichtigen. Beim Zusammenspiel der beiden Baumaterialien kommt den Stahlbauteilen im Wesentlichen nur tragende Funktion zu (R), Holzbauelemente können zudem auch brandabschnittsbildende Wirkung haben (EI). Holzbauteile erreichen heute mit geeigneten Massnahmen die Klassen REI 30 und REI 60, womit auch mehrgeschossige Bauten in Holz möglich werden. Wird das Tragwerk aus Stahl erstellt, muss dieses den geforderten Feuerwiderstand erfüllen (z.B. R 30 oder R 60), die flächigen Holzelemente dienen dann zur Bildung von Brandabschnitten (EI 30 oder EI 60). Die Dichtigkeit wird durch die Ausbildung der Fugen definiert.
Sowohl Stahl- als auch Holzbauteile lassen sich durch Überdimensionierung, Verkleidung oder durch technische Massnahmen schützen. Sprinkleranlagen bieten für beide Bauweisen erhebliche Erleichterungen: bei tragenden Bauteilen erlauben die Brandschutzvorschriften, dass die Anforderung an die Feuerwiderstandsdauer bei vielen Nutzungen ohne speziellen Nachweis um 30 Minuten reduziert werden darf, oder es kann beim Holz auf nicht brennbare Verkleidung verzichtetet werden. Eine grosse Neuerung für den Stahlbau bringen Brandschutzanstriche bis zur Feuerwiderstandsklasse R 60, so dass Stahlträger und Stützen in den meisten Fällen auch in Bauwerken mit hoher Brandbelastung sichtbar bleiben können.
Zur Lösung des Brandschutzes sei hier auf die einschlägige, aktuelle Literatur zum Brandschutz verwiesen, welche die geeigneten Brandschutzmassnahmen und Nachweise leicht verständlich und nachvollziehbar vermittelt. Sowohl die Publikationen des Stahlbau Zentrums Schweiz als auch der Lignum wurden von der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen als «Stand der Technik-Papier» akzeptiert und können zur Brandschutzplanung verwendet werden. Sie sind hier unter «Literatur» aufgeführt.Steeldoc, Do., 2006.11.02
Literatur:
Steeldoc 02/06, Brandschutz im Stahlbau; zu beziehen bei Stahlbau Zentrum Schweiz: www.szs.ch Lignatec 17/2005,
Bauten in Holz: Brandschutz-Anforderungen und Lignatec 18/2005, Bauteile in Holz - Feuerwiderstandsdauer 30 und 60 Minuten; zu beziehen bei Lignum, Holzwirtschaft Schweiz: www.lignum.ch
02. November 2006 Evelyn C. Frisch, Martin Mensinger, Ralph Schläpfer